Proteste gegen Wilderei: Heroin aus Afrika
Trotz internationalem Verbot floriert der organisierte Handel mit Elfenbein. In 125 Städten weltweit sind Protestmärsche geplant.
BERLIN taz | Der illegale Handel mit Wildtierprodukten ist das viertlukrativste Verbrechen der Welt - nach Waffen-, Drogen- und Menschenhandel. „Der Stoßzahn eines Elefanten bringt mehr ein als ein Kilo Gold oder Heroin“, sagt Brit Reichelt-Zolho, Afrikaexpertin beim WWF. Fatal für das größte an Land lebende Säugetier der Welt: Die Elefanten-Wilderei hätte „industrialisierte Züge“ angenommen, berichtet die Naturschutz-Stiftung Wildlife Conservation Society (WCS). Im südost-afrikanischen Mosambik würden pro Jahr zwischen 1500 und 1800 Elefanten getötet.
Damit es so nicht weiter geht finden am Samstag in weltweit 125 Städten Protestmärsche gegen das Abschlachten von Elefanten und Nashörnern statt - von Johannesburg bis Düsseldorf, von Mosambik bis München.
„Das Töten von Elefanten im Norden von Mosambik hat noch nie dagewesene Proportionen angenommen“, sagt Carlos Pareira, WCS-Berater. In den letzten Jahren sei das Wildern industrialisiert worden: Nicht nur mit automatischen Waffen und großkalibrigen Gewehren gingen die Jagdfrevel auf ihre Beute los. Sie vergifteten zusätzlich Trinkwasserquellen und versteckten Fallen in den Büschen.
Mehrere zehntausend Elefanten werden pro Jahr in Afrika gewildert. Seit 1989 der internationale Elfenbein-Handel verboten wurde, war diese Zahl nie mehr so hoch. Gründe für das „dramatische Ausmaß der Wilderei“ sind einerseits die wachsende Nachfrage in Asien nach Elfenbein-Schmuck, sowie zahlreiche Ausnahmen beim Verbot. So durfte während den letzten Jahren wieder vermehrt Elfenbein nach Japan und später auch nach China exportiert werden.
Elefanten vs. Bauern
Die Regierung Mosambiks hat im Juni ein Gesetz verabschiedet, um die Elefanten-Wilderei zu kriminalisieren. Bislang hatten die Jäger Geldstrafen zu fürchten, künftig drohen ihnen Gefängnisstrafen bis zu 12 Jahren. Nun müssten die Gerichte das neue Gesetz auch tatsächlich umsetzen, betont WWF-Referentin Reichelt-Zolho.
Daran haperte es. Zudem sei das Problem komplexer: Die Elefanten zertrampeln den Bauern in Mosambik die Felder, zerstören die Ernte. Es seien die vom Staat „vergessenen Gebiete“, wo organisierte Gangs die Bauern mit Waffen ausrüsteten und für das Abschlachten der Elefanten bezahlten. „Es geht hier nicht nur um Naturschutz“, so die Expertin. „Es ist ein entwicklungspolitisches Problem.“
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





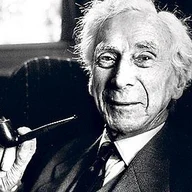
meistkommentiert