Kampf gegen die Coronapandemie: Rückschlag bei Impfstofftests?
Bei der Entwicklung eines Impfstoffs gibt es Probleme. Der Pharmakonzern AstraZeneca stoppt Tests, weil ein Proband offensichtlich erkrankt ist.

ap | Der internationale Pharmakonzern AstraZeneca hat Studien an einem möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus auf Eis gelegt. Grund sei ein Bericht, wonach bei einem Patienten eine schwere Nebenwirkung aufgetreten sei, teilte das Unternehmen am Dienstagabend (Ortszeit) mit. Man prüfe nun, ob das Phänomen mit der Impfung in Verbindung stehe. Details wurden nicht genannt, AstraZeneca sprach lediglich von einer Routinemaßnahme wegen „einer potenziell ungeklärten Krankheit“. Der Impfstoffkandidat befand sich in der dritten und entscheidenden Testphase.
Über die Aussetzung der Studie hatte zuerst die Nachrichtenwebsite STAT berichtet. Erkrankt sei ein Proband im Vereinigten Königreich, hieß es. Ein Sprecher von AstraZeneca bestätigte später einen vorübergehenden Teststopp in den USA und anderen Ländern. Im August hatte der Pharmariese begonnen, 30.000 Probanden in Amerika für seine größte Studie an dem Impfstoffkandidaten zu rekrutieren. Getestet wird das von der Universität Oxford produzierte Vakzin auch an Tausenden Menschen in Großbritannien, kleinere Studien gibt es in Brasilien und Südafrika.
Groß angelegte letzte Testphasen laufen auch für zwei weitere Impfstoffkandidaten: einer wird vom Biotechnologieunternehmen Moderna in Massachusetts hergestellt, der andere von der Mainzer Biopharmafirma Biontech und dessen US-Partner Pfizer. Diese zwei Impfstoffaspiranten wirken anders als das Mittel von AstraZeneca.
Temporäre Teststopps bei großen klinischen Studien gelten nicht als ungewöhnlich. Untersuchungen von gravierenden oder unerwarteten Reaktionen auf die Verabreichung von Mitteln ist ein unerlässlicher Teil des Sicherheitsverfahrens. AstraZeneca wies im aktuellen Fall darauf hin, dass das medizinische Problem auch ein Zufall sein könne. Bei Studien mit Tausenden Probanden könnten alle möglichen Leiden auftreten. Man arbeite nun daran, die Prüfung des Einzelfalls zu beschleunigen, um mögliche Auswirkungen auf den Zeitplan der Studie zu mindern, teilte das Unternehmen weiter mit.
Viele offene Fragen
Es sei möglich, dass die ungeklärte Krankheit des Probanden ernst genug sei, um eine Klinikeinlieferung nötig zu machen, sagte die Wissenschaftlerin Deborah Fuller von der University of Washington. Wahrscheinlich lägen keine milden Nebenwirkungen wie Fieber oder Muskelschmerzen vor. Es gebe keinen Grund zum Alarmismus. Vielmehr sollte es beruhigen, dass das Unternehmen die Studie aussetze, um herauszufinden, was vor sich gehe. Das Vorgehen zeige, dass es die Gesundheit der Testteilnehmer umsichtig im Blick behalte.
Angela Rasmussen, Virologin an der Columbia University in New York, twitterte, dass die Krankheit womöglich nichts mit dem möglichen Impfstoff zu tun habe. Genau dies sei aber der Grund, „warum wir Studien machen, ehe wir einen Impfstoff für die Allgemeinheit verfügbar machen“.
Bei der dritten und letzten Testphase halten Experten nach jeglichen Anzeichen von Nebenwirkungen Ausschau, die bei den vorangegangenen Forschungen unentdeckt geblieben sein könnten. Aufgrund des Umfangs gelten diese Spätstudien als wichtigster Teil des Prozederes, in dem die Sicherheit des Präparats gewährleistet werden soll.
Erst am Dienstag hatten AstraZeneca und acht weitere Pharmakonzerne in einem ungewöhnlichen Schritt gemeinsam versprochen, sich bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus an die höchsten ethischen und wissenschaftlichen Standards zu halten. Hintergrund sind wohl Sorgen, dass US-Präsident Donald Trump die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA zur Zulassung eines Mittels zwingen könnte, ehe dessen Sicherheit und Wirksamkeit belegt ist.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen







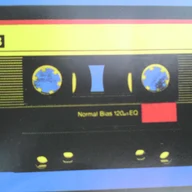

meistkommentiert