Frankreichs Justiz will Unabhängigkeit: Hartnäckige Untersuchungsrichter
Erst vor kurzen protestierten 127 Staatsanwälte öffentlich dagegen, dass sie sich den Weisungen des Justizministeriums unterzuordnen haben. Es scheint gewirkt zu haben.

PARIS taz | Der Chirac-Prozess könnte am Ende als Lehrstück für die Notwendigkeit der Gewaltentrennung in die französische Rechtsgeschichte eingehen. Dieses staatstheoretische Prinzip der Unterscheidung zwischen gesetzgeberischen und ausführenden Behörden und der Justiz beansprucht Frankreich als sein ureigenstes Kulturerbe.
Die Urheberschaft beansprucht man für Baron de Montesquieu, einen Vordenker der Aufklärung. Der müsste sich nach einer kurzen Inspektion des gegenwärtigen französischen Staatswesens und seiner Justiz beschämt im Grabe umdrehen.
Vom Ancien Régime der absoluten Monarchie hat nämlich die heutige Fünfte Republik ein zentralistisches System geerbt, bei dem sich die Staatsspitze, der vom Volk gewählte Präsident, seine Berater und seine Regierung, über die Regeln der demokratischen Vernunft und des republikanischen Anstands immer wieder hinwegsetzen.
Die dabei vorgeschobene Staatsräson hätte es auch gewollt, dass ein früherer Präsident und Gründer der heutigen Regierungspartei nicht vor Gericht gezerrt würde. Dazu hat zuerst Jacques Chirac selber alles getan, was in seiner Macht stand.
Nur aufgrund hartnäckiger Untersuchungsrichter (deren Funktion der jetzige Präsident Nicolas Sarkozy abschaffen will) kam es gegen den Willen der Hierarchie doch zum Prozess.
Wie danach die Pariser Staatsanwaltschaft zuerst die Einstellung aller Ermittlungen wünschte und anschließend entgegen jeder Verhandlungslogik einen Freispruch forderte, verdeutlichte die Probleme der Gewaltentrennung.
Es ist nämlich üblich und bekannt, dass das Justizministerium den Staatsanwälten ständig Weisungen erteilt. Grundsätzlich steht es diesen frei, die Direktiven zur Prozedur oder für ihre Plädoyers zu befolgen oder nicht.
Zumindest den auf ihre Karriere bedachten öffentlichen Anklägern aber ist der Wunsch der Staatsführung ein Befehl. Vor wenigen Tagen erst haben 127 Staatsanwälte in einer öffentlichen Stellungnahme gegen diese hierarchische Unterordnung protestiert.
Dass dies ausgerechnet im Chirac-Prozess zum Schluss nicht der Fall war, grenzt für die meisten Gerichtsbeobachter schon fast an ein Wunder oder eben eine bewusste Widerstandsaktion der Justiz, die auf ihre Autonomie pocht.
Eine Koalition, die was bewegt: taz.de und ihre Leser:innen
Unsere Community ermöglicht den freien Zugang für alle. Dies unterscheidet uns von anderen Nachrichtenseiten. Wir begreifen Journalismus nicht nur als Produkt, sondern auch als öffentliches Gut. Unsere Artikel sollen möglichst vielen Menschen zugutekommen. Mit unserer Berichterstattung versuchen wir das zu tun, was wir können: guten, engagierten Journalismus. Alle Schwerpunkte, Berichte und Hintergründe stellen wir dabei frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade jetzt müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Was uns noch unterscheidet: Unsere Leser:innen. Sie müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Es wäre ein schönes Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen




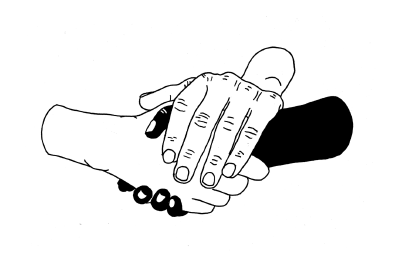
meistkommentiert
Habecks Rückzug
Quittung für den angepassten Wahlkampf
Die Grünen nach der Bundestagswahl
„Ja, pff!“
SPD in der Krise
Der schwere Weg zur Groko
Nach der Bundestagswahl
Jetzt kommt es auf den Kanzler an
Sieger des rassistischen Wahlkampfes
Rechte Parolen wirken – für die AfD
Wahlsieg der Union
Kann Merz auch Antifa?