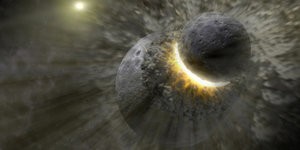Ausstellung „in progress“: Performance ist Kunst
Das Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) in Karlsruhe versucht sich an der Geschichte und Kunst der Performance mit einer Ausstellung „in progress“.

Kunst in Bewegung: „City Dance“, 1976-1979, ein Videostill von Anna Halprin. Bild: Buck OKelly/Anna Halprin
Performance ist Kunst. Eine flüchtige, situationsbezogene, ortsgebundene Kunst. Eine Kunst, bei deren Aufführung man dabei sein muss, sonst hat man sie verpasst. Natürlich kann man wie beim Tanz die „Choreografie“, den Handlungsablauf, die Anweisungen und Schritte aufschreiben, aber auch nur teilweise, denn manches passiert spontan.
Man kann fotografieren oder sie abfilmen. Aber die Atmosphäre kann man nicht einfangen, die immer neuen Reaktionen der Teilnehmer und Zuschauer. So wird oft eine Performance später zu einem mythischen Ereignis, als zum Beispiel Joseph Beuys in einer New Yorker Galerie mit einem Kojoten tanzte oder John Lennon und Yoko Ono im Bett lagen.
Dennoch: Performance ist Kunst, und Kunst wird gesammelt. Was gesammelt wird, muss auch eingefangen, konserviert, verkaufbar aufbereitet werden. Bei Bildern ist das einfach, bei alten Experimentalfilmen der sechziger und siebziger Jahre hat das Karlsruher Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) erfolgreich Ansätze entwickelt, diese zu restaurieren und mit Originalgeräten aufzuführen. Jetzt hat sich das ZKM der Performances angenommen.
Dabei besteht die erste theoretische Schwierigkeit schon darin, dass diese häufig kleinen Aktionen oft politisch gemeinte, manchmal auch poetische Eingriffe in das Alltagsleben oder den Kunstbetrieb waren. Dass sie sich auch vehement gegen die Institutionen gerichtet haben, Kunst wieder auf die Straße bringen wollten, gegen das Festfrieren der Kunst waren, gegen das Herausreißen aus dem alltäglichen Kontext. Dass sie die Flüchtigkeit, die verstreichende Zeit als konstituierendes Moment mitbenutzt haben.
Bewegungslose Museen
Deshalb sind sich die Museen noch nicht recht schlüssig, wie sie mit diesen Kunstwerken, die doch auf Bewegung, direkte Aktion und Reaktion angelegt sind, umgehen sollen. Einfach die Videos von Lennons und Onos „Bed-in“ abspielen? Die Fotos von Beuys an die Wand hängen? Das Karlsruher ZKM ist ja immer für eine Überraschung gut. Und hat deshalb seine Ausstellung „Moments. Eine Geschichte der Performance in 10 Akten“ erst einmal fast ohne Bilder eröffnet. Nur ein paar flache Bühnen sind aufgestellt, ein paar Leiterregale, zwei riesige Tische, ein paar Bildschirme und Beamer.
Die achtwöchige Ausstellung ist eine „in progress“, eine fantasievolle Erforschung von Neuem, mit Künstlerinnen, Kuratoren und Studenten zusammen. Und sie muss wirklich noch wachsen und Form annehmen. Bisher sind die „Ausstellungobjekte“ der zehn Künstlerinnen leider noch so unglücklich auf den Tischen verteilt, dass man sie nicht lesen kann: Briefe, Notizen, Videos, Fotos. Auf den Bildschirmen laufen Filme oder Diashows von Performances von Simone Fortis „Face Tunes“ (1967), Reinhild Hoffmanns „Bretter“ und „Steine“ (1980), Sanja Ivekovic’ „Inter Nos“ (1977).
Aber: Diese zehn Künstlerinnen wurden eingeladen, vor den Augen des Publikums ihre eigenen Exponate, Erinnerungen, Anleitungen zu präsentieren. So konnte man schon Künstlergespräche mit Graciela Carnevale und der Tanz- und Performance-Ikone Simone Forti führen, die auch einen zweistündigen Workshop leitete: Bewegungen ausprobieren, den Körper spüren, kurze, spontane und sich schnell verändernde Körperskulpturen bauen. Kommen werden noch Reinhild Hoffmann, Lynn Hershmann, Sanja Ivekovic, Channa Horwitz und Adrian Piper, die ein ganzes Seminar über „The connection between Truth and Goodness“ halten wird: „Exploring Kant’s Metaethics“.
Außerdem werden in einem Labor unter der Leitung des Choreografen Boris Charmatz, der in Rennes ein „Musée de la danse“ gegründet hat, Künstler und Wissenschaftler über die historischen Performances diskutieren, sie theoretisch oder künstlerisch neu interpretieren. Die israelische Künstlerin Ruti Sela wird dieses Labor wiederum mit der Kamera dokumentieren und den Film dann öffentlich bearbeiten und vorführen. Und das Publikum selbst und einige ausgewählte junge Künstler als „Zeugen“ werden den gesamten Prozess begleiten und darüber berichten. Darüber äußert sich das ZKM allerdings noch mehr als vage. Alle zwei Wochen geht die Ausstellung in eine neue Phase.
Mit diesem Ansatz will das ZKM auf die Probleme aufmerksam machen, die sich aus der Konservierung einer auch zeitlich definierten Kunst ergeben, aber auch aus den Wiederaufführungen und Wiedererschaffungen, den Re-Enactments unter ganz anderen politischen und musealen oder theatralischen Bedingungen. Ob es gelingt, wird man Ende April sehen.
Ohne Theorieansatz
Erstaunlich ist, dass es trotz dreijähriger Vorbereitung der Ausstellung noch nicht einmal einen Ansatz einer Theorie gibt, mit der das ZKM unter Peter Weibel, selbst ein Urgestein der performativen Kunst, sonst so freigiebig umgeht. Es heißt nur, dass „neue Formate und Methoden einer aktiven Darstellung von Performance-Geschichte im Museum“ erarbeitet werden sollen, „eine Wechselbewegung zwischen Geschichte, medialer Dokumentation und Neuinterpretation, zwischen Zeugenschaft und Erinnerung“.
Und das ist sehr dünn. Auch ein Katalog, in dem man solche theoretischen Überlegungen nachlesen könnte, erscheint erst nach Ende der Ausstellung, im Herbst. Was leider im ZKM üblich geworden ist, zum Leidwesen des interessierten Publikums.