Aufwachsen auf Otto Mühls Friedrichshof: Die Tage der Kommune
Kollektiv gelebte Sexualität statt traditioneller Familie. Der Dokumentarfilm „Meine keine Familie“ von Paul-Julien Robert erzählt von einer beschädigten Kindheit.

Revolutionen fressen ihre Kinder. „Meine keine Familie“, das autobiografisch-therapeutische Filmdebüt von Paul-Julien Robert, liefert viel Anschauungsmaterial für diesen Satz und die ihm eigene, bittere Dialektik.
Robert, 1979 geboren, hat am eigenen Leib erlebt, wie ein Versprechen auf Befreiung in Zwang und Gewalt umschlägt. Er wuchs auf dem Friedrichshof im österreichischen Burgenland auf, in der Kommune, als deren Häuptling sich der Aktionskünstler Otto Mühl feiern ließ. Von traditioneller Familie oder Zweierbeziehung hielten die Kommunarden nichts, dafür viel von kollektiv gelebter Sexualität, von Gruppensitzungen mit Tanz- und Psychodramadarbietungen und von der Idee einer Kunst, die sich aller Bereiche des Lebens bemächtigt.
Wenn der Regisseur diejenigen interviewt, die als Erwachsene auf dem Friedrichshof lebten, hat mehr als einer positive Erinnerungen. „Ich bin daran gewachsen, ich habe meine Persönlichkeit entwickeln können“, sagt Egon, einer der möglichen Väter von Paul-Julien Robert.
Die, die seinerzeit Kinder waren, hatten es schwerer, ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Sie erinnern sich vor der Kamera vor allem daran, sich verraten, allein und missbraucht gefühlt zu haben. Der Regisseur etwa musste erleben, wie seine Mutter nach Zürich ging, als er vier Jahre alt war; zu Besuch kam sie fortan nur selten, um ihn kümmerte sich das Kollektiv. Der Grund für die Abwesenheit war, dass Otto Mühl den Schweizer Kommunarden befahl, als Versicherungsvertreter zu arbeiten, damit die Kommune zu Geld kam. Widerrede war zwecklos.
Dabei hatte Robert noch Glück im Unglück. Denn als die Kommune 1991 aufgelöst wurde, war er zwölf Jahre alt. Wäre er zwei Jahre älter gewesen, er hätte an der sogenannten Einführung in die Sexualität teilnehmen müssen. Alle, die vierzehn wurden, mussten Sex haben, strikt heterosexuell die Mädchen mit Otto Mühl, die Jungen mit Mühls Frau Claudia. Otto und Claudia Mühl wurden deshalb später zu Haftstrafen verurteilt, sie für ein Jahr, er für sieben Jahre.
Missbrauch, der süchtig macht
Was so eine Erfahrung bedeutet, machen die Szenen anschaulich, in denen Paul-Julien Robert einen Mann besucht, der heute in seinen späten Dreißigern ist. Joan heißt er, er lebt im Brandenburgischen, auch er wuchs auf dem Friedrichshof auf, aber er hatte nicht das Glück, unter vierzehn zu sein. „Auch wenn es ein Missbrauch ist“, sagt er im Rückblick, „du wurdest ja fast süchtig danach.“ Weil es sonst im Alltag der Kommune keine Anerkennung gab, weil das Gefühl wahrgenommen, gemocht und geschätzt zu werden, sonst ausblieb. Noch heute, erzählt Joan, kämpft er dagegen an, dass er sich nur dann geliebt fühlt, wenn er Sex hat.
Je mehr Joan erzählt, umso perfider wirkt das Videomaterial, das Otto Mühl dabei zeigt, wie er Ende der 80er seine „Aschebilder“ anfertigt. Zu diesem Zeitpunkt ermittelte die Staatsanwaltschaft schon gegen ihn. Um Beweise zu vernichten, ließ er die Tagebücher von Kommunarden verbrennen. Die Asche wiederum ließ er auf Leinwände niedergehen.
Auf den zeitgenössischen Aufnahmen sieht man einen Mann, der sich berserkerhaft als Genie in Szene setzt, inmitten der Kommunarden, die ihm helfen, die großformatigen Leinwände aufzurichten. Der Kunstbetrieb hat sich erst spät mit dem Kontext von Mühls Werk beschäftigt; noch 2004 zum Beispiel feierte ihn eine Ausstellung im Wiener Museum für angewandte Kunst. Erst dem Wiener Leopold-Museum gelang es 2010, auf die problematischen Entstehungsbedingungen von Mühls Kunst hinzuweisen und in der Auswahl der Exponate Rücksicht auf die Kommunarden zu nehmen.
Eine Bilderbefragung
Der dokumentarische Wert der Archivbilder macht eine Stärke von „Meine keine Familie“ aus, auch wenn diese Bilder bisweilen etwas zu nahtlos zur Illustration der Inhalte eingesetzt werden, um die es zuvor in Gesprächssequenzen ging. Immer wieder ist Robert an der Seite seiner Mutter zu sehen, auf dem heutigen Friedrichshof, in einem kleinen Kinosaal, wo sie gemeinsam die Archivbilder schauen, oder beim Besuch der möglichen Väter.
Hinzu kommen Kamerafahrten an Fotografien entlang, zum Teil sind es Gruppen- oder Familienfotos, zum Teil Schwarzweißaufnahmen aus Publikationen der Kommune, dazu werden aus dem Off programmatische Texte gelesen: „Der Zweierbeziehung“, heißt es dann zum Beispiel, „verdanken wir Krebs, Armut und Reichtum, die Atombombe, Gartenzäune und Grenzen.“
Man kann in „Meine keine Familie“ auch so etwas wie den Versuch einer – wenn auch nicht systematischen – Bilderbefragung entdecken: Wie konstituieren Fotografien Gruppen, wie konstituieren sie Familien? Immer dann, wenn der Regisseur zu Besuch bei einem seiner potenziellen Väter ist, gibt es am Ende eine Art Familienaufstellung, eine photo opportunity, die festhält, was hätte sein können und nicht war.
Wo Robert seine Mutter mit seinen Sehnsüchten nach einer heilen Familie konfrontiert, nimmt der Film manchmal den Charakter einer peinlichen Befragung an. Er läuft in solchen Momenten Gefahr, sich in der Anklage gegen diese Mutter zu verlieren. „Ja, das sage ich immer“, sagt die Frau namens Florence am Anfang, „dass ich früher eine Kuh war, so ruhig und so dumm.“
Die Naivität der Mutter
Die Tragweite dieses Satzes erschließt sich nach und nach, in dem Maße, wie Robert vom Modus der Anklage absieht und zulässt, dass Hilflosigkeit und Naivität der Mutter zum Vorschein kommen. Damit entlastet er sie nicht, aber er schützt sich doch vor dem selbstgerechten Furor, den manche Kinder von 68er Eltern an den Tag legen.
Zumal der Film zarte Hinweise darauf gibt, dass die Sehnsucht nach der intakten Kleinfamilie eine Kehrseite hat. Dies gilt besonders für die Szenen, in denen Robert und seine Mutter in die Haute Savoie fahren. Dort, im ländlich-bergigen Osten Frankreichs, lebt die Familie des Mannes, der offiziell als Roberts Vater gilt, weil die Mutter mit ihm verheiratet war, als der Sohn zur Welt kam. Diesen Christian sehen wir auf Archivbildern, wie er tanzt und keck die Hüfte schwingt, ein Hütchen schräg auf dem Kopf. Aus dem Off kommt Roberts Stimme: „Das war Christians letzte Selbstdarstellung. Drei Tage später nimmt er sich das Leben.“
In der sommerlichen Idylle der Haute Savoie beginnen die Schwestern Christians, heute in ihren späten 50ern, frühen 60ern, zu erzählen, wie streng der Vater mit seinen Söhnen war, sie reden von körperlichen Züchtigungen und – sie sind sich nicht ganz sicher – von sexueller Gewalt in der Klosterschule. Nicht nur die Kommune, auch ein katholisch-bäuerliches Milieu malträtiert Kinder. Und so wie Florence nicht viel zu dem zu sagen hat, was sie damals auf dem Friedrichshof geschehen ließ, so verstummt auch der alte Mann aus der Haute Savoie, der Vater Christians, wenn es um die Klosterschule geht.
Sadismus und Contest
Aufnahmen wie die des tanzenden Christian sind in „Meine keine Familie“ immer wieder zu sehen, da diese Performances – sie wurden als „Selbstdarstellung“ bezeichnet – zum Alltag der Kommune gehörten. In einem dieser Ausschnitte weigert sich ein Junge zu singen, er ist vielleicht acht Jahre alt, er weint, Mühl macht ihn zur Schnecke, droht und begießt ihn schließlich mit Wasser. Dutzende Erwachsene schauen sich das an und tun nichts. Niemand tröstet den Jungen, als er von Mühl ins Bett geschickt wird und zwischen den Kommunarden abgeht.
Diese Bilder sind wegen des unverhohlenen Sadismus von Otto Mühl schwer zu ertragen und auch, weil niemand dem Kind zur Hilfe kommt, weil niemand einschreitet. Die, die sich der Kommune anschließen, weil sie, wie sie heute sagen, den autoritären Strukturen ihrer Familien, ihrer Erziehung entkommen, weil sie den Residuen des Nationalsozialismus entfliehen wollten, binden sich ohne Not in eine hochgradig autoritäre Struktur ein.
„Meine keine Familie“. Regie: Paul-Julien Robert. Dokumentarfilm, Österreich 2012, 93 Min.
Es gibt aber noch etwas: Die Selbstdarstellungen der einzelnen Kommunarden, die Mühl kommentiert, lobt oder verwirft – „Mehr Ekstase! Mehr Ekstase!“ ruft er einmal, in einer anderen Szene bewertet er die Kleidung von Vier- bis Siebenjährigen –, diese Selbstdarstellungen sind alles andere als Irrläufer, die ein guter Geist so in der Vergangenheit eingesperrt hätte, dass sie für immer verschwunden wären. Sie kehren vielmehr in den Casting- und Contest-Shows unserer Gegenwart zurück. Otto Mühl, der Zampano vom Friedrichshof, ein Vorläufer der Dieter Bohlens und Heidi Klums? Es sieht ganz so aus. Wie bitter die Dialektik von Befreiung und Zwang ist, beginnt man gerade erst zu ahnen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





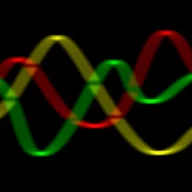
meistkommentiert
Wehrpflicht-Debatte
Pflicht zu „Freiheitsdienst“
Immer mehr Kirchenaustritte
Die Schäfchen laufen ihnen in Scharen davon
Rechtsextreme Symbolik
Die Lieblingsblumen der AfD
Debatte über ein Jahr Cannabisgesetz
Einmal tief einatmen, bitte
Trumps Gerede über eine dritte Amtszeit
Zerstörung als Strategie
Klaus Wowereit wird Kulturstaatsminister
Ein guter Move?