Aufräumarbeiten in Japan: Der gute Mann von Fukushima
Kurze Zeit waren die Atomsamariter von Fukushima in aller Munde. Heute herrscht Schweigen rund um die Reaktorruine. Ausgerechnet ein Arbeiter der Mafia spricht jetzt.

FUKUSHIMA taz | Es ist spät geworden, abends in einer Karaoke-Bar in Fukushima. Ihsaka schläft. Er hat viel getrunken, erst Bier, dann Sake. Jetzt liegt er zusammengerollt auf einem blauen Plüschsofa. Die langen grauen Haare bedecken das hagere Gesicht. Er trägt einen Hanten, eine altmodische japanische Winterjacke, und Zori, die traditionellen Holzsandalen. Vor ihm stehen Gläser, eine Flasche für den Sake und eine kaum berührte Schale mit Pommes frites. Tonlos läuft der Fernsehapparat.
Wenn man jetzt neue Codes für weitere Lieder eingäbe, würden wieder die alten Lieder aus den 50er und 60er Jahren erklingen, die Ihsaka so liebt. Er kennt sie auswendig. Sie handeln von Bruderliebe und Gerechtigkeit, von den populären Träumereien der japanischen Mafia. Ihsaka hat den ganzen Abend gesungen, dann haben ihn Müdigkeit und Alkohol überwältigt.
"Ich bin ein Yakuza", hat Ihsaka im Laufe des Abends gesagt. Yakuza - das sind Mafiosi, Leute aus dem zum Teil kriminellen, zum Teil sozial integrierten japanischen Gangstermilieu. Normalerweise verschweigen die Yakuza ihre Herkunft, aber Ihsaka verschweigt nur seinen Vornamen.
In der Präfektur Fukushima hängen überall Plakate, die vor Geschäften mit der Yakuza warnen. Die Mafia ist als Arbeitsvermittler stets dabei, wenn in Japan Großaufträge für die Bauindustrie erteilt werden - wie jetzt beim Wiederaufbau in der Region. Erst kürzlich beschrieb der Journalist Tomohiko Suzuki in einem Buch, wie die Yakuza im vergangenen Sommer auch Arbeiter für die Aufräumarbeiten auf dem zerstörten Reaktorgelände vermittelte. Dabei streitet Japan auch über die Yakuza - neulich musste ein Fernsehmoderator seine Show aufgeben, weil er Verbindungen zur Mafia hatte. (gbl)
Er ist ein Sonderfall, denn er befindet sich auf einer Mission. "Was ich tue, ist ein winziger Beitrag", sagt er nach vielen Gläsern Sake. "Aber wenn meine Arbeit nicht getan wird, werden nie wieder Kinder in Fukushima spielen können." Im Gegensatz zu anderen ist er freiwillig nach Fukushima gekommen. Ihsaka ist eine Art Atomsamariter.
Treffpunkt J-Village
Seit dem vergangenen Sommer arbeitet er an vier Tagen pro Woche auf dem verseuchten AKW-Gelände von Fukushima. Er wohnt in einer Touristenherberge eine Fahrtstunde südlich davon. Eigentlich ein Luxusquartier, aber er teilt das Zimmer mit drei Kollegen. Ihsaka misshagt diese Enge. Deshalb ist er froh, wenn er einen Abend in der Karaoke-Bar verbringen kann.
In dem Ferienort Yuzawa-onsen in der Präfektur Fukushima haben die AKW-Arbeiter als Gäste die Touristen ersetzt, die nicht mehr kommen. An Arbeitstagen steht Ihsaka morgens um fünf Uhr auf. Dann bringt ein Kleinbus der Yakuza ihn und seine Kollegen bis zum J-Village. Das J-Village war das Trainingsgelände der japanischen Frauen-Fußballnationalmannschaft, die die Weltmeisterschaft in Deutschland gewann. Heute ist es die Kommandozentrale für die Rettungs- und Reparaturarbeiten an den zerstörten Reaktoren. 5.000 Leute arbeiten im J-Village und auf dem 20 Kilometer weiter entfernten Reaktorgelände.
Ihsakas Kleinbus hält auf einem riesigen Parkplatz neben Hunderten von anderen Bussen, hinter deren Windschutzscheiben Schilder der großen Firmen stecken: Mitsubishi, Toshiba, Hitachi. Die ganze Japan AG räumt jetzt mit auf, und die Busse bringen die Firmenmitarbeiter vor Ort. Doch zur Japan AG gehört auch die Yakuza. Keines der über 50 Atomkraftwerke im Land wurde ohne sie gebaut. Denn die Mafiabanden monopolisieren seit Jahrzehnten das Vermittlungsgeschäft für Tagelöhner auf Großbaustellen.
Dabei müssen die von der Mafia gestellten Arbeiter die niedrigsten und meist auch gefährlichsten Arbeiten verrichten. Passiert dann ein Unfall, kaschiert dann das Gangsternetzwerk die Folgen. Umso mehr wird die Yakuza jetzt in Fukushima gebraucht. Erkrankt einer ihrer Arbeiter später an Krebs, der von radioaktiver Strahlung ausgelöst wurde, werden Nachforschungen erfolglos sein. Dennoch gibt es Arbeitsverträge. Im Prinzip also ein legales Geschäft.
Ihsaka zählt zu einer Arbeitsgruppe von acht Männern. Ihr Tageslohn liegt mit umgerechnet 150 Euro etwas höher als auf normalen Baustellen. Sie sammeln sich auf dem Parkplatz, betreten die Sperrzone jenseits des J-Village und werden von dort zum Reaktorgelände gefahren. Ihre Aufgabe besteht darin, Gebäude, Rohre und Ruinen zu reinigen - alles, was von den kaputten Reaktoren noch stehen geblieben ist. Ihsakas Kollegen sind weniger freiwillig dabei: Die meisten von ihnen haben Schulden bei den Kredithaien der Mafia und müssen deshalb jede Arbeit annehmen, die ihnen die Gangster vermitteln.
Arbeiten ohne Schutzanzug
Kein Außenstehender darf die Arbeiter auf dem Reaktorgelände begleiten. Journalisten konnten bisher nur in Gruppen unter genauer Anweisung des AKW-Betreibers Tepco den Katastrophenort besichtigen. Ihsaka aber ist viermal die Woche vor Ort und kann davon erzählen.
Normalerweise tragen er und seine Kollegen schwere Schutzkleidung und einen Dosimeter bei der Arbeit. "Wir sollen Anzüge und Masken tragen, aber das tun wir nicht immer", sagt Ihsaka. Jetzt im Winter stört die Kleidung nicht mehr so. Aber noch vor ein paar Monaten, im Spätsommer, als Ihsakas Gruppe Schutt und Geröll von den Reaktorruinen abtrug, behinderte sie die Arbeiter beim Heben schwerer Gegenstände. Zudem schwitzten die Arbeiter. "Damals sah ich oft die Tattoos meiner Kollegen", sagt Ihsaka. Sie arbeiteten dann ohne Oberbekleidung neben den strahlenden Reaktoren. Ihsaka erinnert sich, dass niemand ihn anlernte, wie man sich am besten im Schutzanzug bewegt.
Bis heute passen die acht Männer von Ihsakas Team auf, dass jeder von ihnen am Ende eines Arbeitstages die gleiche Strahlenanzeige auf dem Dosimeter hat. "Wenn ich 1,1 Millisievert abbekomme und der Kollege nur 0,9 Millisievert, tauschen wir nach einer Weile die Arbeitspositionen", sagt Ihsaka. Dabei leitet die Männer nicht so sehr die Furcht vor einer höheren Strahlendosis als die Sorge um die Arbeit am nächsten Tag. Denn wer zu viel Strahlen abbekommt, wird für die Arbeit am nächsten Tag aussortiert - und erhält keinen Lohn.
Bei 100 Millisievert liegt die Obergrenze für die Strahlendosis, der ein AKW-Arbeiter in Japan pro Jahr ausgesetzt werden darf. Ihsaka hat bisher seit Juli laut seinen Arbeitsdokumenten 70 Millisievert akkumuliert. Noch kann er weiterarbeiten. Wie groß die Gefahr für ihn wirklich ist, will er nicht wissen. "Natürlich bin ich deren Versuchskaninchen", sagt er. Aber das scheint ihn nicht zu stören.
Ihsaka hat seine eigenen Gründe, das Strahlenrisiko auf sich zu nehmen. Bis zum letzten Sommer arbeitete er 29 Jahre lang als Koch in Tokio. Er war kein aktiver Yakuza, gehörte zum Milieu. Deshalb aber verließ ihn seine Frau. Bei ihm blieb nur seine erwachsene Tochter, die sich um ihn kümmerte, als er vor einem Jahr an einer schweren Lungenentzündung erkrankte.
Er war tagelang bewusstlos, doch die Tochter blieb an seinem Bett. "Ich wurde gerettet, nun bin ich hier, um das Leben der Kinder von Fukushima zu retten. Dafür will ich meiner Tochter in Erinnerung bleiben", sagt Ihsaka. Eigentlich wollte er in Fukushima als Koch für die Evakuierten arbeiten. Aber dann fand er über seine Kontakte zur Mafia den Job auf dem Reaktorgelände.
Diese Geheimnistuerei
Ihsaka hat weder studiert noch je eine Ausbildung erhalten. Auch das Kochen brachte er sich selbst bei. Aber er ist ein nachdenklicher Mensch. Von sich aus spricht er an dem Abend in der Karaoke-Bar über Hiroshima und Nagasaki. Das tun ganz wenige Japaner im Zusammenhang mit Fukushima. Ihsaka besinnt sich, dass die Amerikaner nach den Atombombenabwürfen alles unternahmen, um die Folgen der radioaktiven Strahlung geheim zu halten.
Tatsächlich wurden sämtliche Untersuchungen des berühmten amerikanischen Strahlenkrankenhauses in Hiroshima über Jahrzehnte unter Verschluss gehalten. "Die gleiche Geheimnistuerei betreiben wir Japaner heute nach Fukushima", sagt er.
Auch deshalb spricht er an diesem Abend so viel. Er will keine Geheimnisse mehr. Zwar musste er vor Antritt seiner Arbeit eine Erklärung unterschreiben, dass er den Medien nichts von seiner Tätigkeit berichtet. Doch nun bricht er bewusst die Regel. "Ich würde der Welt gern alles erzählen", sagt er.
Nach Eintreten der Reaktorkatastrophe galten AKW-Arbeiter wie er für einen Moment in der Öffentlichkeit als Helden. Doch sie erlangten nicht annähernd den Ruhm wie etwa die New Yorker Feuerwehrmänner nach den Attentaten auf die Twin Towers. Dabei ist Ihsaka ein echter Überzeugungstäter und ein dankbarer Interviewpartner. Dennoch gibt es bis auf ein paar allgemeine Berichte der New York Times über die Arbeitsbedingungen der AKW-Arbeiter bisher kaum Geschichten über die Helden von Fukushima. Sind sie der Erzählung nicht wert?
Je länger Ihsaka in der Karaoke-Bar redet, desto mehr begreift er, wie aufsehenerregend seine Geschichte ist. Die Fragen des Reporters machen ihn stutzig. Warum fragt dieser nach den Farben und Motiven von den Tattoos seiner Kollegen? Ihsaka erreicht immer wieder einen Punkt, an dem er nicht mehr antwortet.
Er würde gern erzählen, aber er müsse auch an seine Unterschrift für die Betreiberfirma Tepco denken, rechtfertigt er sich. Vor die Kamera würde er nie treten. Aber am nächsten Tag verabredet er sich noch einmal in einer Nudelbar mit dem Reporter. "Ich bin einsam", grüßt er. "Ich vermisse das Reden."
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





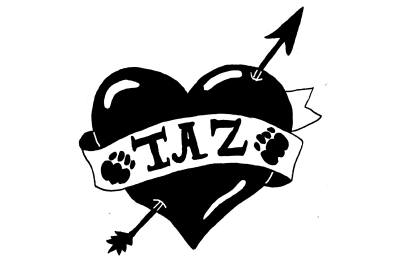
meistkommentiert
+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++
Moskau fordert für Frieden vollständigen Gebietsabtritt
Sozialwissenschaftlerin zur Spargelernte
„Er sagte: ‚Nirgendwo war es so schlimm wie in Deutschland‘“
„Friedensplan“ der US-Regierung
Putin wird belohnt, die Ukraine aufgegeben
Mindestlohn
Die SPD eiert herum
Kontroverse um Gedenkveranstaltungen
Ein Kranz von Kretschmer, einer von Putin
Tödlicher Polizeieinsatz in Oldenburg
Drei Schüsse von hinten