Essays von Jochen Schimmang: Dissidenz des Schweigens
Jochen Schimmang schätzt die Freiheit, seine Meinung für sich zu behalten. Jetzt sind neue Essays erschienen: „Abschied von den Diskursteilnehmern“.

Das Versteck wird hier zum idealen Ort für Schriftsteller: Jochen Schimmang Foto: Karin Eickenberg
Neben Romanen und Erzählungen widmet sich Jochen Schimmang immer mal wieder dem „Essai“ – zur poetologischen und auch gesellschaftspolitischen Standortbestimmung. Die Schreibweise ist bei ihm keine geschmäcklerische Marotte, sondern markiert die Schule, die ihn schriftstellerisch offenbar am meisten geprägt hat.
Es ist die französische Tradition des gelehrten Umherschweifens, des asystematischen, flaneurhaften, auch das scheinbar banale und biografische Detail in den Blick nehmende Schreiben, das sich zwischen Erzählung und Reflexion nicht entscheiden mag.
„Geländegänge“ ist seine Privatterminologie für solche Texte. Er folgt darin der Methode seines Hausheiligen Roland Barthes, der die Wissenschaft immer wieder literarisch hinter sich gelassen hat. Das kann man auch von Schimmang sagen. Er referiert und zitiert akkurat, hat seinen Büchner, Freud, Foucault parat, aber anstelle einer sachgemäßen Analyse lässt er lieber seiner aphoristische Fantasie freien Lauf und kommt dabei in zwei, drei Gedankensprüngen vom Kleinsten auf das große Ganze.
Etwa wenn er den Internationalismus seiner Generation, der 68er, geradezu als sozialpsychologische Strategie deutet, sich nicht mit der „Aufarbeitung“ der deutschen Vergangenheit beschäftigen zu müssen, und das unselige Demo-Spruchband „USA – SA – SS“ als genialen Transferversuch liest, die deutsche Schuld durch die Kriegsverbrechen der USA in Vietnam zu tilgen: „nicht der Pappi war’s (mochte er auch in der SA gewesen sein und sein Kollege in der Stadtverwaltung sogar in der SS), sondern der böse (Jude) Kissinger.“
Oder wenn er die „Talkshow genannten Debattierklubs im Fernsehen“ in den Blick nimmt und die Gefahr der hier vorgeführten Meinungsfreude bemerkt, wenn sie sich nämlich diktatorisch gebärdet und dem Gegenüber eine Positionierung abnötigt. „Niemand,muss' aber eine Meinung haben“, hält er dem entgegen, „und das Recht auf Meinungsfreiheit wird nicht dadurch gefährdet, dass jemand davon keinen Gebrauch macht.“ Umgekehrt wird ein Schuh draus.
In Anlehnung an Barthes gehört für ihn der Bekenntniszwang zum faschistischen Komplex, „denn Faschismus“, zitiert er Barthes Antrittsvorlesung am Collège de France, „heißt nicht am Sagen hindern“, sondern „zum Sagen zwingen“. Freiheit ist für Schimmang also zunächst einmal die Freiheit, mit seiner Meinung auch hinter den Berg halten zu dürfen.
Sein Interesse an der Dissidenz des Schweigens hängt auch zusammen mit seinem ambivalenten Verhältnis zur Öffentlichkeit, das er gleich in mehreren Prosastücken skizziert. Als soziales Wesen braucht er die Gemeinschaft.
Allerdings kennt er auch die „Schrecken der Geselligkeit“, das Fremdeln in einer größeren Gruppe, wenn er sich dort exponieren muss, und die Ermüdung, die ihn stets überfällt, wenn er sich zusammenreißt und um geistvolle Konversation bemüht. Diese psychische Konstitution gehört vermutlich zum gar nicht so seltenen Phänotyp des Schriftstellers, der auch deshalb Texte produziert, weil sie ihm Öffentlichkeit erlauben, ohne sich ihr direkt aussetzen zu müssen.
Museen, Bibliotheken, Hotels – Stützpunkte, von denen aus man die Dinge besser sieht
Eine andere Konsequenz daraus ist seine Faszination für „Verstecke“. Schon in „Grenzen Ränder Niemandsländer“, dem ersten Band mit „Geländegängen“, sind diese Rückzugsräume mitten in der Welt, zu denen auch öffentliche Einrichtungen wie das Museum, die Bibliothek, der Flughafen oder das Hotelzimmer gehören können, seine immer wieder illuminierten Sehnsuchtsorte.
In seinem neuen Buch „Abschied von den Diskursteilnehmern“ beschreibt er sie als „Stützpunkte, von denen aus man die Dinge unter Umständen besser sieht“, und als „besondere Eingangspforten in die laufenden Diskurse“. Sie ermöglichen einen anderen Zugang, der Phänomene bemerkt, die sonst womöglich unausgesprochen blieben. Das Versteck wird hier zum idealen Ort für Schriftsteller.
Das Erfreuliche an Schimmangs neuen, immer wieder luziden und elegant formulierten „Geländegängen“ ist: Man kann Spaß an ihnen haben, ohne ihm unbedingt zustimmen zu müssen. Und man kann anderer Meinung sein, ohne es ihm besonders übel zu nehmen. Das liegt an der Konzilianz, die er Meinungsäußerungen grundsätzlich entgegenbringt, auch seinen eigenen. Das bekannte Duldsamkeits-Gebot von H. G. Wells, „Die Welt ist groß genug, dass wir beide darin Unrecht haben können“, scheint hier stets mitzuschwingen.
Zumal er sich längst auf verlorenen Posten befindet, der Titel des Buches macht daraus keinen Hehl. Schimmangs Welt verschwindet schneller als er selbst, seine Ansichten und Meinungen werden langsam obsolet, weil die Erfahrungswirklichkeit der meisten „Diskursteilnehmer“ mittlerweile anders aussieht.
Die daraus resultierenden „Ängste und Orientierungsschwierigkeiten“ machen aus ihm aber keinen wütenden, alten Mann, der verbal um sich schlägt. Man hat eher den Eindruck, dass er einfach nur ein weiteres Versteck gefunden hat, das es ihm erlaubt, andere Dinge oder die Dinge etwas anders zu sehen.





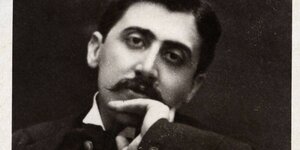

Leser*innenkommentare
Sikasuu
Man kann Spaß an ihnen haben, ohne ihm unbedingt zustimmen zu müssen. Und man kann anderer Meinung sein, ohne es ihm besonders übel zu nehmen.
----
Sollten wir uns alle in 8pkt Pica hinter den, ne besser AUF den Spiegel kleben.
Warum? Weil DAS eine leider schon lange abhandengekommene, vergessene "Weisheit" ist. Den lau schreien, allen die "eigene Meinung" & sei sie noch so abstrus, vor die Füse zu "kotzen", scheint heute "lifstyle" zu sein!
Danke für den Tipp, Frank!!
Ps. Kommt auf die "to-do-liste" in der Abteilung "Unbedingt mal lesen"!!
Lowandorder
@Sikasuu & btw gleich nochn paar Kästchen frei für 🐦🔥 & unne so!;)
Willi Müller alias Jupp Schmitz
Einkaufsliste, siehe 2019 - Adorno wohnt ...
Lowandorder
Schön. Der schöne Vogel Phönix 🐦🔥 schüttelt wieder seine Federn.
Immer gern genommen! Woll