Amnestiegesetz in El Salvador: Ende der Straflosigkeit
Seit 1993 schützte eine Amnestie Kriegsverbrecher des Bürgerkrieges. Das ist jetzt vorbei. Doch es gibt Kritik an der Entscheidung.

23 Jahre lang waren die Kriegsverbrecher des Bürgerkriegs in El Salvador (1980 bis 1992) vor Strafverfolgung geschützt. Jetzt ist Schluss damit. Am Mittwoch urteilte der oberste Gerichtshof in der Hauptstadt San Salvador, die Generalamnestie von 1993 sei verfassungswidrig. Sie verstoße gegen mehrere Verfassungsartikel und gegen internationales Recht. „Eine Amnestie widerspricht dem Recht auf Zugang zu Gerechtigkeit, dem Schutz fundamentaler Rechte und dem Recht auf umfassende Entschädigung der Opfer von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen“, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts.
Das Gericht stellte klar, dass nicht nur die materiellen Täter von Kriegsverbrechen belangt werden können, sondern auch „die höchsten Befehlshaber der militärischen und paramilitärischen Strukturen und der Guerilla“. Das Verfahren war vor drei Jahren vom Menschenrechtsinstitut der Zentralamerikanischen Universität von San Salvador (UCA) und zwei juristischen Forschungszentren angestrengt worden.
Kriegsverbrechen wie das Massaker in dem Dorf El Mozote, bei dem die Armee Ende 1981 rund tausend Zivilisten ermordete, können jetzt genauso von der Staatsanwaltschaft verfolgt werden wie das Massaker einer Eliteeinheit der Armee an der Führungsriege der UCA im November 1989 oder interne Säuberungen in den Reihen der FMLN-Guerilla, bei denen Mitte der 1980er Jahre in der Provinz San Vicente mehrere Hundert Menschen ermordet wurden.
Der Bericht einer von der UNO eingesetzten Wahrheitskommission listet über 22.000 Kriegsverbrechen auf. 95 Prozent davon werden der Armee, anderen staatlichen Sicherheitskräften und den von ihnen kontrollierten Todesschwadronen angelastet, 5 Prozent der FMLN. Fünf Tage nach der Veröffentlichung hat das damals von rechten Parteien dominierte Parlament am 20. März 1993 die Generalamnestie verabschiedet.
Ähnlich wie in Guatemala, wo seit fünf Jahren die höchsten Kriegsverbrecher des dortigen Bürgerkriegs (1960 bis 1996) vor Gericht gestellt werden, ist auch dieses Urteil Ergebnis eines langsamen Wandels der juristischen Kultur. Lange waren die obersten Richter willfährige Handlanger rechter Regierungen. Seit 2009 aber stellt die FMLN den Präsidenten, die Besetzung der obersten Gerichte muss im Parlament ausgehandelt werden. Auf diese Art kamen Kammern zustande, deren Mitglieder gewillt sind, ihren Beruf auch wirklich auszuüben.
Verteidigungsminister General David Munguía Payés nannte das Urteil einen „politischen Fehler“ und befürchtet „den Beginn einer Hexenjagd“. Vertreter der FMLN und der rechten Oppositionspartei Arena enthielten sich eines Kommentars. Sie wollen das Urteil erst einmal studieren.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
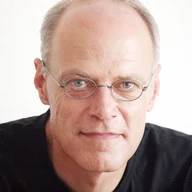




Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!