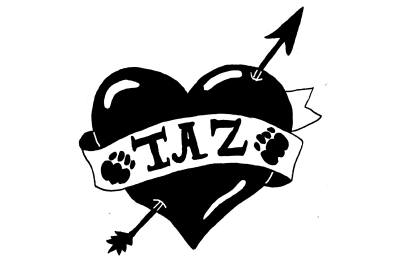: Hektische Aktivität im Wendebecken
■ Um Finanzierungsprobleme zu vermeiden, sollen sich alternative Wohnbau-Kleingenossenschaften zusammenschließen und in den Genuß einer maßgeschneiderten Förderung kommen. Von Marco Carini
Wie geht es weiter mit Hamburgs alternativen Wohnbaugenossenschaften? Weil die Wohnungsbaukreditanstalt (WK) die Finanzierung genossenschaftlicher Wohnprojekte blockiert, die staatlichen Förderrichtlinien nur auf Single-Haushalte und Kleinfamilien, nicht aber auf wohngemeinschaftstaugliche Neubauten ausgerichtet sind, droht vielen Projekten das Aus im Behördenlabyrinth. Um das zu verhindern, herrscht hinter den Kulissen von Baubehörde und SPD, aber auch bei den Wohnprojekten derzeit hektische Aktivität. Das Ziel: ein Konzept, das die Zukunft der Kleingenossenschaften langfristig sichert.
Um den Traum vom gemeinsamen und selbstbestimmten Zusammenleben zu verwirklichen, haben sich in den vergangenen Jahren immer mehr einkommenschwächere HamburgerInnen zu alternativen Wohnbaugenossenschaften zusammengeschlossen, planen Neubauprojekte im sozialen Wohnungsbau. „Olga Rabiata“ in Ottensen, „Wendebecken“ in Barmbek, „Brachvogel“ in Lurup und viele andere. Dazu müssen die Projekte 15 Prozent Eigenkapital aufbringen, fast den gesamten Rest streckt, wie bei anderen Sozialwohnungsneubauten auch, die WK vor.
Doch den WK-Verantwortlichen sind die alternativen Wohnbauprojekte suspekt. Nach ihrer Auffassung verbergen sich hinter ihnen nur „Abkocher, die ihren Traum vom eigenen Heim zum Sozialtarif verwirklichen wollen“. Da die neugegründeten Alternativ-Genossenschaften in der Regel über keine stillen Reserven verfügen, macht die finanzierungsunwillige WK die Projektfinanzierung seit kurzem davon abhängig, daß die Baubehörde Bürgschaften über fast 50 Prozent der Kreditsumme für jedes Wohnmodell übernimmt.
Im Frühjahr verpflichtete sich die Behörde erstmals zu einer 2,4 Millionen Mark-Bürgschaft für die Wohnprojekte „Ottensener Dreieck“ und „Hausarbeit“. Für weitere Bürgschaften aber fehlt in diesem Jahr das Geld. Im Haushaltsjahr 1994 wollte die Wagner-Behörde nun für insgesamt 13,2 Millionen bürgen dürfen, doch der Rotstift des Finanzsenators strich die Summe auf gut acht Millionen zusammen. Das aber reicht nur für zwei, höchstens drei Bürgschaften. Die Folge: Bau-Stau bei den Kleingenossenschaften, trotz dringenden Wohnungsneubaubedarfs.
Eine Lösung dieser Misere könnte ein Gutachten aufzeigen, das die Baubehörde Ende vergangenen Jahres an den Kopf der Berliner Unternehmensberatungsgesellschaft „Learning by Doing“ (LBD), Gert Behrens vergab. Behrens soll Finanzierungs- und Organisationsmodelle für die Kleingenossenschaften entwickeln.
Die Idee dabei ist, so geht aus einem Schreiben des Leiters der Präsidialabteilung der Baubehörde, Karl Schwinke, hervor, der Beitritt der Genossenschaften „zu einer Dachorganisation, die als gemeinsamer Bauherr, Service- und Betreungsunternehmen fungiert“. Doch damit eine solche Dachgenossenschaft die von der WK gefordertenSicherheiten vorweisen kann, müßten auch Genossenschaften dem neuen Träger beitreten, die bereits über erheblichen Grund- und Wohnungsbesitz verfügen.
Da etablierte Genossenschaften, wie etwa die Schiffszimmereigenossenschaft, für ein solches Projekt kaum zu haben sein dürften, erfüllen wohl nur die ehemalige Neue-Heimat-Siedlung „Farmsen-Gartenstadt“ und die städtische Fritz-Schuhmacher-Siedlung in Langenhorn, die heute von Mietergenossenschaften selbstverwaltet werden, diese Voraussetzungen. Doch der Konflikt bei einer solchen Lösung ist programmiert: Die Finanzbehörde dürfte wenig geneigt sein, diese in ihrem Besitz befindlichen Grundstücksflächen in eine Alternativ-Genossenschaft zu überführen. Diese wiederum könnte den Preis dafür kaum zahlen. Doch selbst wenn solche Hürden übersprungen werden könnten, wäre diese neue Genossenschafts-Holding unter starker staatlicher Kontrolle, müßten die Einzelprojekte um ihre Autonomie fürchten.
Schwinkes zweite Variante: Die neuen Kleingenossenschaften könnten „sich der Wohnungsbaugenossenschaft Schanze e. G. anschließen“. Doch bei diesem Modell bleibt fraglich, ob der geringe Wohnungsbestand der Schanze-Genossenschaft den WK-PrüferInnen als Kreditsicherheit für die diversen Neubauvorhaben der Kleingenossenschaften ausreicht.
Auch innerhalb der Hamburger Sozialdemokratie wird über die Zukunft der Kleingenossenschaften nachgedacht. Immerhin hat sie deren Förderung in ihr Regierungsprogramm ausdrücklich aufgenommen. In den internen SPD-Zirkeln kursiert derzeit ein „Papier zur Förderung genossenschaftlicher Wohnprojekte“, das dem Dunstkreis der linken SPD-Wohnungspolitiker um den Bürgerschaftsabgeordneten Günter Mertens und den Chef der „Hamburger Wohn-Consult“ (HWC) Michael Sachs zugeschrieben wird.
Darin wird neben einer zentralen Dachorganisation für die Kleingenossenschaften vor allem ein spezielles „Förderungsprogramm für genossenschaftliche Wohnprojekte“ vorgeschlagen, das auf die spezifischen Bedürfnissedieser Wohnprojekte zugeschnitten ist. Darin soll auch geregelt werden, daß spätere Genossenschaftsgewinne wieder in neue Wohnbauprojekte und nicht in private Taschen fließen.
Politischer Hintergedanke der maßgeschneiderten Förderung: die Anbindung der Alternativprojekte an dieSPD. So stellt das Papier fest, daß durch die bisherige Förderung genossenschaftlicher Einzelprojekte „ein erheblicher Befriedigungseffekt in einem der SPD und dem Senat eher kritisch gegenüberstehenden Teil der Gesellschaft erreicht werden konnte, den es nachhaltig zu verstärken gilt“.
Auch die Wohngenossenschaften, die sich 1991 in einem Neubauplenum zusammengeschlossen haben, haben eigene Zukunfts-Vorstellungen entwickelt. Da die in der SPD-Regierungserklärung ausdrücklich festgeschriebene staatliche Förderung von Kleingenossenschaften nur über „Ausnahmeregelungen und die Verbiegung der geltenden Förderrichtlinien“ möglich sei, müsse eine „Regelförderung für Wohnprojekte“ her.
Die Kleingenossenschaften fordern, künftig „in allen Bebauungsplänen Flächen für Wohnprojekte“ vorzusehen und bei der Vergabe städtischer Grundstücke „Kontingente an Wohnprojekte vergeben werden“. Um eine „soziale Durchmischung“ der Projekte zu erreichen, müßten hier „auch Besserverdienende eine Einzugsberechtigung erhalten können, die dann über höhere Mieten die finanziell schlechter gestellten in ihren Mietzahlungen unterstützen“.
Die Wohnungsgrößen und Grundrisse dürften sich nicht ausschließlich nach den Bedürfnissen von Kleinfamilien und Single-Haushalten richten; auch für Wohngemeinschaften müsse Platz sein. Gemeinschaftsräume und gemeinsame Wohnküchen müßten darüber hinaus genauso als förderungsfähige Wohnflächen anerkannt werden wie Versammlungsräume oder Wintergärten.
Ganz wichtig: der Verzicht auf die sogenannte Belegungsbindung. Da viele Projekte gemeinsame soziale und ökologische Ziele verfolgen, sollten sie selbst und nicht die Wohnungsämter das Recht haben, sich für Bewohner, die aus dem Projekt ausziehen, Nachfolger auszugucken. Um eine umweltfreundliche Bauweise zu ermöglichen, sollten auch ökologische Sondermaßnahmen wie Regenwassernutzungs- oder Solaranlagen gefördert werden. Finanziert werden könnten sie, nach Meinung des Neubauplenums, durch den Verzicht auf bestimmte Ausstattungsstandards oder höhere Mietzahlungen.
Doch noch wird über solche Konzepte in den zuständigen Ämtern, der SPD oder den Wohnprojekten nur hinter verschlossenen Türen laut nachgedacht. Das wird sich ändern, wenn die Baubehörde, voraussichtlich im Spätherbst, eine Aufforderung von der WK bekommen wird, für das Barmbeker Wohnmodell der Wendebecken-Genossenschaft zu bürgen, aber aufgrund ihrer ausgeschöpften Etatmittel vermutlich passen muß.
Zu dieser Zeit dürfte auch das von der Baubehörde in Auftrag gegebene Genossenschafts-Gutachten vorliegen. Verschwindet es nicht auf Nimmerwiedersehen in einer Behördenschublade, ist dann die Diskussion um die Zukunft der alternativen Kleingenossenschaften auch offiziell eröffnet.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen