Wo die Bundeskanzler wohnen: Hier ist nicht Wünsch-dir-was
Wie sieht es eigentlich in Gmund aus, dem Nebenwohnsitz von Friedrich Merz am Tegernsee? Ein Ortsbesuch.
Die drei jungen Frauen schauen auf, als würden sie etwas Verbotenes aus ihrem Auto holen und nicht Eimer, Glasreiniger und Lappen. „Keine Zeit, Arbeit“ – und schon sind sie verschwunden in dem Haus, das sie jetzt putzen werden, direkt am Ufer des Tegernsees in Oberbayern. Blickt man von hier aufs Wasser, schmiegt sich rechts die Villa von Uli Hoeneß an den herbstbelaubten Hang. Weiter hinten steht Manuel Neuers „Glaspalast“, und am linken Ufer, über dem Dorf Sankt Quirin, das zur Gemeinde Gmund gehört: der Nebenwohnsitz von Friedrich Merz.
Es ist 10 Uhr. Der See ist heute klar und ruhig, doch der Bundeskanzler schlägt Wellen. Von einem Problem im deutschen Stadtbild sprach er am 14. Oktober. Sein bayerischer Bundesinnenminister sei deshalb dabei, „jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen“.
Die AfD raunt seit Jahren von abzuschiebenden „Ausländern im Stadtbild“. CDU-Kanzlerin Angela Merkel konterte das 2017 einmal so: Sie könne auf der Straße Menschen mit und ohne deutsche Staatsbürgerschaft nicht unterscheiden. Merz aber blieb bei seiner Aussage, trotz massiver Kritik.
Wer die eigenen Töchter frage, sagte er am Montag schmunzelnd, werde vermutlich „eine ziemlich klare und deutliche Antwort“ darauf bekommen, was er gemeint haben könnte. Eine Andeutung, ein Signal.
Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.
Schon Ludwig Erhard residierte hier
Wie damals, als Merz sagte, Deutschland, das sei nicht Berlin-Kreuzberg, sondern Gillamoos, ein bayerischer Traditionsjahrmarkt. In Berlin, Kiel, Halle und Frankfurt demonstrieren Frauen jetzt unter dem Slogan „Wir sind die Töchter“, sie wollen nicht „Feigenblatt für rechte Narrative“ sein. Und hier, in der zweiten Heimat des Kanzlers, in seinem, im richtigen Deutschland?
Gmund, also. Das sind 45 Gemeindeteile, 5.813 Seelen und mindestens so viele Parkplätze. 950 Jahre feiert Gmund gerade. In Sankt Ägidius, der katholischen Kirche, in der auch Merz ab und an zur Messe geht, haben Kinder ihre Jubiläumswünsche auf eine Pappe gemalt: „Frieden“, „Gemeinschaft“, „mehr Dönerläden“. Nebenan, über dem Portal des historischen Rathauses, verkünden Großbuchstaben: „Oberstes Gesetz ist das allgemeine Wohl.“
Das allgemeine Wohl – für Franz Kasparek hat es vor allem mit Gerechtigkeit zu tun. Kasparek, Vollbart, Strickjacke, Installateur im Ruhestand, sitzt mit seiner Schäferhündin Finni, einem Kaffee und der Tegernseer Zeitung in der Sonne vor seinem Bauernhaus. Er sei ein CSUler, das wüssten alle hier, sagt Kasparek. Aber einer mit Solarstrom auf dem Dach. Er zwinkert.
Manche im Land könnten unbesteuert Milliarden vererben, sagt Kasparek. Und hier, wo die zugezogenen Reichen die Preise in die Höhe getrieben haben, „kann man nicht einmal mehr eine Wohnung an die Kinder vererben“. Er zeigt auf sein hübsch renoviertes Haus, seit Generationen in der Familie, sei es mittlerweile drei oder vier Millionen wert. „Wer soll dafür die Erbschaftsteuer bezahlen können?“ Dass Kinder hier ihre Elternhäuser verkaufen müssten, das sei ungerecht. Kasparek zwinkert nicht mehr.
Drogen gabs hier schon immer
Und was ist mit dem Stadtbild? „Ich habe 58 Jahre lang gearbeitet“, sagt er, auch in München, er kenne das Stadtbild dort. Die Goethestraße, die Schillerstraße, den Bahnhof. „Wenn einer nicht arbeitet und den Sozialstaat schwächt, das ist ungerecht. Egal aus welchem Land er kommt.“ Wenn aber ein Ausländer nicht arbeitet, habe er keine Berechtigung zu bleiben. Da müssten Merz und Söder etwas tun. Aber wirklich. Kasparek überlegt kurz. „Wenn es unverschuldet ist, dann ist das etwas anderes.“ Hündin Finni gähnt.
Der erste Kanzler mit Residenz in Gmund war Ludwig Erhard,Vater des Wirtschaftswunders', parteilos, spätere CDU-Mitgliedschaft historisch umstritten. 1977 begrub man ihn auf dem Bergfriedhof. Auf einem Schild am menschenleeren Ludwig-Erhard-Platz steht: „Störende Musik verboten! Betteln verboten! Fußballspielen verboten! Hier kein Hundeklo!“
Sabine Seifert hat zum allgemeinen Wohl ein Plastiktütchen in der Manteltasche, für die Häufchen ihrer Mischlingsdame Zelda. „Der Herr Merz hat insofern recht“, sagt Seifert, „als unser Stadtbild im ein oder anderen Fall vielleicht ein bisschen gefährlich erscheinen mag. Aber das hat nichts mit Migration zu tun.“
Seifert, 63, lebt am nahen Ammersee, sie ist in ihrem Heimatort, um sich am Nachmittag um das Grab ihrer Eltern zu kümmern. „Selbst hier gab’s zu meiner Zeit schon Drogen an der Schule, da brauche ich nicht warten, bis ein Migrant kommt.“ Und überhaupt: „Ich hatte meine Eltern hier in dem Krankenhaus. Wenn man da die Migranten alle rausnimmt, dann wird’s da zappenduster! Warum machen die sich AfD-Themen zu eigen?“ Drei Frauen, die gerade mit ihren Hunden vorbeikommen, sehen das ganz ähnlich.
Gehoben oder abgehoben?
Das Problem sei Armut, sagt Sabine Seifert. Junge Männer – migrantisch oder nicht – wüssten oft nicht, wo sie mit sich hinsollen, und hingen dann am Bahnhof ab. Das sei immer so gewesen, das könne sich hochschaukeln. „Da müsste der Sozialstaat halt auch aktiver werden.“ Seifert zeigt hinauf zum Ackerberg. Ins alpenländische Bild passt er nicht so richtig, der Bungalow, den Ludwig Erhard hier in die Wiesen setzen ließ. Erhard-Bunker, sagen die Nachbarn dazu. Seine Sommer und seine späten Jahre verbrachte der „Vater der sozialen Marktwirtschaft“ in dem modernistischen Haus. Gut Kaltenbrunn, eine Stufe unterhalb am Ackerberg, wirkt da schon besser integriert. Auf den ersten Blick.
„Wild auf Trüffel?“, fragt ein Banner an der Einfahrt zum einst klösterlichen Gut. Es ist Mittag, eine junge Frau winkt mit einer schwarz-weißen Rallye-Fahne eine Schlange von SUVs in den Gutshof: Audi hat seine High-End-Händler aus der ganzen Welt ins schöne Bayern eingeladen. Auf dem Klosterhof können sie ausprobieren, ob es der Q3 tatsächlich schafft, automatisiert einzuparken. Junge Männer aus der arabischen Welt, hier sind sie erwünscht.
Gut Kaltenbrunn, betrieben von Feinkost Käfer, ist eine gehobene Location. Manche im Tal sagen: abgehoben. Einmal im Jahr kommen die ganz Großkopferten zum Ludwig-Erhard-Gipfel hierher.
Der Gipfel sei „quasi die Keimzelle der neuen Bundesregierung“, sagte Christiane Goetz-Weimer stolz bei ihrer Eröffnungsrede im Mai. Von ihrem Mann Wolfram hat sie die Geschäftsführung der Weimer Media Group übernommen, die das Treffen von Geschäftsleuten, Bankern und Politiker:innen seit 2014 veranstaltet. Tradition trifft Innovation, Schöpfung trifft Wertschöpfung am Tegernsee.
Die „Tegernsee-Connection“
Friedrich Merz hatte Wolfram Weimer kurz zuvor zum Kulturstaatsminister ernannt. Der Interessenkonflikt wäre dann doch zu offensichtlich gewesen, wenn er weiter das „deutsche Davos“ ausrichten würde, wie man sich selbst gern nennt. Denn im Gegensatz zu den Publikationen der Group scheint der Ludwig-Erhard-Gipfel für die Familie Weimer ein einträgliches Geschäftsmodell zu sein, Tausende kostet eine Eintrittskarte. Audi gehört wohl eher zu den kleineren Sponsoren.
Das Haus der Weimers hier in Gmund liegt neben dem von Merz, die Familien sind seit Langem befreundet, man wandert und gipfelt zusammen. Auch Katherina Reiche gehört zur „Tegernsee-Connection“, war von Anfang an beim Ludwig-Erhard-Gipfel dabei, früher als Vorstandsvorsitzende von Westenergie, 2025 dann als Wirtschaftsministerin.
Soziale Marktwirtschaft, das bedeute Eigenverantwortung, Risiko und Wettbewerb, sagte sie in ihrer Rede. Christiane Goetz-Weimer lobte Argentinien als einen Schlüsselstaat, es erlebe „mit dem exzentrischen Milei ein wahres Wirtschaftswunder“. Allgemeines Wohl sah Goetz-Weimer auch in Deutschland aufziehen: „An beiden Enden der Wohlstandsverteilung geht es kräftig voran.“
Am anderen Ende der Wiesseer Straße sieht man das noch nicht so deutlich. Die Tafel Gmund verteilt hier samstags Lebensmittel. Nebenan, in der „Ringelsocke“, dem Sozialkaufhaus der Diakonie, steht Karin Pulch, 82, hinterm Tresen. „Also wenn ich in München bin, Vorsicht, Vorsicht. Frankfurt muss eine Katastrophe sein“, sagt sie zur Stadtbilddebatte.
„Wir sind kein Basar“
Vier Kinder habe sie großgezogen und Enkel habe sie auch, sagt Pulch. Sie steht zwischen Maxi-Cosi-Kindersitzen, Wintermänteln und Möbeln. Auf einem Schild an der Kasse steht „Wir sind hier nicht bei Wünsch-Dir-was! sondern bei SO ISSES!“ Seit vier Jahren hilft Pulch ehrenamtlich mit, hier und im Inner Wheel, dem Frauen-Ableger des Rotary-Clubs. Eine sinnvolle Tätigkeit habe sie gefunden. „Das macht mir wahnsinnig viel Spaß, mit den Leuten zu reden und mit anderen Kulturen auch mal zu diskutieren und denen klarzumachen, dass wir kein Basar sind, sondern: Preise sind Preise.“
Ob es nicht seltsam sei, dass es am reichen Tegernsee, im reichen Deutschland, eine Tafel brauche und ein Sozialkaufhaus? „Die braucht es. Das sind vielfach Rentner, die eine viel zu niedrige Rente haben. Und wir haben, ich würde mal sagen, bestimmt 80 Prozent Leute, die nicht, also die – in Anführungsstrichen – Ausländer sind.“
Und die Probleme im Großstadtbild, kann man die mit Abschiebungen lösen? „Da geht es doch nur um die Illegalen und die Straftäter“, sagt Karin Pulch, „Und die gehören ruckzuck raus! Also da bin ich auch total auf der Seite von Friedrich Merz und Alexander Dobrindt.“
Eine gute Woche nach seiner Stadtbild-Aussage rudert der Kanzler etwas zurück. Menschen mit Migrationshintergrund seien ein unverzichtbarer Bestandteil des Arbeitsmarktes, sagt er am Mittwoch. Ohne Gastarbeiter hätte auch Ludwig Erhard sein Wirtschaftswunder nicht vollbringen können, mag man in Gmund denken.
Aber weil sich die Gastarbeiter:innen im „Tal der Reichen“ keine Wohnung leisten können, verschwinden sie nach Feierabend wieder aus dem Stadtbild, mit dem Auto, dem Bus 354 oder dem 18 Uhr Zug Richtung München Hauptbahnhof. „Hier läuft das ganz gut“, sagt Karin Pulch. Mit den – in Anführungsstrichen – Ausländern.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

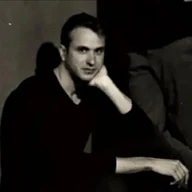





meistkommentiert