Präsident im Abgang: Damit haben wir nichts zu tun
Ein Jahr vor den US-Präsidentschaftswahlen herrscht Ratlosigkeit: Wie soll es weitergehen? Wer wäre gut genug für das Weiße Haus? Und wer hat eigentlich diesen George W. Bush gewählt?
Elf Wochen ist die Reporterin jetzt bislang durch die USA gereist, und sie war überwiegend in ländlichen Gebieten und Kleinstädten unterwegs. In Kirchen und Kneipen, auf Bauernhöfen und in Industriegebieten. Immer und überall - auch - auf der Suche nach den Wählerinnen und Wählern des Präsidenten.
Die magere Ausbeute: Einen einzigen Mann hat sie getroffen, der bekennender Anhänger von George W. Bush ist. Er habe "die Grenzen sicherer gemacht" und "die Moslems das Fürchten gelehrt", erklärt der kalifornische Farmer beim Frühstück in einem kleinen Café. Dem Wirt, der ein Wahlplakat für Hillary Clinton aufgestellt hat, fällt beinahe die Kaffeekanne aus der Hand. Er murmelt etwas, was sich anhört wie: "Erschießen müsste man den." Wen er meint, bleibt offen.
Nicht einmal der Farmer ist einschränkungslos begeistert von der Politik der Republikaner. Er macht sich Sorgen. Die Vorschriften zum Schutz der Umwelt seien nicht streng genug. "Wenn du 4.000 Häuser in der Wüste bauen willst, dann darfst du das. Und woher kommen dann Strom und Wasser?" Die würden den allgemeinen Ressourcen entnommen. Er schüttelt den Kopf, spricht von Dürre. Es falle nicht mehr so viel Regen wie früher. Wie findet er denn die Haltung des Präsidenten zu Klimaschutz und globaler Erwärmung? Er wird ganz still, schaut auf den Tisch. Ganz langsam wird er rot. Die Frage ist ihm peinlich.
Wenn eine Reporterin ihre Begegnungen nicht plant, sondern dem Zufall überlässt - wenn sie also ausschließlich die Geschichten erzählt, die sie am Straßenrand findet - und sie dann nur einen einzigen Bush-Wähler in fast drei Monaten trifft: dann liegt der Gedanke an einen groben professionellen Fehler nahe. Vielleicht hat sie ihre Gesprächspartner unbewusst zu sehr nach eigenen Sympathien ausgewählt. Lässt sich so etwas korrigieren?
Ja. Man kann den so genannten Zufall herbeizwingen und beschließen: In der nächsten Kleinstadt wird die erste Gaststätte aufgesucht, die an der Straße liegt, und dann drängt man fremden Leuten die eigene Gesellschaft auf. Es trifft "Lindas Kitchen" im texanischen Lexington. Am größten Tisch sitzen eine weiße Frau und vier Männer, drei Weiße, ein Schwarzer. Sie laden die Besucherin freundlich ein, am Gespräch teilzunehmen, als die behauptet, sich allein zu langweilen. Sie haben auch nichts dagegen, ein bisschen über Politik zu reden. Der Irakkrieg? Alle verdrehen die Augen. Entsetzt. Ein furchtbarer Fehler. George W. Bush? Das Entsetzen wächst. Niemand hier will ihn je gewählt haben. Sie alle sind überzeugte Demokraten und hoffen auf einen Sieg von Hillary Clinton. Diesen Selbstversuch muss man wohl als gescheitert betrachten.
Ist es ein Wunder? Nicht einmal bei Fox News glaubt offenbar noch jemand, mit dem Irakkrieg punkten zu können. In diesem Fernsehsender scheint Liberalismus für eine Erfindung des Antichrist gehalten zu werden und die vornehmste Aufgabe von Journalisten darin zu bestehen, einen republikanischen Sieg herbeizumoderieren. Fox News hat jetzt zu einem - im Wahlkampf eher ungewöhnlichen - Stilmittel gegriffen. Seit Wochen versuchen diese modernen Kreuzritter, der aussichtsreichen demokratischen Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton nachzuweisen, dass sie früher ebenfalls den Irakkrieg unterstützt habe. Das halten also selbst Republikaner inzwischen für ein geeignetes Mittel, um Stimmung gegen jemanden zu machen.
Der Spin ist folglich längst nicht mehr: Sie waren dagegen und haben sich geirrt, und der Irakkrieg war eine richtig gute Idee. Sondern: Die waren doch genauso blöd wie wir alle. Was für eine Strategie!
"Vor fünf Jahren hätten Sie ein ganz anderes Bild bekommen", sagt Michael White. Da hätten sich seiner Meinung nach viel mehr Gesprächspartner offen zu Bush bekannt. "Viele Leute begreifen wirklich erst jetzt, nach zwei Legislaturperioden, was sie sich da eingehandelt haben." Der 43-Jährige ist Kettenraucher, Pferdezüchter und Immobilienmakler in Sandpoint, Idaho. Er sieht aus wie Robert Redford in seinen besseren Jahren - wenn auch mit Brille. Und er ist ziemlich verzweifelt: "Es ist hart, ein Amerikaner zu sein in diesen Zeiten. Schlimm genug, dass sie Bush das erste Mal gewählt haben - aber noch mal? Wo lebe ich?" Er wirft den Kopf zurück und lacht. Dann wird er ernst: "Mehr und mehr unserer demokratischen Freiheiten werden einfach weggespült."
Michael White ist nicht so sicher, dass die Demokraten bei der nächsten Wahl den Sieg davontragen werden. "Alles, was du als Republikaner tun musst, ist: Schwenke die Fahne, rede über Waffen und Religion - und schon wählt die ganze Unterschicht republikanisch. Gegen ihr eigenes Interesse."
Wenn sie denn überhaupt wählt. Viele Amerikaner - aller Schichten - scheinen vom Wahlkampf die Nase gestrichen voll zu haben, lange bevor er richtig begonnen hat.
Wer soll nächstes Jahr ins Weiße Haus einziehen? Shere Agnew denkt nach: "Charles Hearst. Der hat mehr gesunden Menschenverstand als irgendjemand sonst, den ich kenne." Die Chancen für Charles Hearst stehen nicht gut. Er ist ein Nachbar von Shere Agnew in der texanischen Kleinstadt Eden. Und er hat bisher keinerlei Interesse daran gezeigt, sich an dem Kampf ums Weiße Haus zu beteiligen.
Shere Agnew ist Demokratin. "Aber ich würde auch einen Republikaner wählen, wenn ich den Eindruck hätte, er sei gut für das Land", sagt die 52-jährige Rancherin. "Darum geht es ja aber offenbar niemandem. Sie fragen nicht: Was ist gut für die Nation? Sondern sie reden nur dauernd schlecht über die Gegner."
Was ist gut für die Nation? Wer hat eine Vision, die über den Tag hinausreicht? Die dieses gespaltene, tief verunsicherte Land hinter sich vereinen kann? Die Frage taucht in Gesprächen immer wieder auf.
Rob Osborne auf der einen Seite und Joe Ilg und sein Bruder David Debus auf der anderen Seite würden sich vermutlich innerhalb von fünf Minuten in die Haare bekommen, wenn sie einander je begegneten und über Politik redeten. Rob Osborne ist Waffenhändler in einem kleinen Ort in Michigan und eingefleischter Republikaner. Er wird seine Wahlentscheidung vor allem davon abhängig machen, welcher Kandidat besonders nachdrücklich gegen eine Verschärfung der Waffengesetze kämpft.
Osborne bezeichnet sich selbst als Globalisierungsgegner: "Ich bin total dagegen. Und ich glaube, dass der durchschnittliche Amerikaner das genauso sieht. China hat unsere Wirtschaft ruiniert. Denen verdanken wir unsere Arbeitslosigkeit." Es gebe viele Leute, die meinten, die USA müssten den Rest der Welt glücklich machen: "Ich bin ein Bauerntrampel. Mir ist der Rest der Welt egal." Er lacht. Freundlich, offen, ein bisschen selbstironisch. Vermutlich wäre er überrascht zu erfahren, dass viele Leute in anderen Ländern inzwischen nichts mehr fürchten als den Wunsch der USA, sie glücklich zu machen. Oder gar zu befreien.
Was braucht Amerika? "Die Zeit ist reif für einen großen Staatsmann mit einer großen Vision."
Die Brüder Joe Ilg und David Debus stammen aus Wisconsin. Sie sind Demokraten. Immer gewesen. Und sie beobachten mit Sorge, dass in den USA die Sehnsucht nach einer vermeintlich "guten alten Zeit" wächst. Selbst innerhalb der politischen Elite.
"Die Führung dieses Landes lebt in der Vergangenheit", sagt David Debus, ein pensionierter Oberst. "Sie benimmt sich, als lebten wir noch in den Zeiten von Roosevelt, in denen die USA tun und lassen konnten, was sie wollten. Wir sind aber nicht mehr eine einzelne, unabhängige Macht. Wir sind heute eine von mehreren Mächten. Und wir müssen lernen, zu teilen - mit China, mit Russland, mit Indien." Sein Bruder Joe Ilg, ein ehemaliger Manager, ergänzt: "Früher hatten die Leute das Gefühl, Kontrolle über ihr Leben zu haben. Heute haben sie dieses Gefühl nicht mehr." Den Leuten in Washington, diesen "fetten Katzen", scheine das egal zu sein: "Wir haben heute keine politische Führung mehr, die über den Tag hinausschaut."
Die Sehnsucht nach dem weitsichtigen, klugen Präsidenten, der die Welt versteht und Regeln aufstellen kann, die befolgt werden: sie scheint tief verwurzelt zu sein. Bei Republikanern und bei Demokraten. Sind Osborne, Ilg und Debus geistig wirklich so weit voneinander entfernt, wie alle drei das vermutlich glauben und behaupten würden?
Dem hohen Anspruch wird übrigens - wenig überraschend - niemand von denen gerecht, die sich Hoffnungen auf einen Einzug ins Weiße Haus machen können. Darin unterscheiden sich die Kandidaten vielleicht nicht von ihren Wählern. Melisa Woolfolk ist Sekretärin bei der Feuerwehr in Nogales, einer Stadt im äußersten Süden von Arizona, durch deren Mitte die Grenze nach Mexiko verläuft. Außerdem studiert sie im etwas nördlich gelegenen Tucson Politologie. Und sie ist seit Jahren auf der lokalen Ebene politisch aktiv.
Ihr Bekanntenkreis macht sie rasend. "Du läufst einfach gegen diese Wand von Opposition. Nicht einmal Aggression. Sondern schlichte Ignoranz." Gemeint ist, wie sie ausdrücklich betont, nicht Unkenntnis. Sondern Gleichgültigkeit: "Dieses 'Es ist mir egal'." Das sei die allgemeine Haltung: "Ich will da nicht reingezogen werden - das ist die Antwort auf alles und jedes. Ich ertrage das nicht. Öffentlicher Nahverkehr? Nicht mein Problem. Gesundheitswesen? Nicht mein Problem. Von wegen. Es geht alle an."
Die junge Frau führt diese Haltung auf die mexikanische Mentalität zurück - fast alle Einwohner von Nogales haben mexikanische Vorfahren. Ihre Landsleute in anderen US-Staaten würden ihr da vermutlich widersprechen.
Wie wird es weitergehen? Auf einem Auto in Florida klebt ein Etikett: "Ich liebe mein Land. Aber ich fürchte meine Regierung." Ob der Fahrer diesen Sticker nach den nächsten Wahlen abnehmen wird?
Die Entdeckung von Amerika: Bettina Gaus USA-Reise neigt sich dem Ende zu. Dies war der letzte Teil ihrer Reportagereihe auf taz zwei
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen



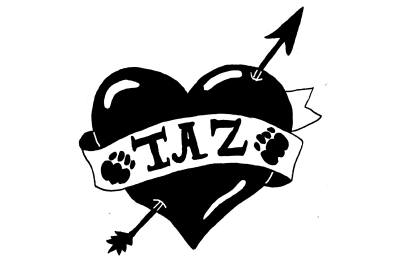
meistkommentiert
Oldenburger Polizei erschießt Schwarzen
Lorenz wurde nur 21
Der Papst ist tot
Er stand auf der richtigen Seite
Debatte über Öffentlich-Rechtliche
Hier läuft etwas schief
Ungerechtes Kindergeld
Kinder reicher Eltern bekommen mehr Geld vom Staat
Gespräch über Planung im Kapitalismus
„Niemand wird kommen, um uns zu retten“
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth
Ein Skandal folgt auf den nächsten