Erdbebenfolgen in Haiti: Cholera fordert mehr als 200 Opfer
Die Cholera-Seuche bewegt sich vom Nordwesten des Landes auf die Hauptstadt Port-au-Prince zu. Mehr als 3.000 Menschen sind bereits infiziert.
Die Cholera-Epidemie in Haiti hat am Sonntag auch Port-au-Prince erreicht. Nach Angaben des UN-Büros zur Koordinierung der humanitären Hilfe (Ocha) kam es zu fünf Todesfällen in der dicht bevölkerten Hauptstadt.
Im Nordwesten von Haiti, wo die gefährliche Infektionskrankheit ausgebrochen war, zählten die Behörden bereits 220 Tote. "Wir erwarten aber weitaus mehr", sagte Michelle Avocat vom Gesundheitsministerium. Rund 3.000 Infizierte werden zurzeit behandelt. Der Erreger sei extrem aggressiv, so dass man davon ausgehe, dass rund 10 Prozent der Patienten sterben würden. Die Todesopfer in der Hauptstadt waren erst kurz zuvor aus dem Nordwesten gekommen.
Schwerpunkt der Epidemie ist die Provinz Artibonite. Dort ist die Krankheit vor allem entlang des Flusses Saint Marc aufgetreten. Die Behörden gehen davon aus, dass sein Wasser mit dem Erreger verseucht ist. Normalerweise ist die Provinz Artibonite für haitianische Verhältnisse dünn besiedelt. Derzeit aber wohnen dort tausende von Flüchtlingen, die nach dem schweren Erdbeben vom 12. Januar im Großraum der Hauptstadt Port-au-Prince zu Verwandten aufs Land gezogen sind.
Bei dem Erdbeben waren nach offiziellen Angaben 230.000 Menschen ums Leben gekommen, rund zwei Millionen wurden obdachlos. Entlang des Flusses Saint Marc wohnen heute rund 150.000 Menschen.
Die Behörden in Haiti befürchten nun ein Übergreifen der Epidemie auf die Zeltstädte von Port-au-Prince, in denen rund 1,5 Millionen Menschen unter prekären hygienischen Bedingungen leben. "Es ist nahezu unmöglich, ein Ausbreiten der Seuche zu verhindern", sagte Michel Thieren, Haiti-Chef der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation. Die Weltgesundheitsorganisation schließt ein Übergreifen der Epidemie auf die benachbarte Dominikanische Republik nicht aus.
Cholera verursacht heftige Durchfälle und Erbrechen. Bei Patienten, die nicht sofort behandelt werden, kann der Flüssigkeitsverlust innerhalb weniger Stunden zu einem Herzstillstand führen. Die Krankheit wird durch den Kontakt mit Exkrementen oder mit damit verseuchtem Wasser übertragen. Hilfsorganisationen in den Zeltstädten von Port-au-Prince sind deshalb fieberhaft dabei, die Zahl der Latrinen zu erhöhen, die Jauchegruben öfter zu leeren und Waschbecken mit Seife in die Nähe der Abtritte zu installieren.
Die Karibik galt in den vergangenen Jahrzehnten als frei von Cholera. Die Krankheit ist in dieser Region zuletzt vor 50 Jahren aufgetreten.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

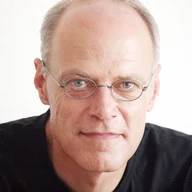




Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!