Konzert der queeren US-Popikone Anohni: Schwärmen von Angela
Hoffnung stirbt zuletzt: Anohni, die queere US-Popikone, gastierte am Dienstag mit ihrem Ensemble the Johnsons in der Berliner Zitadelle Spandau.

Anohni und the Johnsons auf der Bühne der Berliner Zitadelle Spandau Foto: Naomi Ruiz
Unlängst hatte Anohni erklärt, für eine:n Künstler:in gäbe es nichts Erfüllenderes, als vor Publikum zu einem „Katalysator für die Fantasie der Leute“ zu werden – obwohl die US-Musikerin 2016 ja angekündigt hatte, nie wieder auf Tournee gehen zu wollen. Nun ist die New Yorker Queer-Ikone aber wieder auf europäischen Bühnen unterwegs. Das Berliner Konzert ist allerdings das einzige hierzulande – zu dem die 52-Jährige gute Geister in verschiedenen Aggregatzuständen mitbringt.
Zum Auftakt tanzt ein Fabelwesen mit Geweih auf der Bühne, das findet allerdings kaum Beachtung, denn das Publikum in der teilbestuhlten Zitadelle Spandau ist mit Hitzemanagement und Getränkebeschaffung beschäftigt. Als die Tänzerin gegen Ende des Konzerts zu verstörenden Dronesounds noch einmal performt, bekommt sie dagegen volle Aufmerksamkeit. Anohni hat die Bühne da gerade kurz verlassen, doch die Verzauberung ihres Publikums hält an. Das Katalysator-Sein funktioniert offenbar.
Kurz darauf stellt Anohni ihren Gast als Johanna Constantine vor; mit ihr und der 2018 verstorbenen Julia Yasuda hatte sie Mitte der 1990er Jahre das Performancetrio The Johnsons gegründet. Auch dieser Tage ist Anohni wieder mit den Johnsons unterwegs.
Schwelgerisch musizierende Band
In der aktuellen Inkarnation verbirgt sich dahinter eine schwelgerisch musizierende Band: An der Gitarre ist etwa der sonst in eher mainstreamigen Gefilden tätige Jimmy Hogarth; er war zudem Produzent ihres Albums „My Back Was a Bridge for You to Cross“ (2023). Auch die Cellistin Julia Kent ist wieder dabei. Sie wirkte schon auf „I Am a Bird Now“ (2005) mit, dem Album, das Anohni (seinerzeit als Antony and the Johnsons) den Durchbruch brachte.
Ganz in Weiß sitzen die neun Musiker:innen im Halbkreis, in ihrer Mitte performt Anohni mit schwarzem Gewand und in Seidenhandschuhen. Der flirrende Auftakt „Why Am I Alive Now“ stammt vom neuen, ihrem sechsten Album, doch schon das Nachfolgende „4 Degrees“ signalisiert, dass das Publikum Hits aus allen Schaffensphasen erwarten darf. Die beatgetriebene Hymne reagiert mit Vehemenz auf unser Versagen, auf die Klimakrise zu reagieren; die Leute fächern sich im Takt Luft zu.
Auch die anderen Songs des elektronischen, eher harschen Vorgängers „Hopelessness“ (2016) fügen sich erstaunlich geschmeidig in die aktuelle Klangästhetik. Anohni wirkt ähnlich zugänglich wie ihr neuer Sound und hat eine deutlich entspanntere Bühnenpräsenz als auf der letzten Tour 2017. Zunächst kommuniziert sie eher minimalistisch.
Bisweilen nonchalant, oft eindringlich
Im zweiten Teil des Konzerts wendet sie sich immer wieder ans Publikum – bisweilen nonchalant, oft eindringlich. Es lässt sich auch vom drögen preußischen Militärambiente der Zitadelle – das eher zu einem Gauklermarkt passt als zu dieser intim-intensiven Kammerpop-Performance – nicht abbringen, aufmerksam zu lauschen.
Auch bei zwischendurch eingespielten Audioclips, für deren Verständnis man durchaus die Ohren spitzen muss. Diese stammen etwa von Marsha P. Johnson, Dragqueen, LGBTQI-Aktivistin (der Legende nach trat sie den Stonewall-Aufstand in New York mit los) und Namenspatronin von Anohnis Band; sie erzählt davon, wie sie sich zum Überleben prostituieren muss. Anohni nutzt das, um daran zu erinnern, dass man Held:innen nicht erst nach ihrem Tod feiern sollte – sondern besser zu Lebzeiten als solche erkennen und unterstützen.
Für die Zugabe „Hope There’s Someone“ kehrt sie im weißen Gewand zurück auf die Bühne. Gibt es also doch noch Anlass zur Hoffnung? Zuvor hatte Anohni erklärt, dass sie auf die Deutschen setzte – nachdem sie erst einmal erstaunlich ungebrochen von CDU-Altkanzlerin Angela Merkel geschwärmt hatte. Deren Politikstil sei Beleg, dass mächtige Frauen weniger toxisch unterwegs seien als Männer – und dies bedeute die vielleicht einzige Chance, unsere Spezies zu retten.
Und immerhin hätten die Deutschen, anders als die US-Amerikaner und Briten, aus ihrer Geschichte gelernt und seien gewappnet, den sich allerorten auftuenden Faschismus-Untiefen etwas entgegenzusetzen. Hmm. Das Publikum tut sich etwas schwer, die Ansage zu bewerten, also sich selbst zu applaudieren. Es bleibt der einzige Moment dieses Abends, bei dem die Reaktion auf Anohni verhalten ausfällt.



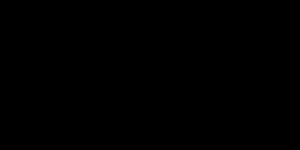
Leser*innenkommentare
Mondschaf
„dass mächtige Frauen weniger toxisch unterwegs seien als Männer".
Hmmh. Die spinnen.
Lowandorder
@Mondschaf anschließe mich - Rad ab - aber vom feinsten! Da wird einem ja glatt vor Schreck die Schmollie sauer - wa!
Lowandorder
@Lowandorder Däh&Zisch Mailtütenfrisch - schlenzt ein
“ Die spinnen, die Spinnen. Und was die Spinnen dann mit den Versponnen machen, ist doch bekannt.
Glückauf“
kurz - bei ☕️☕️☕️ erwischt es dich:
Liggers … anschließe mich!
Und geh mal bei die 🐎🐎!;)
Jau - soo kunn eulich fein wat Sündach werden!