Brecht-Bibliothek: Der große Buch-Benutzer
Ein intensiver Leser muss kein großer Buchbesitzer sein. Das kommentierte Verzeichnis der Bibliothek Bertolt Brechts zeigt: Er las viel – und besaß wenig.
Eine große Bibliothek ist es nicht – jedenfalls nicht für einen Autor seines Rangs. Gut viertausend Titel umfasst Brechts Bibliothek. So mancher wird sagen, da hab ich mehr. Hat Brecht sich etwa wirklich, wie ihm einige nachsagen, mehr referieren lassen, statt selbst zu lesen? „Marx studiert hat er nicht. Korsch hat ihm alles Notwendige zusammengefaßt“, behauptete Peter Weiss. Ist Brechts Parole „Als ich 'Das Kapital’ von Marx las, verstand ich meine Stücke“ von 1928 nur ein Akt im Schauspiel genialischer Selbstinszenierung, das uns der große BB aufführte?
Schaut man in das jetzt vorliegende kommentierte Verzeichnis der Bibliothek Brechts, scheinen die Zweifler recht zu bekommen. Da findet sich zwar gleich zwei Ausgaben des „Kapitals“, allerdings von 1932 und lediglich mit wenigen Anstreichungen und einer Widmung von Karl Korsch.
Doch der Widerspruch lässt sich auflösen. Zum einen war Brecht kein Sammler von Büchern. Sie zu lesen war ihm wichtiger, als sie zu besitzen. Wenn ihm ein Buch imponierte, veranlasste er auch seine Freunde, es zu lesen. Die Bücher wanderten. Zudem war Brecht ein eifriger Benutzer öffentlicher oder privater Leihbibliotheken. Das allein aber erklärt die Lücken nicht.
Erst die 15 Jahre Exil schlugen ins Kontor: jeder Umzug eine Dezimierung, keine Neuankunft ohne Verlustmeldung. Schon der lebensgefährliche Versuch von Brechts Mitarbeiterin Elisabeth Hauptmanns, in Berlin verbliebene Bücher und Arbeitsmaterialien aus Deutschland zu schmuggeln, scheiterte. Später, auf der Flucht von Schweden nach Finnland im April 1940, notiert Brecht: „Der Schlosser, der die Bücher nimmt, die niemand anders haben will.“ Peter Weiss machte daraus für seinen Roman „Die Ästhetik des Widerstands“ eine große Szene.
Nicht mal ein Zehntel des heute erhaltenen Bestands befand sich bereits vor 1933 in Brechts Besitz. Die Lücken sind von einiger Prominenz. So fehlen Novalis, Rabelais, Heym, Trakl, Musil, Horvath, Roth gänzlich. Auch Rimbaud, den der frühe Brecht intensiv „verwertete“, was ihm gar Plagiatsvorwürfe einbrachte, vermisst man. Ebenso Kafka. Nach der Überlieferung Walter Benjamins war Kafka für Brecht der einzig echte bolschewistische Schriftsteller, sein „Prozeß“ ein prophetisches Buch: „Was aus der Tscheka werden kann, sieht man an der Gestapo.“
Anderes, später Erworbenes überstand die Flucht vor den Nazis. Zum Beispiel die Schriften von Trotzki, den Brecht gegenüber Benjamin als den größten lebenden Schriftsteller Europas bezeichnete.
Gut dabei ist auch – mit immerhin 21 Bänden – einer von Brechts Lieblingsfeinden: Thomas Mann. Allerdings ohne jede Anmerkung und an „gebührendem“ Platz: Als Hans Mayer, mit Brecht befreundet, für den Ostberliner Aufbau-Verlag eine Gesamtausgabe der Werke Thomas Manns 1955 herausgab, zeigte ihm Brecht beim nächsten Besuch, wohin sie gehörte: „Ihre Ausgabe besitze ich auch. Da unten steht sie“, sagte er und wies auf das unterste Bord einer zimmerhohen Bücherwand.
Dass Brecht eigentlich kein Leser, sondern ein „Benutzer“ war, wie Günther Anders schrieb, zeigt sich an Beckett. Schon schwer krank, ließ sich Brecht im April 1956 Becketts „Warten auf Godot“ ins Krankenhaus bringen. Schnell in den Bearbeitungsmodus schaltend, ordnete er im Personenverzeichnis die Figuren soziologisch zu: „Estragon, ein Prolet / Wladimir, ein Intellektueller / Lucky, ein Esel oder Polizist / von Pozzo, ein Gutsbesitzer“. Auch Änderungen im Text zeigten die Tendenz hin zur Konkretisierung, die Umarbeitung blieb jedoch stecken.
Auch die vielen Randnotizen in der „Poetik“ des Aristoteles zeigen Brechts intensives Studium – und seinen Anspruch, in Analogie zur nichteuklidischen Geometrie eine nichtaristotelische Dramaturgie aufzustellen, darunter machte er es nicht.
Missvergnügen konnte Brecht ebenfalls zu Kommentaren reizen, so zu einem Band von Oskar Wilde: „Ärgerlich, daß dieser feine Schwätzer nicht die Abhängigkeit der Wahrheiten kennt! Der Prophet der Selbstverständlichkeit! Wie wenn sich einer auf den Marktplatz stellt u. mit viel Worten beweißt, daß heute schönes Wetter! Albern!“
Einen nicht kleinen Teil des Bestandes machen die von Brecht heißgeliebten Krimis aus, fast 300 an der Zahl, davon der Großteil Groschenhefte in englischer Sprache.
Das sorgfältig in mehrjähriger Arbeit erstellte Bibliotheksverzeichnis schließt eine Lücke in der Brecht-Forschung. Nicht mehr ins Buch geschafft (Manuskripte liegen oft so lange in Verlagen!) hat es ein wahrer Schatz, 2005 angekauft von der Akademie der Künste: ein Exemplar des Erstdrucks von Kafkas „Prozeß“ von 1926 – mit gleich drei Besitzvermerken von Brecht.
Die Bibliothek Bertolt Brechts. Ein kommentiertes Verzeichnis. Hrsg. vom Bertolt-Brecht-Archiv. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2007, 593 Seiten, 51 €
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

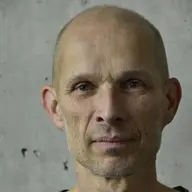

meistkommentiert