Abgeschobene Roma: Vorwärts ins Feindesland
Aus Hamburg, Hannover und Kiel werden Roma nach Serbien abgeschoben. Wie ergeht es ihnen? Ein Besuch in Südserbien und den Slums am Rande Belgrads.
PIROT/VIDIKOVAC/BREMEN taz | Dieser Tage ist in Bremerhaven wieder eine Familie zu viel. Die vier Roma sollen zurück nach Serbien. So will es die Ausländerbehörde.
In Hamburg und Niedersachen war Serbien vergangenes Jahr das Hauptzielland für Abschiebungen: In Hamburg für 75 Menschen, in Niedersachsen für 102, zählte der Flüchtlisgsrat – und schätzt, dass es hauptsächlich Roma waren.
Doch was erwartet sie in Serbien? Im Juni machte sich eine Delegation aus Deutschland, Belgien und Luxemburg auf, um nachzuschauen. Darunter der Bremer Anwalt Jan Sürig und die Ärztin Andrea Vogel, Internistin am Klinikum Bremen-Mitte. JournalistInnen der taz haben sie begleitet.
Vordergründig erscheint ein ökonomisches Problem: In den ärmsten Vierteln am Rand der Dörfer in Südserbien wohnen hauptsächlich Roma, genauso in den Slum-Hütten am Rande Belgrads. Viele von ihnen sprechen fließend Deutsch, sind sogar in Hamburg oder in Hannover geboren. Warum sie wieder nach Deutschland wollen, wird klar, wenn man sieht, wie sie Brot aus Mülleimern sammeln. Noch klarer wird es, folgt man ihren Erzählungen: Roma werden auf der Straße angefeindet, in den Schulen, bei Behörden. In Belgrad berichtet fast jeder Rom oder jede Romni von Angriffen durch Neonazis. Manchmal werden dabei die Hütten angezündet, und jemand verbrennt.
Schätzungen zufolge sind zehn Prozent der serbischen Bevölkerung Roma. Vom offiziellen Arbeitsmarkt sind sie nahezu ausgeschlossen. Wo Roma wohnen, wird die Kanalisation nicht instand gesetzt. Es gibt kein Trinkwasser, keinen Strom.
„Statt Fluchtgründe zu beseitigen, die in einer weitgehenden Diskriminierung und Marginalisierung der Roma liegen, reagieren die betroffenen Staaten, indem sie ihre Rechte weiter einschränken“, sagt die Soziologin Karin Waringo, die auch bei der Reise dabei war. Sie verweist darauf, dass serbische Behörden Reisepässe entziehen oder die Ausreise verhindern. Dies stelle einen „klaren Verstoß gegen die Menschenrechte“ dar und könne „schon an sich ein Grund sein, Schutz einzufordern“.
SerbInnen brauchen seit 2009 kein Visum, um in die EU zu reisen. Wegen steigender Flüchtlingszahlen drohte Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) Ende 2012, diese Visumsfreiheit wieder aufzuheben. Die Drohung wirkte: In Serbien bekamen die Roma die Schuld. An den Grenzen, so berichtet die serbische Menschenrechts-Organisation „Regional Center for Minorities“, werden Roma seitdem an der Ausreise gehindert.
„Die Bundespolizei bildet uns aus“, sagte Milan Barac zur taz. Er leitet im serbischen Innenministerium die Abteilung für internationale Zusammenarbeit der Grenzpolizei. Ein Vertreter der Bundespolizei sei zwei Mal die Woche da, so Barac. Kontrollen, bei denen Menschen nach ihrem Aussehen als Roma eingeordnet und herausgefischt werden, gebe es nicht. Serbien will in die EU. Auch Ivan Gerginov, Assistent des Kommissars für Flüchtlinge in Serbien, sagte daher: „Ich bin stolz darauf sagen zu können, dass niemand in Serbien obdachlos ist.“
Am gleichen Tag besuchte die Delegation die informelle Siedlung am Belgrader Stadtrand in Vidikovac. Auch viele Abgeschobene aus Norddeutschland leben dort – in Hütten aus Sperrmüll. Sie leben von dem, was andere wegwerfen. Einige seit Jahren. „Humanitäre Härten“ heißt das in deutscher Verwaltungssprache. Bremen und Schleswig-Holstein reagierten darauf zuletzt mit Winter-Abschiebestopps.
Seit Juli liegt den Petitionsausschüssen der Länder eine Eingabe vor. Eine Frau aus Rotenburg/Wümme schreibt: 500.000 Menschen wurden von den Nationalsozialisten als „Zigeuner“ vernichtet. Die deutsche Politik könne sie „vor dem Hintergrund unserer Geschichte nicht verstehen“.
Mehr zum Thema lesen Sie in der taz.am Wochenende am Kiosk oder hier
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen



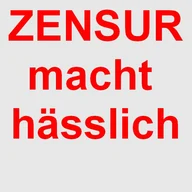
meistkommentiert
Neurowissenschaftlerin
„Hirnprozesse führen dazu, dass wir entmenschlichen“
Nachrichten im Nahost-Krieg
Trump dankt Iran für Vorwarnung vor Angriff in Katar
Erneuerbare Energien
Solaranlagen rauben sich gegenseitig die Erlöse
Verteidigungsminister Pistorius
Wehrdienstgesetz soll Hintertürchen für Wehrpflicht bekommen
Deutsch-amerikanische Freundschaft
Bridge over Troubled Water
Social-Media-Verbot
Sperrt sie nicht aus!