Neue Regeln im Wahlrecht: 5 Dinge, die man für diese Wahl wissen muss
Bei der Bundestagswahl am Sonntag gilt erstmals das neue Wahlrecht. Was sich genau ändert. Und was daran kritisiert wird.

Das Wahlrecht ist im Jahr 2023 reformiert worden. Für die Abstimmung diesen Sonntag gelten neue Regeln. Doch was sich genau ändert, ist längst nicht allen klar. Das Wichtigste in Kürze:
1. Was ändert sich durch die Wahlrechtsreform?
Der Bundestag wird auf dauerhaft 630 Mandate verkleinert. Nach der Wahl 2021 sind 736 Abgeordnete in den Bundestag eingezogen, der so zum größten demokratischen Parlament der Welt wurde. Es gab 34 sogenannte Überhang- und 104 Ausgleichsmandate. Überhangmandate gab es, wenn eine Partei mehr Direktkandidaten entsenden konnte, als ihr gemäß dem Anteil an Zweitstimmen zustanden. Für die Sitzverteilung im Bundestag ist aber das Zweitstimmenverhältnis maßgeblich. Die Überhangmandate mussten also ausgeglichen werden. Das gibt es nun nicht mehr. Das Zweitstimmenergebnis wird nach den Stimmverhältnissen auf 630 Sitze umgelegt.
2. Was bedeutet das für die Wahlkreise?
Mit der Erststimme wird weiterhin für die Wahlkreiskandidat:innen in 299 Wahlkreisen abgestimmt. In den Bundestag ziehen aber nur so viele erfolgreiche Direktkandidat:innen ein, wie es das Zweitstimmenergebnis der Partei zulässt. Beispiel: Eine Partei gewinnt in einem Bundesland 50 Wahlkreise. Nach dem Zweitstimmenergebnis stehen ihr aber nur 48 Mandate zu und so gehen die 2 Direktkandidat:innen mit den schlechtesten Erststimmenergebnissen leer aus. Das könnte in einigen wenigen Fällen bei der anstehenden Wahl durchaus vorkommen.
Empfohlener externer Inhalt
3. Warum wird die Regelung kritisiert?
Insbesondere der Union gefällt diese Regelung nicht. Die CSU etwa entscheidet traditionell fast alle bayerischen Wahlkreise für sich und hat etliche Überhangmandate zugesprochen bekommen. Nun könnten einzelne Direktkandidat:innen den Einzug in den Bundestag verpassen. Das liegt an der sogenannten Zweitstimmendeckung. Politikwissenschaftler Robert Vehrkamp, der als Sachverständiger an der Wahlrechtsreform beteiligt war, kritisiert, dass sich Mythen rund um das neue Wahlrecht verbreitet hätten.
Eine Darstellung, dass Wahlkreissieger:innen ihr Mandat nicht bekommen würden, sei falsch. Die Definition, wer als „Wahlkreissieger“ gelte, sei nun eine andere. „Ich vergleiche die neue Zweitstimmendeckung gerne mit der Abseitsregel im Fußball: Da zählt ein Tor auch nur, wenn der Torschütze nicht im Abseits stand. Die relative Mehrheit der Stimmen im Wahlkreis alleine reicht nicht mehr. Um zum Wahlkreissieger gekürt zu werden, braucht es zusätzlich die Zweitstimmendeckung“, sagt Vehrkamp. Bürger:innen müssten sich an die neue Definition erst gewöhnen, da das alte Wahlrecht noch eingeübt sei.
4. Und was ist mit der Grundmandatsklausel?
Ursprünglich sah die Reform der Ampel auch die Abschaffung der Grundmandatsklausel vor. Die besagt, dass Parteien mit dem vollen Stimmenanteil in den Bundestag einziehen, wenn sie mindestens drei Direktmandate gewinnen – auch wenn sie weniger als 5 Prozent der Stimmen erhalten, so wie das bei der Linkspartei 2021 der Fall war. Die Erststimmenkönige von der CSU, die 2021 im Bundesergebnis auf einen Stimmenanteil von 5,2 Prozent gekommen war, sahen ihre Präsenz im Bund in Gefahr. Das Bundesverfassungsgericht kippte diesen Teil der Wahlrechtsreform im Juni 2024. Die Grundmandatsklausel gilt also auch diesmal.
5. War ’s das jetzt mit Wahlrechtsreformen?
Das steht nicht fest. CDU und CSU schreiben in ihrem Wahlprogramm, das Wahlrecht erneut ändern zu wollen. Es könnte sein, dass bei der nächsten Wahl wieder neue Regeln gelten. Es ist aber unklar, welcher Stellenwert dem Thema Wahlrechtsreform in etwaigen Koalitionsverhandlungen zukommen wird.
Eine Koalition, die was bewegt: taz.de und ihre Leser:innen
Unsere Community ermöglicht den freien Zugang für alle. Dies unterscheidet uns von anderen Nachrichtenseiten. Wir begreifen Journalismus nicht nur als Produkt, sondern auch als öffentliches Gut. Unsere Artikel sollen möglichst vielen Menschen zugutekommen. Mit unserer Berichterstattung versuchen wir das zu tun, was wir können: guten, engagierten Journalismus. Alle Schwerpunkte, Berichte und Hintergründe stellen wir dabei frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade jetzt müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Was uns noch unterscheidet: Unsere Leser:innen. Sie müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Es wäre ein schönes Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






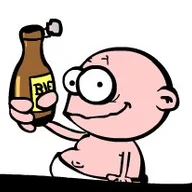
meistkommentiert
Comeback der Linkspartei
„Bist du Jan van Aken?“
Soziologische Wahlforschung
Wie schwarz werden die grünen Milieus?
Nach Taten in München und Aschaffenburg
Sicherheit, aber menschlich
Streit um tote Geiseln in Israel
Alle haben versagt
Klimaneutral bis 2045?
Grünes Wachstum ist wie Abnehmenwollen durch mehr Essen
Geiselübergabe in Gaza
Gruseliges Spektakel