Kapitalismuskritik nach dem Ende der Camps: Der Geist von Occupy
Im Januar wurde das letzte Occupy Camp Deutschlands in der Hamburger Innenstadt geräumt. Unsere Autorin wollte wissen, was von der Protestbewegung geblieben ist.

Viel ist nicht mehr zu sehen. Der Platz vor der Deutschen Bank ist leer, nur ein Hinweisschild an einem Baum deutet an, das hier einmal mehr zu sehen war als Beton und Bürogebäude: das letzte Occupy Camp Deutschlands. Über zwei Jahre lebten und diskutierten Anhänger der Protestbewegung, die an der New Yorker Wall Street begann und sich 2011 auch in Deutschland ausbreitete, mitten in der Hamburger Innenstadt – zunächst vor der HSH Nordbank, später dann auf dem Gertrudenkirchhof.
Rund 30 Camps gab es in Deutschland, nach und nach wurden sie alle geräumt. Anfang Januar wurde auch das Hamburger Camp entfernt. Da war es schon lange ruhig geworden um die Kapitalismuskritiker und Freidenker: Irgendwann gingen die Passanten nur noch vorbei, das bunte Zeltlager fügte sich einfach ins Stadtbild. Was ist heute geblieben von Occupy?
Die 99 Prozent
Das Motto der Occupy-Wall-Street-Bewegung, die im Herbst 2011 zwei Monate lang den Zuccotti Park im Finanzdistrikt der Wall Street in New York City besetzte, war „Wir sind die 99 Prozent“. Wenn es um diese selbst erklärten 99 Prozent geht, die gegen das Finanzsystem und für mehr Demokratie demonstriert haben und noch demonstrieren, fällt jede Beschreibung schwer. Tine weiß das. Die Aktivistin war im Hamburger Camp von Anfang an dabei. „Da war immer diese große Erwartungshaltung an uns. Immer hieß es: Ihr seid empört, na toll, und was sind eure Antworten?“, sagt sie. „Dabei war es doch nie unser Ziel, Lösungen zu finden.“
Die Pädagogin ist Mitte 30, wirkt freundlich und selbstbestimmt. Politisch aktiv sei sie vorher nie gewesen, kritisch aber schon, „vor allem bin ich Mensch“, sagt sie. Sie lebte im Camp, ein großer Spagat sei das gewesen, zwischen Arbeitswelt und Zeltdorf mit Volksküche. Heute geht sie auf Spurensuche, gemeinsam mit anderen Occupy-Anhängern besucht sie die alten Plätze, die einst „offene Räume für Kommunikation“ waren und auch ein bisschen ihr Zuhause. Es ist eine heterogene Gruppe: Oli ist um die 50 und buddhistischer Mönch, Thyra ist 20 und besucht die Abendschule und wird von ihrem Freund Marcel begleitet, den sie im Camp kennengelernt hat.
Ist Occupy gescheitert? „Wenn man das an ein paar Zelten festmachen will, sicher“ sagt Oli. Aber das sei nicht der Maßstab. Immerhin sei die Kritik am Finanzkapitalismus heute bis in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen. „Der Geist von Occupy lebt weiter, auch ohne die Camps.“ Er überlegt lange, bevor er spricht, wählt seine Worte mit Bedacht. Es sei nicht immer leicht gewesen, sagt er, vieles würden sie heute anders machen. Die täglichen „Asambleas“, wie Diskussionsrunden in Occupy-Kreisen genannt werden, seien anstrengend gewesen. Bis zu sechs Stunden habe man da geredet, sagt Tine und seufzt: „Wer vorher glaubte, tolerant zu sein, wurde im Camp auf die Probe gestellt.“
Feste Themen und Strukturen entsprechen nicht dem Selbstverständnis von Occupy – jeder darf teilnehmen, niemand wird ausgeschlossen, alles wird ausdiskutiert. Einige nutzten das aus, Menschen mit rechtem Gedankengut diskutierten plötzlich mit, „die waren eine Herausforderung in ihrem Denken“, sagt Tine vorsichtig und fügt hinzu: „Das konnten wir denen ja nicht verbieten – nur ihre Parteifahnen durften sie nicht mitbringen.“ Eine lange „Findungsphase“ habe es zwischen den Aktivisten gegeben. In anderen Camps kam es inzwischen zu Konflikten: Im Herbst 2011 berichteten Medien über Verwahrlosung, Alkohol und Streitereien im Frankfurter Occupy Camp. In Hamburg sei das anders gewesen, sagt Oli. Probleme seien direkt angesprochen und gelöst worden. Und irgendwann seien diese „schwierigen Menschen mit negativen Motivationen“, wie er sie nennt, dann von selbst wieder gegangen.
Hypnotisierte Shopper
An den Aktivisten zogen Menschen mit vollen Plastiktüten vorbei, den Blick aufs Smartphone gerichtet. Konsumkritik umgeben von Einkaufstempeln: Tine wäre mit dem Camp damals lieber in die Sternschanze oder nach Altona gezogen, „da ist das Engagement und das politische Problembewusstsein größer“, sagt sie. Wieder wurde diskutiert, aber dann sind sie doch in der Innenstadt geblieben. Schließlich seien es gerade „diese hypnotisierten Shopper“, die sie mit ihrem Protest erreichen wollten, sagt Tine.
Zu Beginn gab es auch hier noch viel Zuspruch – Rentner, die ihre Geldanlagen durch die Finanzkrise verloren hatten, brachten Kuchen vorbei, Angestellte der HSH Nordbank versorgten die Aktivisten mit Kaffee – „wohl zur Deeskalation“, sagt Oli und lacht. Doch irgendwann schauten die Passanten einfach nicht mehr auf die bunten Pappaufsteller mit den politischen Parolen.
Und dann kam eine Aufgabe auf die Aktivisten zu, auf die sie so nicht vorbereitet waren: Immer mehr Obdachlose kamen zum Camp, baten um Unterkunft und Essen. Für diese Menschen war nirgends Platz in der Stadt. Nicht in den Notunterkünften, erst recht nicht am Hauptbahnhof, wo die Bahnwache patrouilliert und laute, klassische Musik in Dauerschleife gespielt wird. „Natürlich hätten wir Nein sagen können. Aber wenn wir Armut und Ausgrenzung kritisieren, können wir die doch nicht ignorieren“, sagt Thyra. Bald fanden sich die Aktivisten in der Rolle von Sozialarbeitern wieder. „Das ging schon hart an die Belastungsgrenze“, sagt Tine. Die inhaltliche Arbeit habe darunter gelitten, bald ging es vor allem um organisatorische Fragen.
Auch Marcel durfte bleiben. Als er auf das Camp stieß, lebte er seit zwei Wochen auf der Straße. Wegen eines Familienstreits war der damals 19-Jährige von Zuhause abgehauen. „Occupy war wie ein großes Fischernetz, das mich aufgefangen hat, ich war ja ganz allein“, sagt er. Früher sei er so fixiert auf Materielles gewesen, heute sei ihm das alles „total egal“ – nur das menschliche Miteinander sei doch von wirklicher Bedeutung. Es klingt so, als spreche er über eine Religion. Die Anderen lächeln, klopfen Marcel auf die Schulter. Drei Obdachlose, die im Occupy Camp schliefen, standen nach der Räumung des Camps wieder auf der Straße. Die Aktivisten baten den Bezirk um Unterstützung, das Amt schickte einen Vertreter mit einer Broschüre für das Winternotprogramm vorbei. Jetzt haben die obdachlosen Männer vorübergehend Unterschlupf gefunden – privat, bei einigen Occupy-Aktivisten.
An die Spielregeln gehalten
Dass der Bezirk am Ende ernst machte mit der angedrohten Räumung, hat die Aktivisten enttäuscht. Schließlich habe es schon viele Räumungstermine gegeben, am Ende hätten aber immer die mündlichen Absprachen gegolten, sagt Oli. „Wir haben uns doch immer an die Spielregeln gehalten.“ Sie sollten das Camp verkleinern, das hätten sie getan, dann hätte es neue Gespräche geben sollen, sagt er. Doch dann kamen am 6. Januar frühmorgens die Bagger. „Das war wie ein Überfall, die haben alles kurz und klein gemacht“, sagt er und schüttelt immer wieder den Kopf.
Suche nach neuem Ort
Tine will nicht resignieren, ist sogar erleichtert. „Ich sehe das als große Chance. Jetzt müssen wir uns nicht mehr um die Organisation des Camps kümmern und können uns wieder stärker auf unsere Inhalte fokussieren“, sagt sie. Welche das sind, will sie noch nicht sagen. „Das müssen wir erst diskutieren.“ Erst mal sei die Gruppe auf der Suche nach einem neuen Versammlungsort. Ein Camp müsse es nicht sein, aber ein „kreativer Spielraum für öffentliche Aktionen, da wo man uns sieht“, sagt sie. Denn interessierte Aktivisten gebe es weiterhin. Zwar nicht mehr so viele wie zu Beginn der Protestbewegung, aber es habe sich ein festes Netzwerk in der Stadt gebildet, das weiter in Kontakt steht. Vom Bezirk erwarten sie nun Unterstützung bei der Suche nach Räumlichkeiten und deren Finanzierung.
Montag beginnen die Gespräche mit Bezirksamtsleiter Andy Grote. „Man will hier erst mal die Vorstellungen der AktivistInnen kennenlernen und dann sehen, was realistisch umgesetzt werden kann“, sagt Sorina Weiland, Pressesprecherin des Bezirksamtes Mitte.
Es wird weitergehen, auch ohne Camp, da sind sich die Aktivisten sicher. „Soziale Gerechtigkeit und Kritik an den Finanzeliten sind immer noch brennende Themen“, sagt Oli und lächelt dabei entspannt. „Manchmal dauert es nur etwas länger, bis das zu den Massen durchdringt.“
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen




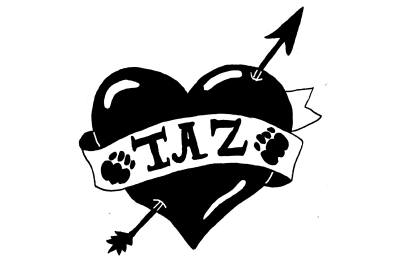
meistkommentiert
„Friedensgespräche“ in Riad
Die Verhandlungen mit Russland sind sinnlos
Trumps Kampf gegen die Universitäten
Columbia knickt ein
Ökonom über Steuersystem
„Auch in der Mitte gibt es das Gefühl, es geht ungerecht zu“
Letzte Generation angeklagt
Was sie für uns riskieren
Ergebnis der Abstimmung
Pariser wollen Hunderte Straßen für Autos dichtmachen
Kostenloser Nahverkehr
Schafft endlich die Tickets ab