Folgen des Brexit für die Autoindustrie: EU-Austritt mit Vollgas
Die britische Autoindustrie sieht dem Brexit optimistisch entgegen. Doch zusätzliche Handelsbarrieren könnten der Produktion schaden.
Geschäftsführer Mike Flewitt macht einen zufriedenen Eindruck in seinem Glas- und Stahlkonstrukt im südenglischen Woking. Manche Modelle sind auch dieses Jahr wieder ausverkauft. Das Renommee von McLaren ist global: Bis zu 92 Prozent der Produktion wird exportiert.
Das ist auch die Norm für die britische Autoindustrie allgemein, die vier Fünftel ihrer 1,67 Millionen jährlich hergestellten Fahrzeuge ins Ausland verkauft, etwas über die Hälfte in andere EU-Staaten. Die meisten britischen Automarken sind inzwischen in ausländischem Besitz: Mini, Bentley und Rolls Royce sind deutsch, Land Rover und Jaguar indisch – und McLaren gehört dem Staatsfonds von Bahrain und dem saudi-arabischen Unternehmen TAG.
Das macht McLaren nicht weniger britisch, findet der 55-jährige Flewitt. „Es geht darum, wie wir unsere Kunden pflegen. In unserer Fahrzeugklasse sind ein italienischer Lamborghini, deutscher Porsche oder McLaren heute alle annähernd gleich.“
Was sagt so ein Unternehmensführer zum Brexit? „Herausforderungen an und für sich sind für einen Rennwagenhersteller die Norm“, versichert Flewitt. Der Brexit sei eine von vielen anstehenden Veränderungen: neue Abgasnormen, neue Kraftstoffquellen, fortschreitende Automatisierung. Wichtig sei vor allem genug Zeit zur Vorbereitung auf Veränderungen. Flewitt sagt, er sei „gegen irgendwelchen extra Papierkram, Verzögerungen oder Zölle, auch wenn es für uns weniger ein Problem darstellt, weil nur 20 Prozent unserer Wagen in EU-Staaten gehen“ – viel weniger als bei anderen britischen Autoherstellern.
Das Beste beider Welten
Andererseits: 40 Prozent der Teile für seine Flitzer kommen aus der EU. Um Brexit-Problemen vorzubeugen, führt McLaren alle Teile unter einem Abkommen ein, das ermöglicht, Teile problemlos über Grenzen zu versenden, wenn sie danach nur weiterverarbeitet oder veredelt werden. „Ich bleibe Optimist, dass wir nicht mit Einfuhrzöllen rechnen müssen“, sagt der McLaren-Geschäftsführer. Sollte es doch geschehen, wäre es „reiner Schwachsinn“.
McLaren-Geschäftsführer Flewitt
Die Regierung von Premierministerin Theresa May will solchen „Schwachsinn“ nicht. „Theresa Mays Vision ist ein Abkommen mit der EU, das uns erlaubt, mit Gütern und Dienstleistungen so barrierefrei wie möglich zu handeln“, erklärt ein Regierungssprecher der taz. Es sollte Großbritannien gleichermaßen erlauben, eigene Handelsabkommen weltweit zu schmieden, sowie auch die Wiederkehr einer harten Grenze an der zukünftigen EU-Außengrenze zu Nordirland vermeiden. Das Beste beider Welten also.
McLaren-Chef Flewitt hat 10 Downing Street aufgesucht, um seine Ansichten der Premierministerin zu unterbreiten. Mays Antwort befriedigte ihn nicht, erinnert er sich: „Verhandlungen hätten nun mal ungewisse Ergebnisse“, zitiert Flewitt die Premierministerin. Dennoch glaubt er, dass Großbritannien auch in Zukunft Handelspartner der EU bleiben wird, und verweist auf den zwölfprozentigen Anteil der Autoindustrie an den britischen Exporten insgesamt.
Doch auch Mike Hawes, Chef des britischen Autoindustrieverbands SMMT, ist skeptisch angesichts der Position der Regierung. Die Partnerschaftslösung von May, in der unterschiedliche Zugänge zum europäischen Binnenmarkt einzeln verhandelt werden, könne „nie so gut sein wie die derzeitige Situation“, sagt der oberste britische Automobilindustrievertreter der taz. Viele Hersteller operierten in einem äußerst wettbewerbsintensiven Markt, in dem jegliche Zusatzkosten oder Unsicherheit neue Belastungen bedeuten. Das sei gerade dann ein Thema, „wenn es um zukünftige Investitionsentscheidungen in einem globalen Markt geht, wo viele Automarken wie Toyota und Nissan nah an ihren Käufern produzieren und Großbritannien EU-Stützpunkt ist.“
Weltweit größter Abnehmer für Minis
Schon jetzt müsse man für die USA vollkommen andere Autos bauen als für die EU, sagt Hawes: „Pick-up-Trucks statt Fließhecklimousinen.“ Doch das britische Etikett am Auto bedeute heute nicht mehr als der letzte Fertigungsort in einer „globalen Industrie“. 77 Prozent der SMMT-Mitgliedsfirmen waren für den Verbleib in der EU. Hawes sagt: „Für uns muss jegliche zukünftige Lösung annähernd die derzeitigen Verhältnisse widerspiegeln. Wir bevorzugen den Verbleib Großbritanniens im europäischen Binnenmarkt.“
Und wenn nicht? Oder wenn die Brexit-Verhandlungen sogar scheitern und es doch neue Zollschranken gibt? Das könnte zumindest für BMW ein Problem werden. Der bayerische Autofabrikant stellt im britischen Oxford Kleinwagen der Marke Mini her und in Goodwood die Edelschlitten von Rolls Royce.
Rolls Royce sei „schon lange nicht mehr ein steifes Auto von reichen britischen Grundbesitzern der 1930er und 1940er Jahre, sondern ein ultramodernes Fahrzeug“, erläutert der britische BMW-Sprecher Graham Biggs der taz. Und Großbritannien bleibt der weltweit größte Abnehmer für Minis, wo „Nostalgie der Swinging Sixties“, wie Biggs es anpreist – wohlgemerkt war diese Zeit vor dem Beitritt Großbritanniens zur EU – „auf deutsche Technik trifft“.
Jeden Tag, so Biggs, gehen für BMW 250 Lkws mit über einer Million Teilen durch den Kanalhafen Dover – ein Geschäftsmodell, das auf dem europäischen Binnenmarkt beruht, den Großbritannien im Rahmen des Brexit verlassen will. „BMW kann einiges einstecken“, versichert Biggs, „aber irgendwann erreicht man den Punkt, an dem die Wettbewerbsfähigkeit aus dem Gleichgewicht kommt.“
Andere sind da weniger empfindlich. Anthony Bamford, Besitzer des größten britischen Baufahrzeugherstellers JCB, ist Brexit-Unterstützer und Großspender an Theresa Mays Tories. Sein Unternehmen teilt auf Anfrage mit, man wolle den EU-Handel ausbauen, blicke aber zuversichtlich auf den Welthandel.
Theresa Mays Vision
Neben JCB ist der Motorradbauer Triumph einer der wenigen Fahrzeughersteller ausschließlich in britischer Hand. Besitzer John Bloor spendete den Tories vor den letzten Wahlen 400.000 Pfund. Der Motorradmarke aus Hinckley im Norden Englands ist das Britische „unglaublich wichtig“, sagt Verkaufsleiter Paul Stroud der taz: „Es ist die DNA der Marke.“ Auf dem Ruf legendärer Triumph-Fahrer wie Steve McQueen und Elvis Presley aufbauend, verkaufte Triumph letztes Jahr 64.000 Motorräder, Tendenz stark steigend. Anders als bei BMW und McLaren kommen bei Triumph nur 10 Prozent der Teile aus der EU. Vieles stellt Triumph in England selbst her, erläutert Stroud, der Rest komme aus Asien.
35 Prozent aller Triumph-Räder gehen in andere EU-Staaten. Das mag Strouds Aussage erklären, wenn er sagt: „Triumph verlangt selbstverständlich die Beibehaltung der aktuellen Lage, Handel mit der EU ohne Zölle.“ Er bemängelt fehlende Klarheit „über die Konditionen, zu denen wir die EU verlassen“. Zugleich aber produziere Triumph auch schon in Thailand und kümmert sich um den chinesischen Markt. „Wir werden uns den Anforderungen des Brexit, was auch immer er bedeutet, anpassen“, beteuert Stroud zuversichtlich. Das ist Theresa Mays Vision: den Handel mit Europa und weltweit ausbauen.
Auch McLaren äußert Zuversicht. In sechs Monaten soll auf einem neuen Firmengelände in Sheffield McLarens Kohlefaserherstellung ausgebaut werden. Und auch die großen Firmen legen nach. Toyota plant in Großbritannien Investitionen für das neue Auris-Modell und will Wasserstoff-betriebene Pkws testen. Ein Regierungssprecher sagt, solche Investitionen seien ein Vertrauensbeweis.
Tony Burke von der Gewerkschaft Unite, die auch die Autobauer organisiert, beruhigt das nicht. „Sollten Nissan oder Toyota doch die Koffer packen, hätte das katastrophale Konsequenzen“, warnt er. Für ihn geht es nicht nur um Zollfreiheit, sondern auch um den Fortbestand eines fairen Arbeitsrechts. Immerhin seien in Großbritannien 169.000 Personen in der Autoindustrie direkt angestellt, insgesamt hingen an der Branche 814.000 Arbeitsplätze. „Die von der Regierung sollen sich endlich zusammenreißen“, schimpft der Gewerkschaftler.
Aber Geschäftsführer Mike Flewitt ist wenig besorgt. „Nächstes Jahr werden unsere neuen McLaren noch besser sein als die diesjährigen“, behauptet er. Wie genau – das wisse er noch gar nicht, weil die Fahrzeuge bereits zu den besten der Welt gehören. „Irgendwie werden sie besser. So ist es immer, und so ist es mit Herausforderungen bei uns.“
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






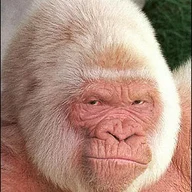
meistkommentiert
Deutsche Nahostpolitik
Deutschland muss Israel mit Sanktionen drohen
Messerangriff im Hamburger Hauptbahnhof
Mutmaßliche Täterin wohl psychisch krank
CDU und Linkspartei
Die Befreiung vom Hufeisen
Wirtschaftsministerin Katharina Reiche
Energisch, ostdeutsch, konservativ
CO2-Absauger in der Krise
Climeworks feuert ein Fünftel der Belegschaft
Autor Lebedew über russische Opposition
„Russland muss dekolonisiert werden“