Neues Einbürgerungsgesetz: Mehr Anträge, lange Bearbeitung
Bei den Behörden stapeln sich die Einbürgerungsanträge. Mit dem neuen Einbürgerungsgesetz könnte sich die Situation noch verschärfen.
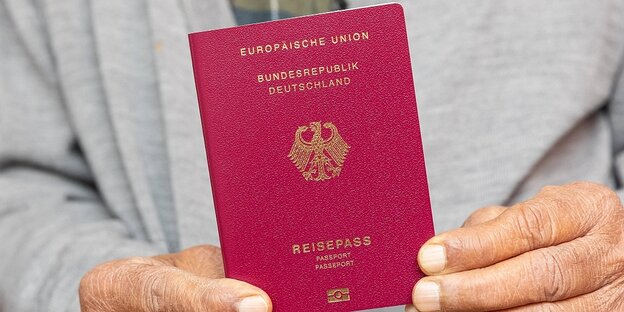
Gibt es in Zukunft nach fünf statt acht Jahren: den deutschen Reisepass Foto: Nikito/imago
BERLIN taz | Am Donnerstag tritt das neue Einbürgerungsgesetz in Kraft. Demnach werden künftig mehr Menschen die Möglichkeit auf Einbürgerung haben. Die Zahlen zeigen, dass schon jetzt das Interesse groß ist: In den letzten Jahren ist die Zahl der Einbürgerungsanträge stetig gestiegen. Das geht aus einer Umfrage des Mediendienst Integration bei den 45 bevölkerungsreichsten deutschen Städten hervor.
Während im Jahr 2022 noch knapp über 100.000 Personen einen Antrag auf Einbürgerung gestellt haben, waren es 2023 über 125.000. Laut dem Statistischen Bundesamt bewegte sich mit 200.100 Personen auch die Zahl der Einbürgerungen auf einem Rekordhoch. Derzeit befinden sich noch über 200.000 Anträge in Bearbeitung bei den Behörden. In Hamburg sind es über 25.000 offene Fälle, in Berlin über 40.000.
Nach Angaben der Städte liegt die derzeitige Bearbeitungszeit zwischen drei Monaten und drei Jahren. Gründe für die langen Wartezeiten seien die Unvollständigkeit der Dokumente, die zeitraubende Zusammenarbeit mit anderen Behörden und ein zunehmender Bearbeitungsstau, gaben die Städte bei der Befragung an.
Bislang musste eine Person acht Jahre in Deutschland gelebt haben, um eingebürgert werden zu können. Nach dem neuen Gesetz ist dies in der Regel nun auf fünf Jahre verkürzt. Wer bestimmte Voraussetzungen, wie ein bürgerliches Engagement oder besondere akademische Leistungen, vorweisen kann, hat schon nach drei Jahren die Möglichkeit auf Einbürgerung.
Außerdem müssen Antragsteller:innen nun grundsätzlich nicht mehr ihre vorherige Staatsbürgerschaft abgeben, sondern können eine doppelte Staatsbürgerschaft erhalten. Dies war zuvor nur für Bürger:innen der EU-Mitgliedsstaaten und einzelner Nicht-EU-Staaten möglich.
Frankfurt rechnet mit doppelt so vielen Anträgen
Fast alle der befragten Städte gaben an, dass das Interesse an Einbürgerungen im Zusammenhang mit dem neuen Gesetz stark gestiegen ist. In Frankfurt am Main und Freiburg rechne man damit, dass sich die Anträge nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes mehr als verdoppeln werden, so der Mediendienst.
Das könnte die langen Bearbeitungszeiten in den Behörden noch einmal verlängern. Rechtsanwalt Mohamed El-Zaatari von der Onlineplattform „Pass Experten“, die rechtliche Beratung für Antragsteller:innen anbietet, sieht das problematisch. „Nach unserer Einschätzung kann die aktuelle Lage in den Behörden dieser bevorstehenden Antragsflut nicht gerecht werden,“ sagte er der taz.
Die technische und personelle Situation in den Behörden verhindere eine effiziente und effektive Bearbeitung der Anträge. Um dem neuen Einbürgerungsgesetz gerecht zu werden, „muss der öffentliche Dienst als Arbeitgeber wieder attraktiver für ihre Beschäftigten werden“, so El-Zaatari.
Laut den Zahlen des Mediendienst Integration kommen die meisten Antragsteller:innen aus Syrien, der Irak steht an zweiter Stelle und die Türkei an dritter. Besonders stark angestiegen ist die Anzahl der Anträge laut den Daten in Mülheim an der Ruhr, hier um 125 Prozent, in Mönchengladbach um 94 Prozent und in Lübeck um 87 Prozent.
Bei „Pass Experten“ sind nach eigenen Angaben seit Beginn des Jahres über 50.000 Anträge eingegangen. Ein Drittel von ihnen lebt schon seit 2012 oder länger in Deutschland, circa ein Fünftel seit 2015. 86 Prozent der Antragsteller:innen sind derzeit entweder angestellt oder selbstständig.
Mehr als 125.000 Menschen staatenlos
Neue Zahlen des Sachverständigenrats für Migration und Integration zeigen zudem, dass derzeit in Deutschland über 125.000 Menschen leben, die als staatenlos gelten oder eine ungeklärte Staatsangehörigkeit haben. Der Verwaltungs- und Prüfaufwand sei erheblich, sagte Jan Schneider vom Sachverständigenrat bei einem Pressegespräch.
Derzeit gebe es keinen einheitlichen Vorgang für die Feststellung einer Staatenlosigkeit, auch die Zuständigkeit der einzelnen Behörden sei teilweise unklar, so Schneider. Die neuen Einbürgerungsregelungen gelten auch für anerkannt Staatenlose. Problematisch sei laut Schneider jedoch, dass es durch die Intransparenz des Vorgangs dazu kommen kann, dass eine Staatenlosigkeit in einem Bundesland anerkannt werden kann, in einem anderen jedoch nicht.
Eine Regelung gibt es dafür im neuen Gesetz nicht. „Es sollte im staatlichen Interesse sein, dass es ein systematisches Feststellungsverfahren gibt“, sagte Schneider.
Viele Staatenlose kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien und der ehemaligen Sowjetunion und seien damals durch das Raster gefallen. Außerdem kommen Staatenlose häufig aus palästinensischen Gebieten oder sind Palästinenser:innen, die zuvor in Syrien oder dem Libanon gelebt haben.




