Treffen des Internationalen Währungsfonds: Mehr Macht für den Süden
Die 20 einflussreichsten Staaten einigen sich auf mehr Stimmen für die Schwellenländer im Internationalen Währungsfonds. Europäische Länder geben dafür Stimmrechte ab.
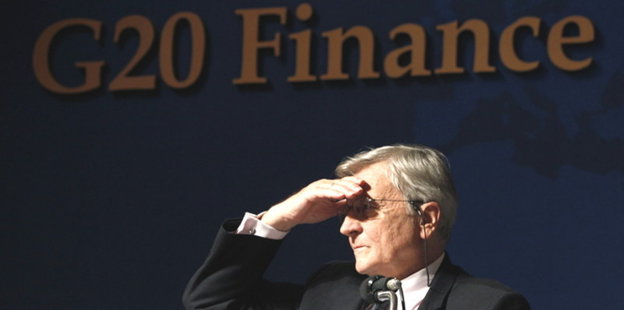
Entscheidung mit Weitblick? Der Chef der europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet. Bild: reuters
Die neuen wirtschaftlichen Machtverhältnisse auf der Welt werden nun auch im Internationalen Währungsfonds (IWF) nachvollzogen. Überraschend einigten sich die Finanzminister der 20 großen Industrie- und Schwellenländer auf ihrem Treffen im südkoreanischen Gyeongju darauf, dem Süden mehr Einfluss im Fonds zu geben. Damit setzten sie das Versprechen um, das die G 20 vor einem Jahr den zu wirtschaftlichen Schwergewichten gewordenen Schwellenländern gegeben hatten.
Indien und Brasilien rücken erstmals in die Gruppe der zehn größten Anteilseigner des IWF auf. Die Stimmrechte hängen von den Anteilen ("Quoten") ab. China gelangt vom sechsten auf den dritten Platz und damit noch vor Deutschland. Insgesamt sollen die Entwicklungs- und Schwellenländer, die derzeit zusammen auf einen Stimmenanteil von rund 40 Prozent kommen, gut 6 Prozentpunkte mehr bekommen. Stimmrechte abgeben müssen vor allem die europäischen Länder.
Ebenfalls gelöst wurde der langjährige Streit um die Verteilung der 24 Sitze im IWF-Verwaltungsrat. Künftig müssen die Europäer auf zwei ihrer bisher neun Sitze verzichten. Offen blieb allerdings, welche beiden Länder rausfliegen und wer an ihre Stelle tritt. Die US-Amerikaner konnten sich nicht mit ihrer Forderung durchsetzen, den Verwaltungsrat zulasten der Europäer auf 20 Sitze zu verkleinern. Dafür müssen die USA aber auch keine Macht abgeben, wie von der EU gefordert. Mit 17,67 Prozent aller Stimmen verfügen sie weiter über eine Sperrminorität.
IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn bezeichnete den Kompromiss als den wichtigsten Beschluss über die Verwaltung des Fonds seit seiner Gründung 1944: "Was wir heute erreicht haben, beendet die Diskussion über die Legitimität des Fonds, die sich über Jahre, ja fast Jahrzehnte hinzog." Die Frage der Legitimität ist zuletzt besonders wichtig geworden, weil der IWF in der Finanzkrise wieder eine wichtige Rolle zu spielen begann - als Aufseher über das internationale Finanzsystem ebenso wie als Kreditgeber für Krisenstaaten wie Griechenland. Die Glaubwürdigkeit des IWF werde durch den Beschluss "korrigiert", meinte auch der indische Finanzminister Pranab Mukherjee, "wenn auch nicht in vollem, so doch immerhin in erheblichem Umfang".
Für Peter Wahl von der entwicklungspolitischen Organisation Weed ist der Beschluss allenfalls ein "Schritt in die richtige Richtung". Er kritisiert, dass im Gegensatz zu den Europäern die USA ihren Stimmenanteil verteidigen konnten und damit ihr Vetorecht: "Diese relative Stärkung der amerikanischen Machtposition geht völlig gegen den weltpolitischen Trend."
Keine Einigung erzielten die G-20-Minister über das andere große Thema des Treffens: den Währungsstreit. Sie erklärten nur, einen Abwertungswettlauf verhindern zu wollen - nicht aber, wie. Zuvor hatten vor allem die USA China kritisiert, weil das Land sich durch unterbewertete Währung Wettbewerbsvorteile verschaffe. Nach dem Treffen äußerte der deutsche Wirtschaftsminister Rainer Brüderle, der Finanzminister Wolfgang Schäuble vertrat, ungewöhnlich scharfe Kritik an den USA, weil deren lockere Geldpolitik den Dollar-Kurs künstlich verbillige: "Eine übermäßige permanente Geldvermehrung ist für mich eine indirekte Manipulation eines Kurses.
