Kolumne Geräusche: Hinter meinem Haus
Die Nachtgeräusche von Dorf und Stadt unterscheiden sich. Stören tun sie beide.
Der Umzug vom Dorf in die Stadt vor einem Jahr hatte auch damit zu tun, dass es uns auf dem Dorf einfach zu laut geworden war. Der deutsche Dorfbewohner, so viel weiß ich nach zehn Jahren Studium, steht gern früh auf und lärmt. Wahrscheinlich um allen anderen in seiner Umgebung mitzuteilen, dass er nun sein Tagwerk begonnen, also allseits Achtung verdient habe. Ob das eine Eigenheit schwäbischer Dörfer ist und in Brandenburg und Vorpommern ganz anders, entzieht sich meiner Kenntnis.
In meinem Fall lärmten meine lieben Mitmenschen vor allem und mit allem, was einen Motor besaß. Mit Autos und Lastwagen, die sie ab fünf Uhr morgens an der Tankstelle gegenüber betankten oder bei denen sie an der einzigen Ampel des Dorfes, die ausgerechnet vor meinem Haus stand, ihren Drehzahlmesser auf seine Funktionstüchtigkeit überprüften.
Etwas später setzte dann das Summen und Heulen der anderen Motoren ein, die, je nach Jahreszeit, mal eine Heckenschere, einen Rasenmäher oder einen Laubbläser antrieben. In den ruhigen Phasen dazwischen donnerte der Regionalexpress hinter dem Haus vorbei oder raste ein Notarztwagen, aus der Stadt kommend, in Richtung Dorfmitte. Ich fragte mich damals, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Lärm und den vielen Herzinfarkten in unserem Dorf. Nicht einmal in der Nacht ebbte die Beschallung ab: Da versammelte sich die Dorfjugend an der Tanke, um den Tag ausklingen zu lassen, und von der nahen vierspurigen Bundesstraße legte sich ein Rauschteppich über das schlafende Dorf.
Es war jedenfalls an der Zeit, mir einen ruhigeren Lebensmittelpunkt zu suchen, und die Stadt versprach genau das. Die neue Wohnung liegt zentral in der Innenstadt, und in den ersten Nächten nach meinem Umzug musste ich mich an die Stille erst gewöhnen. Ich schlief, was wir im Dorf niemals taten, bei geöffnetem Fenster, das ich erst am Morgen schloss, weil die Amseln davor so laut pfiffen.
Inzwischen weiß ich, dass diese ersten herrlich ruhigen Nächte trügerisch waren. Man sollte niemals in den Semesterferien in eine Universitätsstadt ziehen. Das Ende der Semesterferien lässt sich von meinem Schlafzimmerfenster aus in Dezibel messen.
Es beginnt am frühen Abend mit angenehmem Stimmengewirr aus dem gegenüberliegenden Biergarten, steigert sich bis kurz nach Mitternacht in ein Geklirr aus zerplatzten Bierflaschen und findet seinen Höhepunkt gegen fünf Uhr früh, wenn vom Berg hinter unserem Haus die Verbindungsstudenten ihre alten Lieder heruntergrölen. Sie singen nicht, sie grölen. Gesungen könnte ich es ja vielleicht noch ertragen, wenn aus den biergeschmierten Kehlen der Burschenschaftler ein nächtliches Lob auf den württembergischen Graf Eberhard im Bart angestimmt würde.
Morgens um fünf. Obwohl Graf Eberhard im Bart seit über 400 Jahren tot ist. Er sei, so höre ich schlaflos in meinem Bett liegend, ein sehr guter Landesvater gewesen. Also kein Mappus. Einer, der seinen Kopf jedem Untertan in den Schoß hätte legen können, ohne umgebracht zu werden, um zu schlafen. Schlafen. Mehr wollte ich ja eigentlich auch nicht.

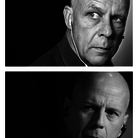
Leser*innenkommentare
Aleia
Gast
Lieber Herr Mausshardt,
egal ob Dorf oder Stadt - die Wahl des ganz konkreten Wohnorts ist nie leicht und will wohlüberlegt sein. Trotzdem gibt es immer noch Überraschungen nach dem Umzug - gute und weniger gute. Such is life!
Am besten wäre, eine Zeit in der Nähe der angepeilten Bleibe "probezuwohnen", vor allem wenn man geräuschempfindlich ist. Vielleicht lässt sich das ja in Zeiten des Couchsurfings bewerkstelligen. Auch sollte man sich die Wohngegend zu verschiedenen Tageszeiten, am Wochenende und an Arbeitstagen ansehen.
Auf Auskünfte anderer sollte man sich nicht verlassen, da jeder die Geräuschsituation anders empfindet. Eine Freundin beklagte beispielsweise, dass sie trotz geschlossenen Fensters immer aufwacht, wenn der Zeitungszusteller morgens um 5 Uhr vor ihrem Schlafzimmerfenster vorfährt. Als ich einmal bei ihr übernachtete, habe ich prima durchgeschlafen und sie gefragt, warum denn der Zeitungszusteller diesmal nicht da war. Sie guckte genervt, denn alles war wie immer gewesen.
Als ehemalige Dorfbewohnerin finde ich allerdings die Zugereisten am Schlimmsten, die anscheinend völlig ahnungslos darüber, was das bedeutet, ein Haus in der Nähe einer Kirche kaufen und dann jahrelange Prozesse führen, damit die Turmuhr nicht mehr viertelstündlich schlägt und das sonntägliche Glockenläuten später beginnt. Ganz schön bescheuert!
Als ich nach einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt in einer asiatischen Großstadt nach Deutschland zurückkehrte, hat mich in den ersten Monaten übrigens die extreme Ruhe meines derzeitigen kleinstädtischen Wohnorts gestört. Ich fühlte mich einsame und habe mich gefragt, ob es bei dieser Totenstille - besonders am Sonntag - überhaupt jemanden oder etwas Lebendiges in meiner Nähe gibt. Auf der Straße war auch niemand zu sehen. Mit der Zeit habe ich mich aber daran gewöhnt. Über die Kirchenglocken und das Schlagen der Turmuhr freue ich mich, denn es sagt mir: endlich wieder zuhause!