Kabinett verabschiedet Gesetzentwurf: Mehr Kontrolle über Internetnutzer
Innenminister Schäuble will, dass Webseitenbetreiber künftig IP-Adressen von Internet-Surfern protokollieren dürfen. Bürgerrechtler halten dies für "ungeheuerlich".
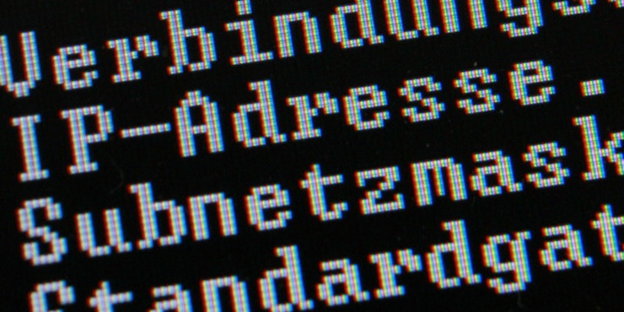
Internetseiten-Betreiber dürfen IP-Adressen ihrer Nutzer künftig speichern. Bild: dpa
BERLIN taz Die Bundesregierung will den Betreibern von Internetseiten künftig ausdrücklich erlauben, die IP-Adressen ihrer Nutzer zu speichern. Viele Seitenanbieter machen dies bereits, doch sie bewegen sich dabei in einer rechtlichen Grauzone. Die Bürgerrechtler vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung halten die Pläne der Bundesregierung für "ungeheuerlich".
Der Gesetzentwurf von Innenminister Wolfgang Schäuble (CDU) wurde vorige Woche im Bundeskabinett auf den Weg gebracht. Eher versteckt findet sich in dem Entwurf ein Passus zur Änderung des Telemediengesetzes. Danach darf der Webseitenbetreiber künftig Nutzungsdaten speichern, um Störungen zu erkennen und zu beseitigen.
Fast alle Webseitenbetreiber (zum Beispiel Online-Medien oder Online-Shops) speichern IP-Adressen der Nutzer zumindest kurzfristig in sogenannten Logfiles, um technische Probleme zu analysieren oder Hackerattacken abwehren zu können. Außerdem nutzen Seitenbetreiber die IP-Adressen oft, um zu sehen, wie lange ein Nutzer auf einer Webseite bleibt und was er sich konkret ansieht.
Die IP-Adresse (zum Beispiel 91.18.254. 206) wird bei Privatnutzern jeweils neu vergeben, wenn sie sich ins Internet einwählen. Bisher ist unklar, ob die Speicherung dieser Zahlenkolonnen erlaubt ist. So entschied das Amtsgericht Berlin-Mitte 2007, dass die Speicherung von IP-Adressen grundsätzlich verboten ist.
Jedoch hat das Amtsgericht München 2008 erklärt, dass Internet-Nutzer die Speicherung ihrer IP-Adresse nicht verhindern können, weil diese kein personenbezogenes Datum sei. Der Webseitenbetreiber könne aus den abstrakten Zahlen schließlich nicht sehen, welche Person dahintersteht. Nur der Internet-Provider, beispielsweise T-Online, kann zuordnen, welchem Kunden er zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte IP-Adresse vergeben hat. Seit Jahresbeginn muss er dies wegen der Vorratsdatenspeicherung sogar sechs Monate speichern. Er darf die Information aber nur der Polizei herausgeben.
Das Innenministerium will die Grauzone jetzt beseitigen und den Webseitenbetreibern das Speichern von IP-Adressen ausdrücklich erlauben. Da dies aber nur zur Abwehr von Störungen möglich sein soll, heißt dies im Umkehrschluss, dass IP-Adressen nicht mehr gespeichert werden dürfen, um das Nutzerverhalten zu analysieren. Dazu gibt es inzwischen auch genügend völlig anonyme Möglichkeiten.
Betroffen von dieser eher datenschutzfreundlichen Einschränkung ist zum Beispiel das Bundesinnenministerium selbst. Im Impressum seiner Webseite www.bmi.bund.de heißt es derzeit, IP-Adressen würden gespeichert und "zur Verbesserung unseres Internetdienstes genutzt".
Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung sieht in der künftig ausdrücklich erlaubten Speicherung der IP-Adressen durch die Webseitenbetreiber eine "freiwillige Vorratsdatenspeicherung", die "gewaltig" über bisherige Speicherpflichten hinausgehe.



Leser*innenkommentare
Karl Napf
Gast
Das Spiel läuft genauso, wie bei dem Frosch, den man in einen Topf mit kochendem Wasser wirft: er wird umgehend herausspringen. Setzt man ihn jedoch ins kalte Wasser und macht es nach und nach immer heisser, läßt er sich brav zu Tode kochen.
Wir sind auf dem Weg zu einem faschistischen Staat, und wer es noch nicht gemerkt hat, sollte langsam die Augen und Ohren aufsperren, es gibt (noch) genug Möglichkeiten, sich zu informieren.
Sicher gibt es immer Erklärungen, für was dies oder jenes jetzt gut ist, und für sich genommen, mögen manche Dinge harmlos sein, aber alles zusammen ergibt dann wie beim Puzzle erst ein Bild.
In den USA existieren heute bereits Lager zur Internierung von "public enemies" für den Ernstfall, die zigtausende aufnehmen können.
admin
Gast
Hier wird sich über etwas aufgeregt, ohne den Grund dafür zu verstehen.
Um einen Serverbetrieb überhaupt zu ermöglichen, müssen IP-Adressen gespeichert werden, ansonsten wären viele Schutz- und Fehlerüberwachungsfunktionen überhaupt nicht möglich. Jeder Serverbetreiber wäre bei Angriffen handlungsunfähig.
Das vorherige Urteil hatte alle Serverbetreiber und manche Webseitenbetreiber kriminalisiert. Das war absurd. Als Vergleich: man muss jeden in seine Wohnung lassen und wenn derjenige Probleme macht, darf man ihn nicht rauswerfen, geschweige denn: ihn verbieten wieder zu kommen. Sein Gesicht musste man auch sofort vergessen.
Das es nun wieder erlaubt ist, sich zu schützen, ist absolut sinnvoll und hat nichts mit Spionage zu tun.
Zugegeben, bei Schäubles Vorschlägen reagiere ich auch reflexartig mit Ablehnung.
Mr. Nohup
Gast
Da ist Google mal wieder einen Schritt weiter. Wie mir kürzlich jemand erklärt hat, hat Google durch Fahrzeuge in den Straßen die Kennungen der meisten drahtlos-Netzwerke (WLANs) erfaßt, öffentliche wie private. Diese Kennungen dienen eigentlich nur dem Datenverkehr innerhalb des WLANs (z.B. in der Wohnung), werden aber anscheinend trotzdem bei Internetanfragen übertragen (daß das so ist, wußte ich auch noch nicht).
So kann Google den Nutzern seiner Webseiten (z.B. Google Mobile Maps), die sich über WLAN anmelden, automatisch erklären, welchen Standort z.B. das Smartphone der Nutzer auf der Karte gerade ungefähr hat. Und zwar unabhängig davon, ob die IP (Internetadresse) statisch oder dynamisch ("anonym") ist - das benutzte WLAN und seine Kennung bleibt ja das Gleiche.
Das ist zwar pfiffig, aber auch ziemlich gruselig. Man stelle sich vor, daß mal wieder ein Staat ein totalitäres System errichtet, mit Geheimdiensten, die Leute entführen und in geheime Gefängnisse stecken....
Amos
Gast
Man hat wirklich den Eindruck , dass Schäuble nur darauf wartet, dass endlich was passiert. Der wäre in der ehemaligen DDR gut aufgehoben gewesen.Da traute auch einer dem anderen nicht , weil man der Obrigkeit misstraute. Ein Psychologe, würde bestimmt
eine gute Antwort darauf wissen, was mit diesem Innenminister los ist. Eigentlich ist das ja auch ein Armutszeugnis für die Kanzlerin , dass sie diesen Menschen schalten und walten lässt.
Sandra Negro
Gast
Ich kann sehen wie sich einige Politiker vor Lachen kaum noch auf ihrem Stuhl halten können. Schäuble und Co haben gewiß nie damit gerechnet, dass es so einfach sein wird das Volk zu manipulieren.
Man spricht hierbei auch von der altbekannten Salamitechnik. Es ist kaum vorstellbar von einem Tag auf dem nächsten die absolute Kontrolle einzuführen. Das würde der durchschnittliche Bundesbürger nicht verkraften. Aber schrittweise kann man die einzelnen Verordnungen bequem und ohne ernsthaften Widerstand umsetzen. Am Ende kommt das gleiche dabei raus.
Es wundert niemanden, dass Schäuble immer wieder ein weiteres Gesetz entwickelt. Entweder leidet er unter ernstfhaften Störungen, wenn er nicht dazu in der Lage ist in einem Schwung alle seine Bedenken in Gesetze umzuwandeln, oder es steckt schlicht und ergreifend Strategie dahinter. Wir sind hier schließlich nicht im Kindergarten, wo man nach tagesform und Lauen irgednwelche Ideen und Spinnereien kund tut. Wer weiß, welcher Schritt diesem folgt und vielleicht sogar schon längst in Papierform in irgendeinem Safe liegt.
Das dritte Reich oder die DDR ist auch nicht über Nacht entstanden. Wie kann es sein, dass der Bürger immer wieder auf die selbe plumpe Taktik hereinfällt? 20.000 Jahre Menschheitsgeschichte und immer wieder spielt die selbe Platte.
Jan
Gast
Mir wird mittlerweile schlecht wenn ich nur den Namen Schäuble höre... - er, der BND und seine ganze Bande - hier sind Feinde der Demokratie und unseres Grundgesetzes am Werk... durch Wahlen legitimierte Feinde, und das gab es schon einmal... Erstaunlich ist nur, dass es keinen öffentlichen Aufschrei gibt. Still und leise wird von den BürgerInnen akzeptiert, dass sie durch sprichwörtlich jeden Gesetzentwurf dieses Innenministers ihre Bürgerrechte Stück für Stück abtreten. Die einzigen, in die ich wieder mal alle meine Hoffnungen setze, sind die Richter in den roten Roben in Karlsruhe...
A. Loro
Gast
Ist da jemand vom Chaos Computer Club der das Thema
besprechen kann? Ist Anonymitaet im Internet
einfach gar nicht zu haben?
Yakitora
Gast
Dann bin ich wohl ein Schelm . . . >-(
manfred (57)
Gast
Recht haben sie, die Bürgerrechtler. Der Provider muß die Nutzerdaten 6 Monate speichern und kann die IP-Adressen zuordnen, der Betreiber der Seite kann (vorerst nur "kann") die IP-Adressen speichern, und Herr Schäuble hat auf beides Zugriff. Ein Schelm, wer Arges dabei denkt.