Zuwanderung: Nützliche Ausländer
Zuzug von Ingenieuren soll erleichtert werden. Erstmals denkt die große Koalition auch über ein Punktesystem nach.
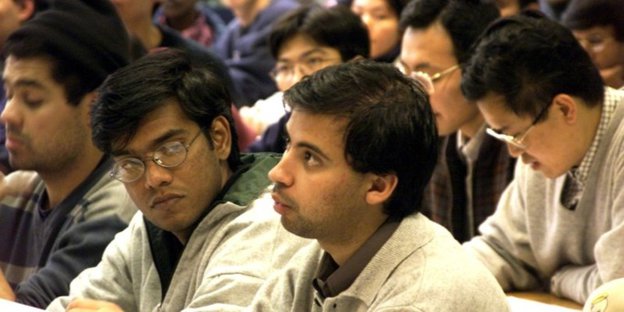
Spezies "nützliche Ausländer": Diese hier studieren an der TH Hamburg-Harburg Bild: dpa
BERLIN taz Und die Regierung bewegt sich doch. Zumindest ein bisschen. Aufgeschreckt von den Klagen der Wirtschaft über zunehmenden Fachkräftemangel, beraten die Kanzlerin und ihre Minister bei der Kabinettsklausur in Meseberg auch über Änderungen bei den Einwanderungsregeln. Wie sich am Donnerstag abzeichnete, will die Regierung zunächst einige Hürden abbauen, damit speziell ausgebildete Ingenieure künftig leichter nach Deutschland kommen können.
Dies sei aber nur der Anfang, hieß es. Angela Merkel und manche Kabinettsmitglieder denken inzwischen auch über einen grundsätzlich neuen Ansatz in der Einwanderungspolitik nach. So beschäftigt sich das Kabinett in Meseberg zum ersten Mal überhaupt in der schwarz-roten Regierungszeit mit der Frage, ob langfristig ein Punktesystem zur Steuerung der Einwanderung sinnvoll wäre. Wie die taz aus Regierungskreisen erfuhr, soll nun ein "Arbeitsauftrag" an die zuständigen Ministerien erteilt werden. Vizekanzler Franz Müntefering und andere SPD-Politiker sprachen sich bereits für ein Punktesystem aus.
Damit greifen sie einen alten Vorschlag der Zuwanderungskommission von Rita Süssmuth aus dem Jahr 2000 auf. Die Expertenrunde hatte der damaligen rot-grünen Regierung bereits zur Einführung eines Punktesystems geraten. Der Vorschlag orientiert sich an dem Vorbild klassischer Einwanderungsländer wie Kanada.
Das Modell sähe, auf Deutschland angewandt, in etwa so aus: Grundsätzlich können Ausländer aus der ganzen Welt nach Deutschland kommen - auch aus Nicht-EU-Ländern. Sie müssten kein konkretes Jobangebot in Deutschland vorweisen, aber einen Test bestehen. Die wichtigsten Kriterien sind Integrationsfähigkeit und Nützlichkeit für den deutschen Arbeitsmarkt. Punkte gibt es, wenn ein Ausländer Sprachkenntnisse vorweisen kann oder eine Berufsausbildung hat, die in Deutschland in absehbarer Zeit gefragt ist.
Das Punktesytem ist also keineswegs ein Gutmenschenprojekt zur Öffnung der Grenzen. Seine Befürworter sehen es vielmehr als pragmatischen Weg, um auf die demografische Entwicklung mit dem vorhersehbaren Bevölkerungsrückgang in Deutschland zu reagieren.
Eigentlich würde das Punktesystem bestens zu der Parole passen, die der CSU-Politiker Günther Beckstein vor Jahren ausgab ("Wir brauchen mehr Ausländer, die uns nützen"). Trotzdem lehnte die Union das Punktesystem bei den Zuwanderungsverhandlungen mit Rot-Grün kategorisch ab. Sie sah darin das Eingeständnis, dass sich Deutschland als Einwanderungsland versteht - und das ging ihr zu weit. Auch jetzt noch sperren sich die Innenpolitiker von CDU und CSU vehement dagegen. "Schon das Wort Punktesystem ist für viele bei uns politisch verbrannt, weil es damals von Rot-Grün und Süssmuth kam", sagte ein CDU-Regierungspolitiker der taz. Damit die Innenpolitiker ihren Widerstand aufgeben, müsste Merkel ihre ganze Autorität einsetzen - und "einen neuen Namen" finden.
So wird es in Meseberg wohl erst einmal kleinere Korrekturen der Einwanderungsregeln geben. Wenn ein Arbeitgeber gut qualifizierte Migranten einstellen möchte, soll nicht mehr so umständlich und bürokratisch wie bisher geprüft werden, ob für den Arbeitsplatz auch Deutsche zur Verfügung stehen, kündigte Bildungsministerin Annette Schavan (CDU) an. Außerdem soll die Beschränkung der Freizügigkeit für Bürger aus den neuen, osteuropäischen EU-Staaten teilweise aufgehoben werden - aber nur für speziell ausgebildete Fachleute, die besonders dringend gebraucht werden. Über die genaue Definition wurde am Donnerstag noch beraten.

