Netze: EU will Energieriesen entmachten
Um Strom billiger zu machen, will Brüssel die Konzerne zum Verkauf ihrer Netze zwingen. Doch Deutschland und Frankreich protestieren.
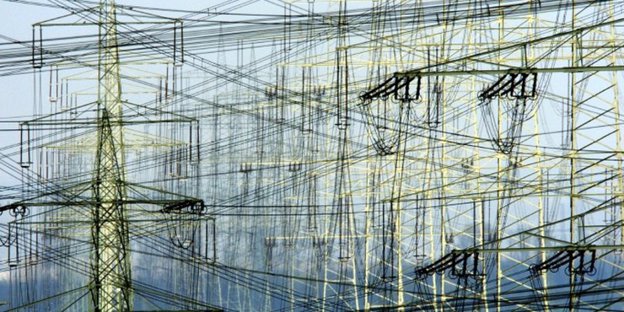
EU-Kommission lässt Konzernen ein Schlupfloch: RWE-Starkstromleitungen Bild: dpa
Die EU-Kommission will Strom- und Gasproduzenten zwingen, ihre Leitungsnetze zu verkaufen. Für deutsche Energieriesen wie RWE oder Eon würde das bedeuten, dass sie sich von ihren in Tochtergesellschaften ausgegliederten Netzen trennen müssen. Allerdings lässt die Kommission in ihrem gestern vorgelegten Gesetzentwurf ein Schlupfloch: Wenn ein Konzern sein Netz nicht verkaufen will, kann er auch einen unabhängigen Verwalter (Systemoperator) einsetzen. Der soll dafür sorgen, dass die Leitungen für andere Anbieter offen sind und Geld für die Instandhaltung fließt.
Eine neue EU-Agentur soll sicherstellen, dass die nationalen Regulatoren gut zusammenarbeiten. Auch um die Beseitigung der Schwachstellen beim Übergang von einem nationalen Netz ins andere soll sich die Behörde kümmern. Das neue Amt werde nur 7 Millionen Euro jährlich kosten und 40 bis 50 Mitarbeiter beschäftigen, verteidigte Energiekommissar Andris Piebalgs den Plan. Gemessen am Umsatz der Energiebranche von mehr als 150 Milliarden Euro, sei das wenig.
Staatsunternehmen wie die französische EDF müssen keine Zwangsprivatisierung fürchten. "Die EU-Verträge verbieten es, einem Mitgliedsland Eigentumsverhältnisse vorzuschreiben", erklärte ein Experte aus Piebalgs Stab. Künftig müssen nur zwei formal unabhängige Unternehmen gebildet werden, die getrennten Aufsichtsbehörden unterstehen.
"Eine Entflechtung wäre für eine ganze Reihe von Stromerzeugern existenzbedrohend", hatte Frankreichs Exumweltminister Alain Juppé im Juni auf dem Treffen der Energieminister in Luxemburg gewarnt - und damit eine Botschaft von Staatspräsident Nicolas Sarkozy weitergereicht. Doch die Brüsseler Pläne gehen einigen Regierungen immer noch zu weit. Die französische Wirtschaftsministerin Christine Lagarde erklärte, ihre Regierung lehne die völlige Entflechtung von Stromerzeugern und Netzbetreibern ab. Das nun folgende Gesetzgebungsgerangel zwischen Rat, Europaparlament und Kommission wird vielleicht erst Ende 2008 unter französischer Ratspräsidentschaft abgeschlossen; frühestens 2011 tritt das Paket in Kraft.
Kommissionspräsident Manuel Barroso macht kein Geheimnis daraus, dass ihn die Doppelzüngigkeit der Regierungen erzürnt: "Beim Märzgipfel sprachen sich alle Mitgliedsstaaten für einen offenen, wettbewerbsfähigen Strommarkt mit Chancen für erneuerbare Energien und Wahlfreiheit für den Verbraucher aus." Die dafür nötigen gesetzlichen Schritte wollen viele nun aber nicht mitgehen. Joachim Würmeling, früher Europaabgeordneter und jetzt Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, sieht neben Frankreich und Deutschland sieben Mitgliedsländer in Opposition zum vorgeschlagenen Energiepaket, darunter Österreich, Bulgarien, die Slowakei und Lettland.
Dabei müssten gerade baltische Staaten wie Lettland großes Interesse an dem Gesetz haben, um sich aus der Abhängigkeit von Lieferanten wie der russischen Gazprom zu befreien. Der Kommissionsvorschlag beinhaltet auch strenge Auflagen für Energielieferanten aus Nicht-EU-Ländern.Wenn sie sich ins europäische Netz einkaufen wollen, dürfen auch sie nicht gleichzeitig Mehrheitseigner eines Stromerzeugers und eines Netzes sein. Zusätzlich muss ihr Herkunftsland ein Abkommen unterzeichnen, in dem es sich zur Einhaltung der europäischen Spielregeln verpflichtet. Diese Klausel dürfte dafür sorgen, dass sich zu den Kritikern von der CDU/CSU ein alter Sozialdemokrat gesellt: der Gazprom-Lobbyist und sozialdemokratische Exbundeskanzler Gerhard Schröder.


