Alternativen für WM-Muffel: Big Apple Bike
Es muss nicht immer Fußball sein. Aber Radfahren durch den Großstadtdschungel ist auch nicht unbedingt zu empfehlen – schon gar nicht in Manhattan.

B ei mir ist es lange her, dass ich mir eingebildet habe, dass mein Sport, das Radeln, unpolitisch ist. So ziemlich genau 20 Jahre. Damals bin ich von München nach New York gezogen. Im oberbayerischen Postkartenidyll war das Fahrradfahren am Wochenende unschuldiges Freizeitvergnügen. Doch in New York merkte ich schnell, dass jede Ausfahrt, gleich ob es über die George-Washington-Bridge den Hudson hinauf ging oder den Broadway hinunter zum Kino ins Village, ein politischer Akt ist.
Manhattan ist einer der am dichtesten besiedelten Flecken der Welt. Kaum sonstwo ist Platz ein so kostbares Gut. Und so mussten die Radfahrer, als sie in den siebziger Jahren anfingen, sich in der automobilisierten Metropole etwas Raum zu erobern, von Anfang an um jeden Zentimeter kämpfen. Mittlerweile sind große Fortschritte gemacht worden.
Der ansonsten umstrittene Bürgermeister Bloomberg hat Tausende von Kilometern an Radwegen angelegt und das beste Bike-Share-Programm etabliert, das ich je in einer Großstadt erlebt habe. Doch die Kämpfe gehen weiter. Die Anzahl der Radler steigt unproportional, die Infrastruktur bleibt ungenügend.
Proteste für sicheres Radeln
Die Zahl der Verkehrsopfer bleibt ebenso inakzeptabel wie die Gleichgültigkeit von Polizei und Justiz. Das hat zu Protesten geführt. Es gibt seit Jahrzehnten die Critical Mass Rides, die sogar bis nach Berlin geschwappt sind. Es gibt eine Lobby namens „Transportation Alternatives“. Und in den vergangenen Jahren wurden bei jedem tödlichen Zusammenstoß Die-ins vor dem Rathaus veranstaltet.
Während der Pandemie ist nun eine ganz neue Gruppe auf den Straßen New Yorks aufgetaucht. Wie man heute weiß, waren sie schon lange da, sie sind nur zum ersten Mal der breiten Öffentlichkeit aufgefallen: die wilden Pulks schwarzer Jugendlicher, die auf gepimpten Mountainbikes mitten auf dem Broadway oder sogar auf der Stadtautobahn an der Westseite wilde Tricks vorführen. Die Fahrten nennen sich Rideouts, die Subkultur hat das Hashtag #Bikelife, ihr Motto lautet „We Outside“.
Warum das politisch ist? Die Kids, meist aus Gettobezirken wie Bronx oder Harlem, reklamieren Raum im reichen kommerziellen Herzen von New York. Sie brechen aus den Bezirken aus, in welche jahrzehntelange rassistische Wohnungspolitik sie verbannt hat, und zeigen mit martialischen Gesten Präsenz. Und den Einschüchterungsversuchen der Polizei trotzen sie selbstbewusst. Nach einer Nacht im Gefängnis sitzen sie am nächsten Tag wieder im Sattel.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
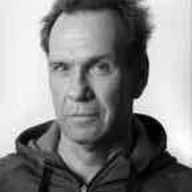




Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!