Foodwatch-Studie zur Tierhaltung: Krank im Stall
Ein Viertel der tierischen Lebensmittel kommt von kranken Nutztieren, sagt die Verbraucherorganisation Foodwatch. Veterinäre bezweifeln das.
Demnach macht mindestens jede zweite Milchkuh einmal im Jahr Krankheiten wie Lahmheit oder Fruchtbarkeitsstörungen durch, die durch die Haltungsbedingungen verursacht würden. Rund 10 Prozent der Milch stamme von einer Kuh mit entzündetem Euter. Schlachthofbefunden zufolge habe ungefähr die Hälfte der Schweine beispielsweise an chronischen Gelenkerkrankungen oder Organveränderungen gelitten. Statistisch gesehen sei zudem mindestens jedes vierte Hähnchen vorher ein krankes Tier etwa mit Brustbeinschäden gewesen. 40 Prozent der Eier seien von einer Henne mit Knochenbrüchen gelegt worden, die der Kalkmangel infolge des ständigen Legens verursacht.
Laut Foodwatch gibt es weder zwischen konventioneller und Biohaltung noch zwischen kleinen und großen Betrieben signifikante Unterschiede. Entscheidend sei vielmehr, wie gut der Viehhalter die Tiere betreue.
„Die Tiere werden nicht geschlachtet, wenn sie akut krank sind. Wir reden jetzt nicht über gesundheitliche Risiken für die Verbraucher, also nicht über bakteriologische, virologische und sonstige Geschichten“, erläuterte Wolfschmidt, der Veterinärmedizin studiert hat. Solche Schlachtkörper würden bei der Fleischbeschau aussortiert. Stattdessen gehe es zum Beispiel um Rinder, die etwa Lungen- und Leberentzündungen überstanden haben. „Da werden die betroffenen Organe verworfen, und das Fleisch wird natürlich verwendet.“ Dahinter stehe ein massives Tierschutzproblem.
Milch von kranken Kühen?
Der Bundesverband Praktizierender Tierärzte bezweifelt aber insbesondere die Behauptung, dass massenhaft Milch von kranken Kühen in die Lebensmittelkette gelange. „Das ist schlicht und einfach verboten“, sagte Verbandspräsident Siegfried Moder der taz. Denkbar sei allenfalls, dass Milch aus einem Euter verkauft wird, das beispielsweise 5 bis 6 Tage nach einer Erkrankung eine erhöhte Zahl körpereigener Zellen aufweise. Eine Zellzahl von über 400.000 kann eine Entzündung bedeuten. Da diese Milch aber mit der anderer Kühe gemischt werde und die Zellzahl von den Molkereien kontrolliert werde, bestehe keine Gefahr für die Verbraucher. „Wenn ich von einem kranken Euter spreche, brauche ich eine Diagnose und Entzündungssymptome, die ich bei 400.000 Zellen nicht unbedingt habe“, so Moder.
Dass Biotiere nicht gesünder sind als konventionelle, hatte Ute Knierim, Professorin für Biotierhaltung der Universität Kassel bereits im April in der taz festgestellt. Sie wies allerdings auch darauf hin, dass beispielsweise Schweine in Ökobetrieben ihre natürlichen Bedürfnisse besser ausleben könnten. Diese Tiere hätten unter anderem mehr Platz im Stall und bekämen Auslauf.
„Wer in den Bauern einfach Tierquäler sieht, liegt falsch“, sagte Wolfschmidt. Die Tierhalter seien Opfer eines Systems, das falsche Anreize setze. „Vor allem der Handel ist verantwortlich für einen Wettbewerb, der sich nicht um Qualität, sondern nur um den Preis dreht – das kann nur zulasten von Tieren, Bauern und letztlich auch Kunden gehen.“ Die „Tierwohl“-Initiative der Supermarktketten hält er nur für Kosmetik. Die Initiative bezahlt Bauern unter anderem dafür, dass sie ihren Tieren etwas mehr Raum geben.
Stattdessen müsse die EU eine tiergerechte Haltung etwa mit mehr Platz vorschreiben, auch für Importe aus Drittstaaten. Wie viele Tiere an haltungsbedingten Krankheiten leiden, solle für jeden Betrieb erfasst werden. Jeder müsse Standards einhalten, die sich von den Werten der besten Betriebe ableiten. „Die Mehrkosten müssen am Ende wir Verbraucher bezahlen, denn wir schulden Tieren eine bessere Behandlung“, forderte Wolfschmidt.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






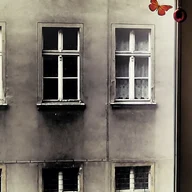

meistkommentiert
Digitale Urlaubsplanung
Der Buchungswahn zerstört das Reisen
Linke zu AfD-Verbot
Mutige Minderheitenmeinung
Militärhistoriker über Kriegstüchtigkeit
„Wir brauchen als Republik einen demokratischen Krieger“
Klimabilanz der Nato
Aufrüstung führt zu CO2-Emissionen
+++ Nachrichten im Nahost-Konflikt +++
„Werden jüdischen israelischen Staat im Westjordanland errichten“
Schutz von Sinti und Roma
Neue Regierung verzichtet auf Antiziganismus-Beauftragten