US-Footballspieler Colin Kaepernick: Sitzenbleiben gegen Rassismus
Footballspieler Colin Kaepernick steht bei der US-Hymne nicht auf, um gegen Rassismus zu protestieren. Nirgends provoziert das mehr als in der NFL.
Schließlich fühlte sich auch Donald Trump bemüßigt, Colin Kaepernick die Meinung zu sagen. Der eine ist Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Der andere ist Footballspieler der San Francisco 49ers. „Schrecklich“, findet es Trump, wie sich Kaepernick verhalten habe. Er solle sich „doch ein anderes Land suchen, in dem es ihm besser gefällt“.
Trump mag nicht die Mehrheit der US-Amerikaner vertreten, aber allein steht der notorische Lautsprecher mit seiner Meinung beileibe nicht. So findet der Präsident der Polizeigewerkschaft von San Francisco, ein gewisser Martin Halloran, Kaepernick sei „dämlich“, „peinlich“ und „schlecht beraten“. In Zeitungskommentaren und sozialen Medien wurde dem Sportler nahegelegt, er solle seine US-Staatsbürgerschaft zurückgeben, und gemutmaßt, Kaepernick habe Verbindungen zu den Attentätern des 11. September.
Warum die ganze Aufregung? Vor dem Vorbereitungsspiel der 49ers am vergangenen Freitag gegen die Green Bay Packers hatte es Ersatz-Quarterback Kaepernick gewagt, beim Abspielen der Hymne nicht – wie allgemein üblich – stramm zu stehen und die linke Hand aufs Herz zu legen. „Ich werde nicht aufstehen für ein Land, in dem Schwarze unterdrückt werden“, begründete er sein Sitzenbleiben auf der Bank. „Das Ganze ist wichtiger als Football, und es wäre selbstsüchtig, wenn ich wegsehen würde. In den Straßen liegen Leichen und es gibt Leute, die mit Mord davon kommen.“
Kaepernicks größte Leistung bislang war eine sportliche: Vor dreieinhalb Jahren verlor er mit den 49ers unglücklich einen der spektakulärsten Superbowls der Football-Geschichte. Nun katapultierte sich der 28-Jährige mitten hinein in die aktuelle Diskussion über Polizeigewalt und Rassismus, die in den USA nach mehreren tödlichen Übergriffen und zum Teil gewalttätigen Protesten geführt wird.
Zur Thematik geäußert haben sich schon viele bekannte Sportler: NBA-Profis trugen zum Aufwärmen Protest-T-Shirts, Stars wie Kobe Bryant oder LeBron James engagieren sich für die Black-Lives-Matter-Bewegung und Serena Williams hob nach ihrem Sieg in Wimbledon im Gedenken an die Black Panther die linke Faust.
Selbstverständnis des Profifootballs in Frage gestellt
Doch niemand provozierte dermaßen erregte Reaktionen wie Kaepernick. Das hat auch damit zu tun, dass keine Profiliga in den USA ein dermaßen enges Verhältnis zum Militär pflegt wie die NFL. Rituell röhren vor nahezu jedem Spiel Kampfjets übers Stadion, riesige Stars-and-Stripes-Banner werden übers Feld getragen, in der Halbzeitpause werden rührende Wiedersehensszenen zwischen von Auslandseinsätzen zurückkehrenden Soldaten und ihren Angehörigen inszeniert.
Die NFL hat es geschafft, sich ein patriotisches Image zu geben, dass sie bisweilen auch dazu benutzt, die wachsende Kritik an ihr, die sich vor allem auf die gesundheitlichen Risiken des Sports konzentriert, abzuwehren. So gesehen rührt Kaepernicks Protest nicht nur an einen besonders empfindlichen Punkt der amerikanischen Seele, sondern stellt auch das Selbstverständnis des Profifootballs in Frage, der sich als nur leicht zivilisierte Form des Krieges inszeniert: Die Generäle an der Seitenlinie schicken behelmte Krieger in eine Schlacht, in der es um Raumgewinn geht. Und Soldaten sollen gefälligst keine eigene Meinung haben.
Empfohlener externer Inhalt
Aber Kaepernick hat auch Unterstützer gefunden. „Er nutzt seine Rechte und er spricht die Wahrheit aus“, sagte Ex-Football-Profi und Schauspieler Jim Brown, eine Ikone der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Auch viele andere Sportler und Kommentatoren finden, Kaepernick hätte sich zwar der US-amerikanischen Flagge gegenüber respektlos verhalten, halten seine Kritik aber für berechtigt.
Und vom bekanntesten seiner Kritiker hat Colin Kaepernick eh keine gute Meinung: Donald Trump sei „offen rassistisch“. Diese Bemerkung hat übrigens noch keinen großen Widerspruch hervor gerufen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






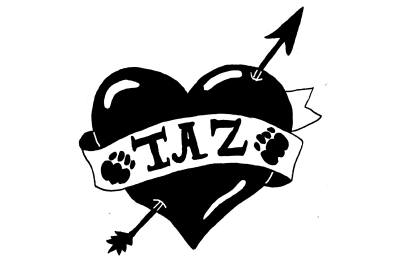
meistkommentiert