Sterbehilfe von Ärzten: „Sie hängen an einem Rest von Leben“
Soll ein Arzt beim Sterben helfen? Auf keinen Fall, sagt der Palliativmediziner Georg Maschmeyer. Ein Gespräch über das Problem mit dem letzten Willen.
taz: Herr Maschmeyer, Sie leiten eine Klinik, in der schwerstkranke Patienten behandelt werden, viele von ihnen am Lebensende. Wie vielen Menschen haben Sie als Arzt beim Sterben geholfen?
Georg Maschmeyer: Bei uns wird täglich gestorben. Wir behandeln Menschen, die an Krebs, Leukämien und anderen schweren Bluterkrankungen leiden. Viele dieser Menschen können nicht geheilt werden. Es gibt einen Zeitpunkt, an dem die Bemühungen, die Krankheit zurückzudrängen, für uns Ärzte nicht mehr vertretbar sind, weil die Aussichten auf Erfolg so gering sind, dass die Nebenwirkungen alles dominieren.
Wir konzentrieren uns dann darauf, die Auswirkungen der Krankheit zu bekämpfen, also Atemnot, Verstopfung, Schmerzen, Angst oder Übelkeit, aber nicht mehr die Krankheit selbst. Ich mache das seit 1981. Persönlich beim Sterben begleitet habe ich sicher einige hundert Menschen. Eine aktive Lebensbeendigung, indem ich jemandem eine Spritze gegeben oder eine Pumpe hochgefahren habe, damit er aufhört zu atmen, habe ich aber natürlich noch nie gemacht.
Warum „natürlich“ nicht?
Weil die Tötung auf Verlangen in Deutschland verboten ist. Weil sie dazu führt, dass man bestraft wird und seine Zulassung verliert.
Aber wenn es erlaubt wäre, könnten Sie es sich vorstellen?

Seine Mutter liegt im Wachkoma. Er möchte sie erlösen. Also beschließt Jan, sie zu töten. Die Geschichte über die Grenzen der Sterbehilfe lesen Sie in der taz.am wochenende vom 28. Februar/1. März 2015. Außerdem: Unser Fotoreporter betrinkt sich mit Chinesen. Ein Jugendlicher erklärt Erwachsenen die Welt. Und: Das Erzbistum Köln legt seine Finanzen offen. Aber entsteht dadurch echte Transparenz? Am Kiosk, eKiosk oder gleich im praktischen Wochenendabo.
Nein! Schauen Sie, im Regelfall kommen Patienten zu uns, die ausgesprochen schwer leiden und intensiv palliativmedizinisch betreut werden müssen. Anschließend können sie häufig zurück gehen, nach Hause, in ein Pflegeheim, ins Hospiz. Das ist die Regel. Die Ausnahme gibt es aber auch.
Es kommt vor, dass Patienten im Moment der Aufnahme so verzweifelt und so gequält sind, dass sie sagen: ‚Jetzt geben Sie mir endlich eine Spritze, damit das aufhört!’ Es ist ein schwieriger Punkt, weil man sieht, wie unglaublich sie leiden, und es wäre ein Leichtes, ihnen eine solche Spritze zu geben…
59, ist Leiter einer Potsdamer Palliativklinik. Er sitzt im Ausschuss für ethische und medizinisch-juristische Grundsatzfragen der Bundesärztekammer.
…aber?
Sobald wir die akuten Beschwerden beseitigt haben, ist dieses Verlangen zu sterben innerhalb von Minuten bis Stunden weg. Es wird abgelöst durch den Wunsch, weiter zu leben. Und zwar auch in einem Zustand, den diese Patienten sich vielleicht noch vor ein paar Wochen so nicht hätten vorstellen können. Sie hängen plötzlich an einem ganz kleinen Rest von Leben.
Das gilt selbst für diejenigen, die einen festen religiösen Glauben haben, dass nach dem Tod noch etwas passiert, und auch für diejenigen, die eine Patientenverfügung auf dem Nachttisch liegen haben, in der etwas ganz Anderes steht. Genau das ist der Konflikt. In der Akutsituation wollen die Patienten zu 90 Prozent nicht, was sie da geschrieben haben. Und dann müssen wir Ärzte herausfinden, was im Moment ihr tatsächlicher Wunsch ist.
Angenommen, der Todeswunsch des Patienten bleibt dennoch stabil und er bittet Sie mehrfach, ihm ein todbringendes Medikament zu überlassen, was derzeit in Deutschland strafrechtlich nicht verboten ist. Helfen Sie ihm?
Das sind diese konstruierten Fälle aus den Talkshows. Ein solcher Fall ist mir in 33 Jahren Berufspraxis nicht vorgekommen. Die Menschen wollen vielleicht sterben, aber sie wollen sich nicht selbst das Leben nehmen. Sie wollen, dass der Arzt das für sie erledigt.
Jetzt sage ich Ihnen aber, ich schlucke das Medikament selbst, und Ihnen passiert strafrechtlich gar nichts. Was tun Sie?
Ich würde es nicht machen, das kann ich sicher sagen. Es wird von uns Ärzten zu Recht erwartet, dass wir alles dafür tun, Leben zu erhalten und nicht darüber nachzudenken, wie wir es beenden können.
Der Patientenwille hat Grenzen?
Es geht nicht um Bevormundung oder darum, den Moralapostel zu geben. Diejenigen Menschen, die uns darum bitten, ihnen ein Medikament zu überlassen, sind keine Sterbenden. Sie wollen vorbeugen für einen Zeitpunkt X. Im Übrigen wissen wir, dass 90 Prozent der Menschen mit Suizidwunsch psychische Krankheiten haben.
Empirische Daten aus dem US-Bundesstaat Oregon, wo ärztlich assistierter Suizid legal ist, zeigen doch aber gerade, dass allein die Möglichkeit, mit dem Arzt offen über Sterbehilfe sprechen zu können und für den Notfall über einen Medikamentenvorrat zu verfügen, häufig Selbsttötungen verhindert.
Ich würde diese Oregon-Daten sehr skeptisch interpretieren. Von den Betroffenen, die tatsächlich ärztlich assistierten Suizid begangen haben, haben 60 Prozent als Grund angegeben, anderen nicht zur Last fallen zu wollen. Über 90 Prozent haben gesagt, sie wollten nicht länger auf Hilfe angewiesen sein. Und nur knapp 30 Prozent haben gesagt, sie hätten Angst vor unerträglichen Schmerzen. Was aber noch bedrückender ist, ist, dass von den Betroffenen aus Oregon 86 Prozent einsam und allein gestorben sind, irgendwo in einem Heim. Das ist kein Ausdruck von Entscheidungsfreiheit. Das ist ein Ausdruck von Elend.
Die Frage nach der Zulässigkeit ärztlicher Beihilfe zum Suizid könnte 2015 zur zentralen bioethischen Debatte werden. Der Bundestag diskutiert mehrere Gesetzesentwürfe, wonach die bislang legale Beihilfe zur Selbsttötung verboten werden soll – möglicherweise auch für Ärzte. Ist das richtig?
Es geht in den meisten Entwürfen darum, dass man die gewerbsmäßig oder geschäftsmäßig betriebene, organisierte Suizidbeihilfe dubioser Sterbehilfevereine untersagen will, und auch die Werbung dafür. Das ist in Ordnung.
Im Zweifel würden sich Ärztekollegen, die anders denken als Sie, berufsrechtlich strafbar machen, wenn sie Menschen helfen, sich selbst zu töten.
Ich denke, das ist prinzipiell auch in Ordnung so. Nehmen Sie die Zahlen aus Holland und Belgien an, da sehen Sie, wohin eine Freigabe führen kann. In Belgien wurde das Gesetz, das Tötung erlaubt, in den letzten zehn Jahren 25 Mal ausgeweitet. In Holland sterben 2,8 Prozent der Menschen durch Euthanasie. Wenn die Gesellschaft sich einmal daran gewöhnt hat, dass so eine Möglichkeit besteht, dann öffnet das Tür und Tor. Es wird dann mit edlen Motiven argumentiert, aber tatsächlich wird eine Exit-Strategie eröffnet – für Menschen, die als soziale Belastung empfunden werden. Ich halte das für ethisch problematisch.
Das Dammbruch-Argument ist eine Unterstellung. In Deutschland diskutiert niemand die Legalisierung der Tötung auf Verlangen.
Mir macht das trotzdem Sorge. Wir müssen uns um die Schwächsten kümmern, anstatt zu sagen, es wäre ein Element der Freiheit, dass Patienten aus dem Leben scheiden können.
Medizinethiker wie Urban Wiesing und Ralf Jox oder der Palliativmediziner Gian Domenico Borasio argumentieren in einem eigenen Gesetzentwurf, Ärzten die Beihilfe zum Suizid untersagen zu wollen, sei unvereinbar sowohl mit der „Berufsausübungsfreiheit“ als auch mit dem „Grundrecht der Gewissensfreiheit des Arztes“. Irren sie?
Aus ärztlicher Sicht finde ich diesen Gesetzentwurf monströs. Er fordert, dass Ärzte, die Suizidhilfe leisten wollen, bestimmte Qualifikationen nachweisen, Pflichten erfüllen, zeitliche Abläufe einhalten müssen. Die Ärzte müssen sich zudem überzeugen von diesem und jenem, sie müssen Checklisten führen, ihre Tätigkeit dokumentieren und sie melden. Kurz: Ein Arzt soll qualitätszertifiziert sein für einen Vorgang, bei dem es sich um eine ethische Ausnahmesituation handelt. Für mich ist das ein Widerspruch in sich, denn das, was da gefordert wird, schreit nach professioneller Organisation.
Sie halten einen solchen Vorschlag für unvereinbar mit dem ärztlichen Ethos?
Ich sage ganz klar: Wir Ärzte haben schon jetzt alle Möglichkeiten, die wir brauchen, um Sterbenden legal zu helfen. Wir können Patienten ausreichende Mengen von Medikamenten verschreiben, auch für zu Hause und auf Vorrat. Wir können durch Entlastung von Wasser in der Lunge die Luftnot beseitigen, und wir können mit Medikamenten Schmerzen und Angst nehmen. Und wenn Menschen mit Beginn des Sterbeprozesses darüber hinaus unsere Hilfe brauchen, dann geben wir ihnen eine Sedierung und irgendwann auch eine Dauersedierung.
Das ist unsere tägliche Praxis. Sie erfolgt nicht im Graubereich, sondern sie entspricht den Grundsätzen der ärztlichen Sterbebegleitung der Bundesärztekammer. Sie ist uns nicht nur erlaubt, sondern wir sind verpflichtet, so zu handeln. Selbst wenn wir den Sterbevorgang damit verkürzen sollten.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






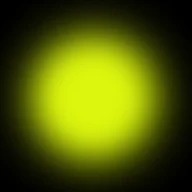
meistkommentiert
ACAB bei den Grüüünen
Wenn Markus Söder sein Glück nur in Worte fassen könnte
+++ Nachrichten im Nahost-Konflikt +++
„Werden jüdischen israelischen Staat im Westjordanland errichten“
Gregor Gysi im Interview
„Ich habe mir die Anerkennung hart erkämpft“
Ausnahme vom EU-Emissionshandel
Koalition plant weiteres Steuergeschenk für Landwirte
+++ Nachrichten im Nahost-Konflikt +++
Zahlreiche Tote bei israelischem Angriff in Rafah
Queere Bewegungen
Mehr als nur Glitzer