Die Fotografin Digne M. Marcovicz: Von Quick bis Heidegger
Ihre Schwester starb in Plötzensee, sie fotografierte die westdeutsche Kulturelite der Sechziger bis Achtziger: Digne M. Marcovicz im Sonntaz-Gespräch.
Sie sagt, sie könne alles ertragen, auch zur Gedenkstätte Plötzensee in Berlin zu fahren, wo ihre Schwester Cato Bontjes van Beek von den Nazis ermordet wurde. Digne M. Marcovicz, eine der führenden Fotografinnen Deutschlands, erzählt im sonntaz-Gespräch, wie ihre Eltern und sie selbst mit diesem Mord umgingen, während ihr Vater, ein bekannter Keramiker, ebenfalls in Gestapo-Haft kam, aber nach drei Monaten frei gelassen wurde.
„Darüber wurde mit uns Kindern nicht geredet“, sagt sie im Gespräch. „Ich kann mich nur daran erinnern, dass mein Vater und meine Mutter heulten. Ich konnte das nicht so richtig einordnen, aber ich dachte mir oder wusste, dass Cato tot ist. Als Kind ist man sehr vorsichtig, man lässt vieles nicht so nah an sich herankommen.“
Die frühere Pressefotografin, die rund 20 Jahre für den Spiegel gearbeitet hat, schildert die Gefahr, in der sie und ihre Familie in der NS-Zeit schwebte: „Es gab damals immer wieder Schwierigkeiten mit meiner Mutter, die ja jüdischer Herkunft war, was niemand so genau wusste. Außerdem war meine Mutter unvernünftig. Sie wollte nicht, dass ich zum Bund Deutscher Mädel gehe, und schrie rum: Geh doch nicht zu diesen Verbrechern! Ich wusste ganz genau: Darüber darf ich mit niemandem reden.“
Das ganze Interview mit Digne M. Marcovicz und viele andere spannende Texte lesen Sie in der sonntaz vom 12./13. April 2012. Am Kiosk, eKiosk oder gleich im Wochenendabo. Und für Fans und Freunde: facebook.com/sonntaz.
Neonazistisches Gedankengut sieht Marcovicz noch heute:„ Ich meine, Entschuldigung, wo leben wir? Es ist ja nicht so, dass die Nazis heutzutage NPD-Mitglieder sein müssen. Es gibt doch sehr viele Menschen mit neonazistischen Einstellungen.“
„Menschen Tiere, Sensationen“
Digne M. Marcovicz hat sich stets als Pressefotografin verstanden, die sich zwar für Persönlichkeiten aus dem Kulturleben besonders interessiert habe, aber auch einfach „Menschen, Tiere, Sensationen festgehalten“ habe. Ihr Einstieg in den Fotojournalismus lief vor allem über die damals bedeutende Quick: „Ich habe einen Redakteur der Quick so lange genervt, bis der sagte: Machen Sie mir doch den Sex der langen Haare. Ich habe mir dann hübsche Mädchen gesucht und fotografiert, und es gab zwei Doppelseiten in der Quick. Das einzige Problem war der Brustnippel, der bei einem der Mädchen zu sehen war, der musste wegretuschiert werden.“
Beim Spiegel wurden ihre Fotoarbeiten anspruchsvoller – regelrechte Ikonen wurden ihre Fotos von dem umstrittenen Philosophen Martin Heidegger auf seiner Hütte im Schwarzwald: „Ich war total aufgeregt und hatte danach schlaflose Nächte, weil ich glaubte, ich hätte das Landambiente nicht genügend festgehalten. Heideggers NS-Vergangenheit fand ich suspekt, aber seine Liebe zur Natur lag mir sehr.“
Von den Sechziger bis Achtziger Jahren fotografierte Digne M. Marcovicz praktisch alle, die in der Künstler-, Intellektuellen- und Kulturszene der Bundesrepublik Rang und Namen hatten: Literaten wie Günter Grass, Schauspielerinnen wie Hanna Schygulla und Filmemacher wie Alexander Kluge. Viele der von ihr Porträtierten sind heute nicht mehr am Leben: „Über die Fotografie kann ich sie dem Vergessen entreißen. Das ist etwas, was sehr wundersam ist und wofür ich sehr dankbar bin.“ In ihrer Berliner Wohnung voller Fotos von Toten versichert sie: „Ich finde es schön, dass ich sie um mich habe, und lebe mit ihnen.“
Im ganzen Gespräch in der sonntaz vom 12./13. Mai sagt Digne M. Marcovicz, dass ein Haus ja auch glücklich machen könne, wenn der Mann einen wegen einer Jüngeren verlassen hat. Sie berichtet, dass ihr Alexander Kluge schon früh versichert habe, ihrer beider Filme würden eben stets als nicht sendbar gelten. Und sie erklärt, warum Kinder einerseits heilig, anderseits schrecklich sind – vor allem die eigenen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





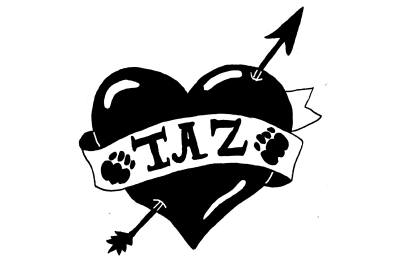
Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!