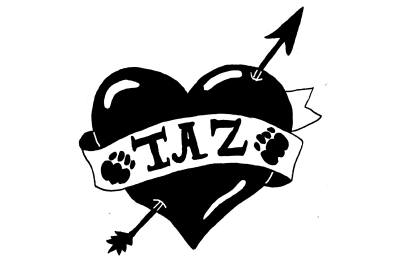: Strom gewinnen aus Wärmestrahlung
Thermophotovoltaik ermöglicht es Heizungen, gleichzeitig Strom und Wärme zu erzeugen. Doch die technischen Herausforderungen sind groß. Gelder für Forschungen sind rar, Durchbrüche derzeit kaum möglich. Weltweit arbeiten etwa 100 Wissenschaftler an den physikalischen Problemen
VON BERNWARD JANZING
Als im vergangenen November im Münsterland die Strommasten knickten, hätte Thermophotovoltaik vor kalten Wohnungen schützen können. Denn diese Technik ermöglicht es den Heizungen im Keller, gleichzeitig Strom zu erzeugen. Zwar ist die elektrische Leistung gering, und daher kaum zur Einspeisung ins Netz geeignet, aber sie reicht doch aus, um die elektrischen Komponenten des Heizsystems – also Pumpen und Steuerung – zu versorgen.
Die Theorie des Verfahrens ist reichlich unspektakulär. Spezielle Solarzellen im Ofen, die für hohe Temperaturen konzipiert sind, erzeugen Strom aus der vorhandenen Wärmestrahlung, dem infraroten Licht. Dass das nicht pure Fiktion ist, beweist bereits die Firma JX Crystals in Issaquah im US-Bundesstaat Washington. Seit 1999 hat das Unternehmen 30 Anlagen im Feldtest laufen. Es sind mit Propan gefeuerte Öfen mit jeweils 7,3 Kilowatt thermischer Leistung, die mittels Gallium-Antimonid-Solarzellen im Inneren bei der Feuerung 100 Watt Strom erzeugen. „Midnight sun“ heißen die Anlagen.
„Dort, wo es um geringe elektrische Leistungen geht, gibt es interessante Märkte für die Thermophotovoltaik“, weiß Jochen Bard, Leiter des Bereiches Energiewandlungsverfahren am Institut für Solare Energieversorgungstechnik (ISET) der Universität Kassel. Doch bis es so weit ist, gibt es noch viel zu forschen, denn der energetische Ertrag ist bislang gering. Der Systemwirkungsgrad, also die Stromausbeute in Relation zur eingesetzten Primärenergie, erreicht zumeist kaum zwei Prozent. Und das liegt auch daran, dass es nie größere Forschungsprojekte zu diesem Thema gab – und damit auch nie eine Forschergruppe in Europa, die sich Vollzeit mit Thermophotovoltaik (TPV) beschäftigte. Alle weltweit etwa 100 Wissenschaftler, die daran arbeiten, tun es nur nebenher.
Aus drei zentralen Elementen besteht eine Thermophotovoltaikanlage. An erster Stelle steht der Brenner, der die notwendige Wärme erzeugt. Solarthermisch erzeugte Wärme spielt derzeit in der Wissenschaft praktisch keine Rolle, weil andere Verfahren der Stromerzeugung aus Sonnenwärme erheblich energieeffizienter sind. So erreichen zum Beispiel Solar-Dish-Systeme, also Parabolspiegel mit Stirlingmotor, bereits elektrische Wirkungsgrade um 30 Prozent.
Darüber hinaus braucht man einen Emitter, dessen Aufgabe es ist, die Wärmeenergie aufzunehmen, und einen möglichst großen Teil in Form von Strahlung wieder abzugeben (also möglichst wenig durch schlichte Wärmeleitung oder Konvektion). Zudem sollte es ein selektiver Emitter sein, der seine Strahlung in einem eng definierten Wellenlängenbereich abstrahlt. In der Brennkammer wird das Bauteil angebracht.
Und schließlich braucht man eine Solarzelle, deren Wirkungsgrad bei der betreffenden Wellenlänge am größten ist. Emittersubstanz und Solarzelle müssen also optimal aufeinander abgestimmt sein. Drei Kombinationen von Emittersubstanzen und Zellentypen gelten heute als erfolgversprechend: Ein Emitter aus Ytterbiumoxid (Yb2O3) zum Beispiel, zusammen mit einer klassischen monokristallinen Siliziumzelle, wie sie heute gefertigt wird. Deren Wirkungsgrad ist am höchsten bei etwa 1.100 Nanometer Wellenlänge, und eben diese Strahlung sendet das Ytterbiumoxid aus.
Oder man nimmt einen Erbiumoxid-Emitter (Er2O3), wozu eine Gallium-Antimonid-Zelle (GaSb) passt, die im betreffenden Spektralbereich um 1.700 Nanometer die höchste Ausbeute erzielt. Und bei 2.200 Nanometer treffen sich die Eigenschaften des Holmiumoxid-Emitters (Ho2O3) und der Indium-Gallium-Arsenid-Zelle (InGaAs).
Mit Siliziumzellen arbeitet vor allem das Paul-Scherrer-Institut (PSI) in Villigen im Schweizer Kanton Aargau. „Die Zellen sind billig, in großen Mengen verfügbar und nicht toxisch“, sagt Forscher Wilhelm Durisch. Außerdem seien sie technologisch weit ausgereift. Entwicklungsbedarf gebe es hier noch bei den Emittern: „Da haben wir noch sehr schwierige Materialprobleme zu lösen.“ Denn einerseits müssen die Emitter zur Verbesserung der Effizienz möglichst stark erhitzt werden, andererseits reduzieren die hohen Temperaturen die Lebensdauer des Materials erheblich. Die Arbeit ist besonders schwierig, weil es noch an Grundlagenwissen fehlt: „Wir haben physikalisch noch nicht alles verstanden“, sagt der Forscher.
Mit dem Heizungsbauer Hoval in Vaduz in Liechtenstein arbeitet das PSI in dieser Sache zusammen. Der selbst versorgende Heizkessel sei eine der wichtigsten Optionen, sagt Durisch. Immer dort, wo kein Netzstrom zur Verfügung stehe, könne Thermophotovoltaik in Zukunft eine Option sein: „Dann sind die Menschen bereit, entsprechend für den Strom zu bezahlen.“ Denn Strom aus TPV-Systemen werde teuer bleiben – was bei einem Wirkungsgrad von 2,4 bis 2,8 Prozent, wie ihn Durisch aus seinem Hause vermeldet, nicht überrascht. Und dieser Wert sei immerhin Weltrekord.
Eines Tages könnten 15 Prozent möglich werden, schätzt Andreas Bett, Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg. Diesem Wert ein wenig näher zu kommen, hofft das ISE mit der Entwicklung neuer Hochleistungssolarzellen auf Basis der so genannten III-V-Halbleiter. Die Ziffern beschreiben dabei die Hauptgruppen im Periodensystem der Elemente; Gallium-Antimonid gehört dazu. Aber auch am ISE ist die TPV letztendlich nur ein Ableger anderer Forschungsaktivitäten.
So wird die internationale TPV-Forschung nur halbherzig betrieben. Und auch die Industrie zeigte schon mal mehr Interesse an der Technik, als sie es heute an den Tag legt. Bosch habe mal mit TPV experimentiert, und auch zwei Dissertationen dazu vergeben, erinnert sich ISE-Forscher Bett. Doch weitere Aktivitäten des Unternehmens blieben aus. Das liegt auch daran, dass Forschungsgelder rar sind. Zwar wird die Thermophotovoltaik derzeit im Rahmen des „Full-Spectrum“-Projektes der EU gefördert, das von der technische Universität Madrid koordiniert wird. Doch die bereitgestellten 8,3 Millionen Euro, verteilt auf fünf Jahre bis 2008, muss sich die TPV noch mit vier anderen Forschungsfeldern der Photovoltaik teilen. Durchbrüche sind damit derzeit kaum möglich.