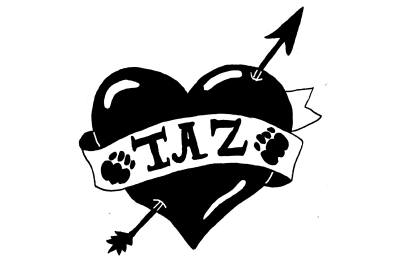: Im wilden Westen des Sudan
Krisenregion Darfur: Eine erfolgreiche Friedenspolitik hängt vor allem von der Gleichzeitigkeit der Entwaffnung aller Konfliktparteien ab. Und die ist fast unmöglich
Seit Monaten fordert die internationale Gemeinschaft von der Regierung des Sudan, die Janjaweed-Milizen im westsudanesischen Darfur zu entwaffnen. Diese Reitermilizen mit Pferden, Kamelen, Gewehren und Satellitenhandys, im Volksmund als Janjaweed („seelenlose Reiter“, Banditen) bezeichnet, sind für ihre rücksichtslose Brutalität gegenüber Zivilisten und Flüchtlingen berüchtigt geworden.
An Fortschritten ist bislang wenig zu erkennen. Dies liegt auch am Widerwillen und Zaudern des Sudan, wirkungsvolle Schritte zu tun. Die Uneinigkeit der internationalen Staatengemeinschaft, die sich trotz mangelnder Fortschritte nicht auf Sanktionen einigen kann, hat ihren Teil dazu beigetragen. Die Regierung in Khartum ist widerwillig, zaudert und taktiert, weil sie seit fast zwanzig Jahren nur noch über eine stark eingeschränkte Regierungsgewalt in Darfur verfügt.
Im Kampf gegen die Rebellen des Südsudan hatte sich die Regierung schon Mitte der 80er-Jahre mit Stammeskriegern in Süddarfur verbündet, die Murahiliin oder auch Popular Defense Forces genannt werden. Auch bei den Janjaweed handelt es sich um Freiwillige, in Milizen zusammengewürfelt. Zum Teil kaum militärisch formiert, ziehen sie als Stammeskrieger oder Banden schwer bewaffnet durch die Savanne. Diese Freiwilligen befinden sich in einer Art Bündnis mit Khartum. Sollte die Regierung an eine frontale Entwaffnung gehen und womöglich die Milizionäre noch zu Buhmännern erklären, liefe sie Gefahr, dass diese den Kontakt abbrechen, sich in die Savanne zurückziehen und sich weiter mit Gewalt nehmen, was ihnen ihrer Meinung nach zusteht.
Schwache Grenzkontrollen und verwandtschaftliche Bindungen machen es den Janjaweed zudem leicht, sich vor drohenden Zugriffen in den Tschad und in die Zentralafrikanische Republik abzusetzen – insbesondere denen, die aus diesen Ländern kommen. Dort sind sie nicht mehr greifbar, können aber jederzeit Streifzüge in den Sudan hinein unternehmen. Ohne Hilfe der Nachbarländer und des Rebellenführers John Garang im Südsudan sind flüchtende Milizen und Krieger nur schwer einzufangen.
Eine Entwaffnung könnte bestenfalls erfolgreich sein, wenn sie in Verhandlungen eingebunden wäre. Es ist deshalb sicherlich wichtig, Vertreter der Janjaweed formal in die Darfur-Gespräche einzubinden. Mehr noch: Die Regierung wird den Janjaweed etwas für ihre Sicherheit anbieten müssen. Viele von ihnen sind Nomaden. Generell hat Khartum für die Sicherheit von Nomaden nie viel ausgeben wollen. Deshalb haben sich viele selbst mit Waffen versorgt. Zusätzlich hat die Regierung ihnen Gewehre zur Selbstverteidigung überlassen, doch an diese Einschränkung haben sich die Empfänger nicht gehalten.
Der aktuelle Konflikt zeigt dies nur in seiner krassesten Form. Ohne eine mobile Polizei oder anderen Schutz für Nomaden dürften die Milizionäre und Krieger ihre Waffen kaum herausrücken. Unabhängig davon dürften die Janjaweed und weitere Nomaden darauf bestehen, dass die Entwaffnung im Gegenzug auch für die Milizen der bäuerlichen Kollektive gilt, die sich über die Jahre gebildet haben und den Kern der heutigen Darfur-Rebellion bilden. Die Opfer der Janjaweed sowie einige Nomaden würden dann wiederum auf eine Entwaffnung der Murahiliin-Milizen drängen, deren Mitglieder sich über die letzten Jahre Gefechte mit verwandten Nomaden und benachbarten Bauern lieferten.
Schießereien zwischen lokalen Milizen finden auch im Schatten des Hauptkonflikts weiter statt. Neben den Janjaweed-Milizen und den Darfur-Rebellen müssen noch zahlreiche weitere Gruppen entwaffnet werden – ein schwieriges Unternehmen, weil eine Gleichzeitigkeit der Entwaffnungen fast unmöglich ist und Ungleichzeitigkeiten neue Gewalt hervorrufen kann. Es dürfte Jahre dauern, und die Beteiligten würden einem solchen Prozess wahrscheinlich nicht trauen, so wie sich die Dinge in Darfur jetzt zugespitzt haben. Hinzu kommt, dass sie bereits brutale, einseitige und erfolglose Entwaffnungen durch den Staat kennen gelernt haben.
Die Regierung verfügt zudem über keine wirklich funktionsfähigen Sicherheitsorgane in Darfur, um eine solche Aktion umsetzen zu können. Polizei und Militär sind schlecht versorgt. In den Dörfern verfügen die wenigen Polizisten oft über nicht mehr als eine Uniform und ein altes Gewehr. Fatal ist auch, dass die Regierung ihre eigenen Sicherheitsorgane paralysiert hat. Die Milizen genießen faktisch Immunität. Ihre politischen Verbindungen reichen bis ins Zentrum der Macht. Viele Polizisten und Soldaten sind dadurch bereits eingeschüchtert und fürchten sich sogar vor den Milizen. Andere Sicherheitskräfte wiederum sympathisieren offen mit den Milizionären. Erfahrene lokale Mitarbeiter sind desertiert, weil sie keinen Sinn mehr in ihrer Arbeit sahen.
Im Juni rief Sudans Innenminister Polizei und Militär in Darfur zu mehr Initiative bei der Wiederherstellung der Ordnung auf. Die Verstärkung der Polizei in Darfur entspricht den Forderungen der Staatengemeinschaft und gilt als ein Schritt zur Befriedung der Region. Aber obwohl inzwischen mehrere tausend Polizisten den Dienst in Darfur aufgenommen haben, finden Überfälle auf Dörfer und Übergriffe auf Flüchtlinge weiterhin statt. Selbst wenn sich Polizei oder Militär in der Nähe befinden, gehen sie den Vorfällen kaum nach.
Gleichwohl gibt es Fälle, in denen lokale Soldaten und Polizisten Dörfer gegen Angriffe der Milizen verteidigt haben – sie haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Solche Beispiele dürften andere Polizisten kaum motivieren, zumal Khartum dazu schweigt. Andererseits fühlen sich Polizisten und Soldaten durch die Existenz eines faktisch rechtsfreien Raums ebenfalls ermuntert, Straftaten zu begehen, von willkürlichen Prügeleien und Raub bis zur Vergewaltigung. Die Sicherheitsorgane werden zunehmend unberechenbar. Die „Integration“ von Milizionären in Polizei und Militär dürfte dazu beitragen.
Ohne eine umfangreiche Reform von Polizei und Militär wird sich also Sicherheit in Darfur nicht wieder herstellen lassen. Andernfalls droht nicht nur eine Fortsetzung des Krieges, sondern auch eine Intensivierung der Kämpfe und deren Übergreifen auf den Tschad oder die mittelsudanesischen Provinzen Nord- und Westkordofan. Der Hauptkonflikt dürfte sich mit lokalen Konflikten vermischen, und die Raubüberfälle auf Lastwagen, Busse und humanitäre Transporte würden wegen der anhaltenden Versorgungskrise weiter zunehmen.
Doch auch die Reform der Sicherheitsapparate und die Entwaffnung der Janjaweed wären sicherlich nur ein erster Schritt in Richtung Frieden. Vielen Männern in Darfur erscheint das eigene Gewehr als die beste Lebensversicherung. Es wäre eigentlich nötig, auch diesen Teufelskreis zu unterbrechen, damit eine wirkliche Befriedung dieser Region doch noch möglich werden kann. JÜRGEN HART