Ausstellung „Hello Lübeck!“: Partizipation für alle
Werke anfassen und Wände bemalen erlaubt: Die neue Leiterin der Lübecker Kunsthalle St. Annen, Noura Dirani, spielt mit den Konventionen von Museen.

Gar nicht so leicht, auf Augenhöhe mit der Kunst zu kommen: Ahmet Öğüts mal wirklich partizipative Arbeit „Jump-up“ Foto: Felix König/54°
Von Mangel an Ambition kann man da wirklich nicht sprechen: Vom „Ort des lebendigen Austauschs“ war die Rede, als, spät im alten Jahr, eine Ausstellung in der Lübecker Kunsthalle St. Annen zur Eröffnung anstand: „Hello Lübeck!“ ist die überschrieben und läuft dort noch bis in den Juli. Mitte April wird ein erweiternder zweiter Teil eröffnet, auch das eine Form von Austausch. Mit dem „Hallo“ meint Noura Dirani, seit Oktober Chefin des Hauses, es erkennbar ernst: Die Kunsthalle soll sich öffnen – zur Stadt hin, zu den Menschen, für einen „Dialog mit der ganzen Gesellschaft“.
Warum der sinnvoll, ja: notwendig sein könnte? Vielleicht hat das damit zu tun, unter Lübecks Museen das eine ausdrücklich zeitgenössischer Kunst gewidmete zu sein. Dem mitunter hartnäckige Schatten werfenden Alten freilich lässt sich auch hier nicht entkommen: „Vor über 500 Jahren wurde hier die St.-Annen-Kirche gebaut. Daher hat die Kunsthalle auch ihren Namen“, so steht es in einer ebenfalls neuen Broschüre für Kinder. Darin erkunden die gezeichneten Figuren „Ki“ und „Ku“, eben, die laufende Ausstellung und ermutigen etwa dazu, sich Gedanken zu machen zu den Kunstwerken (und sie dann auch gleich aufzuschreiben): „Das war aber spannend! Was fandest du am tollsten?“
Nicht ganz nebensächlich, erklären Ki und Ku kleinen und nicht ganz so kleinen Besucher:innen auch gleich noch den Clou von „Hello Lübeck!“: Bei dieser Ausstellung darf Hand angelegt werden, also genau das, was normalerweise Pfui ist im Museum. Das beginnt schon beim Reinkommen: Im Foyer hat Andreas Angelidakis seine Arbeit „The Beach“ installiert, eine Ansammlung von Schaumstoff-Möbel-Modulen, Würfel, Säulen, auch ein paar Rundbögen, überzogen mit bedrucktem Kunststoff. Sie dürfen bewegt werden, rekombiniert, auch gestapelt und wieder umgeschmissen – das alles sollen die insgesamt 68 Elemente abkönnen.
Oder es lässt sich einfach eine temporäre Sitzecke daraus bauen, für eine hier verbrachte Mittagspause. Denn das ist die nicht ganz so offensichtliche Neuerung: Das St.-Annen-Foyer soll künftig wahrgenommen werden als „barrierefreier und kostenfrei zugänglicher ‚Open Space‘“, teilt die Kunsthalle mit, als „Treffpunkt und Ort des Austauschs für alle“ – und das eben auch über die Laufzeit von „Hello Lübeck!“ hinaus: „The Beach“ hat man für den dauerhaften Verbleib angekauft.
Knete und Eis
Die Ausstellung nun liefert immer noch ein paar konventioneller dargereichte, also bitte nicht zu befingernde Kunstwerke: Wem es etwa oben zu trubelig geworden ist, der:die kann im Untergeschoss bei sachte massagestudiotauglicher elektronischer Musik und wechselnd beleuchteten Metallobjekten, nun, chillen. Aber doch bitte Abstand halten von Tatjana Buschs Installation „Fuse“, die ist es nämlich, die da gerade gezeigt wird. Die üblichen Regeln, also: Abstand, Andacht vielleicht, gelten auch in der kleinen Abteilung, in der Artefakte aus anderen Lübecker Museen mit Zeitgenössischem in Dialog treten sollen: Das kann ein gemeinsames Motiv sein, muss aber nicht; es sind jedenfalls eher thematische, inhaltliche Verbindungen, die sich da aufspüren lassen.
Ausnahmsweise mal wirklich im Mittelpunkt stehen aber Angebote der Partizipation; erinnern Sie sich noch an dieses einstige Ausstellungsmacher:innen-, aber vielleicht vor allem Förderantragsteller:innen-Buzzword? Benjamin Butter ermutigt das Publikum gleich zum Bemalen von Wänden und Boden. Genauer: Er breitet großflächig Papier aus auf dem Boden eines Raumes und im unteren Bereich aller vier Wände und reicht dazu Wachsmalstifte.
Echter Sachbeschädigung wird also vorgebeugt, was bleibt, ist ein – durchaus im psychologischen Sinne regressiver – Bruch mit den Gepflogenheiten, die an so einem Ort sonst herrschen. Nicht jede:r, ist anzunehmen, wird es als pure Bereicherung empfinden, aus der passiven Betrachtendenrolle herausgebeten zu werden, das ist ein wenig wie mit allzu nahe kommenden Schauspieler:innen im vierte Wände einreißenden Theater.
Schon im Vorfeld hat der Künstler Christian Jankowski Kinder und Jugendliche aus Lübeck zu Mitwirkenden gemacht: Für „Kneaded City“ konnten sie sich selbst als Bestandteil einer fantastischen, vielleicht auch einer geträumten Stadt einerseits in Textform definieren: „Ich als Mülleimer für alles“, lautet dann die eher depressive Variante, „Ich als Denkmal zum Machen von Erinnerungsfotos“ lässt sich dagegen beinahe schon lesen als kritische Anmerkung zur – auch lokalen – Fremdenverkehrswirtschaft.
Und verbirgt sich in „Ich als Sportplatz für Trend-Mode außerhalb der Standardgrößen“ nicht ein ganzes antinormativ-politisches Programm? Zu diesen und weiteren solcher Minimal-Vignetten fertigten sie andererseits aber auch gleich noch eine entsprechende Knetfigur an, und beides wird nun ausgestellt.
Von Knete zu Wasserfarben: Verschiedenfarbige Eiswürfel hat die Künstlerin Stephanie Lüning angefertigt, für die verschiedenen Farben sorgen ausschließlich Pflanzenbestandteile, die sie in der unmittelbaren Umgebung gesammelt hat. Auf ein flaches rundes, mit Papier überzogenes Podest können die Besucher:innen nun so ein gefrorenes Ding legen – und zusehen, wie daraus allmählich ein runder Fleck wird.
Sie können sich währenddessen aber auch vom – ebenfalls von Lüning bunt gefärbten – Peddigrohr nehmen und mit den dünnen Pflanzensträngen zwei der in die Wand gebohrten Löcher verbinden – was ein wenig erinnert ans Verbindungen herstellende „Fräulein vom Amt“ im ganz frühen Telefonzeitalter. Die so nun nach und nach wie bunt überwuchert wirkenden Bohrungen ergeben übrigens das Wort „Hope“; um das zu lesen, braucht es aber etwas Abstand von der Wand.

Bester Dinge: Foyer-Installations-Künstler Andreas Angelidakis und Museumschefin Noura Dirani am Eröffnungsabend Foto: Felix König/54°
Streng genommen sind Lünings und Butters Mitmach-Arbeiten Teil der neu geschaffenen „Kinder-Kunsthalle“, die fortan fester Bestandteil von St. Annen sein soll, und das mag manche:r einleuchtend finden: Es hat ja doch etwas von Kunstunterricht. Gut möglich ist freilich auch, dass nicht alle Besucher:innen der Ansatz der Ausstellung insgesamt überzeugt: Wird das ehrwürdige Haus hier nicht zu einer Art Bällebad? Partizidingsbums, schön und gut – aber kommt am Ende die Kunst zu kurz?
Nun wird eine solche Wahrnehmung sich ja durch kein Argument aushebeln lassen: Wer aufs klassische Museums-Dispositiv abonniert ist, der:die muss wohl jede Abweichung davon als Schwächung, als Irrweg wahrnehmen. Freilich: Häuser, in denen so ein Mensch ohne eine einzige Irritation durch die Räume gelangen kann, weil alles ist, wie es immer war: Sie stellen immer noch die große Mehrzahl. Jeder Ennui angesichts von vermeintlich zu viel Dialog oder Partizipation ist doch zuallererst – geschmäcklerisch.
„Hello Lübeck“: bis 28. 7., Lübeck, Kunsthalle St. Annen
Eröffnung Teil 2, „Eine Ausstellung im Wandel“: Do, 11. 4.
In Lübeck brächte solches Ressentiment so eine:n Besucher:in zudem um die Beschäftigung mit einer wirklich relevanten Frage, nämlich: Wer bestimmt, was – und wen – wir im Museum sehen können? Eher didaktisch geht sie, im Erdgeschoss, Ahmet Öğüt an: Seine Fotoarbeit „Appointed Curators“ zeigt die wenig einladend vor der Brust verschränkten Arme nicht identifizierbarer Menschen; es sind Kurator:innen, also diejenigen, die darüber wachen, was Teil einer Ausstellung wird, was gezeigt wird und was im Depot bleibt.
Ebenfalls von Öğüt stammt dann eine Arbeit, die die Hürden auf dem Weg in den Ausstellungskanon und Fragen der Repräsentation maximal verbindet mit dem verspielten Mitmach-Ansatz der Ausstellung: „Jump-up“. Drei Bilder hängen da an der Wand, aber das so weit oben, dass, wer sie auf Augenhöhe haben möchte, Trampolin springen muss – davon stellt der Künstler drei in den Raum. Aber das zu tun, womöglich vor den Augen Fremder, das ist natürlich eine echte Herausforderung, nicht nur für Verfechter:innen des streng kontemplativen Kunstgenusses.



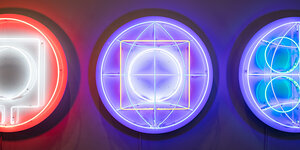


Leser*innenkommentare
Lowandorder
St. Annen - wo ich mit 13/14 kulturell die nächsten Schritte tat.
Immer gern unkonventionell vorne und das schon lange - herrlich.
unterm——aus dem Nähkästchen 🤫 -
25-Jährchen Abi-Treffen “Konzert in St.Annen - Mist ausverkauft wir waren zu spät!
Und ich sag - Paß auf - und Karl sitzt in der ersten Reihe - und hat nicht bezahlt!“
(Nickend. Bestritten mit Nichtwissen!;))