Politologe über „Degrowth“-Konzept: „Von Fixierung auf Wachstum lösen“
Die Degrowth-Bewegung diskutiert, wie eine Post-Wachstums-Ära aussehen kann. Effizienz reiche nicht, sagt der Politologe Norbert Nicoll.
taz: Herr Nicoll, Sie fordern, die Politik müsse sich vom Ziel des Wachstums verabschieden. Welche neuen Ziele braucht sie denn?
Norbert Nicoll: Die Politik sollte sich von der Fixierung auf das Wachstum lösen und am besten direkt bei den Stoffströmen und Umweltbelastungen ansetzen. Wir müssen runter mit den Emissionen, wir brauchen neue Instrumente, um Wohlstand zu messen, und wir müssen auf Waren und Dienstleistungen Preise vergeben, die in sozialer und ökologischer Hinsicht ehrlich sind. Nehmen wir den Verkehr: Fliegen ist zu billig, der öffentliche Verkehr dagegen oft zu teuer. Gegensteuern ließe sich mit Kerosinsteuern und mehr Mittel für den öffentlichen Verkehr. CO2-Emissionen lassen sich begrenzen, indem die Politik etwa die Vorgabe macht, dass sie jedes Jahr um 2 Prozent sinken müssen. Dann wäre man in 50 Jahren bei Null. Der Wandel der Wirtschaft würde kommen.
Auch eine Gesellschaft ohne Wachstum wird soziale Sicherungssysteme brauchen. Wie lassen sich diese finanzieren?
Wir müssen den Naturverbrauch verteuern, beispielsweise indem wir Ökosteuern erheben, die allerdings sozial gerecht auszugestalten sind. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Umverteilung. Es gibt enorme Vermögen. Konzerne müssen Steuern zahlen. Finanztransaktionen gehören besteuert, und Steuerparadiese müssen geschlossen werden.
Norbert Nicoll, Jahrgang 1981, ist Politikwissenschaftler und lehrt an der Universität Duisburg Essen.
In einer Gesellschaft ohne Wachstum zahlen Konzerne oder Banken kaum noch Steuern.
Es wird Branchen geben, die noch wachsen und auch Gewinne machen. Alles, was mit Energieerzeugung zu tun hat, mit Pflege, Bildung, Gesundheit, demografischem Wandel, Recycling, Effizienz – das sind Bereiche mit guten Zukunftsaussichten.
Die Bereiche Soziales, Bildung und Kultur werden nach dem heutigen Modell durch Steuereinnahmen und Renten finanziert, die durch die Produktivität unserer Wirtschaft entstehen. Woher nimmt man das Geld, wenn die Industrie schrumpft?
Da gibt es verschiedene Konzepte. Man muss aber ehrlich sein: Die Degrowth-Bewegung hat ein Endziel vor Augen, der genaue Weg dahin bleibt jedoch oft schwammig. Wirtschaft und Gesellschaft sind komplex. Den Stein der Weisen hat noch niemand gefunden.
Welche Rolle können Technologien wie die Biotechnologie oder die Digitalisierung spielen?
In einigen Technologien liegen sicherlich Potenziale, die Wirtschaft besser und gerechter zu machen. Das ist aber kein Selbstläufer, sondern muss auf jeden Fall durch den Gesetzgeber gesteuert werden.
Die Fraunhofer-Gesellschaft hat vor gut einem Monat ein Konzept vorgestellt, das sie „biologische Transformation“ nennt. Damit strebt sie Ziele wie Nachhaltigkeit oder eine Dezentralisierung der Produktion an – und will dafür Mittel der Technik einsetzen. Was halten Sie denn von diesem Ansatz?
Ich bin da skeptisch. Ich kann zwar nicht in die Zukunft blicken, aber ein Blick zurück in die Geschichte zeigt: Durch Technik sind oft Probleme entstanden, die Forscher vorher nicht gesehen haben. Zudem laufen die Kurven von Wirtschaftsleistung, Emissionen und Energieverbrauch fast parallel. Man hat die notwendige Entkopplung auf globaler Ebene trotz aller Effizienzbemühungen und neuer Technik in der Vergangenheit nicht geschafft.
Es ist interessant, dass sowohl Sie als auch die Forscher des Fraunhofer-Instituts Nachhaltigkeit und Dezentralisierung anstreben, trotzdem aber überhaupt nichts voneinander wissen wollen.
In der Tat laufen da zwei Debatten nebeneinander her, die total unverbunden sind. Da haben wir zum einen die Effizienzdebatte, die vor allem auf technologischen Fortschritt setzt und in Wirtschaft und Politik dominant ist. Sie passt sehr gut zur herrschenden Kultur und zum herrschenden ökonomischen Dogma. Was die Verfechter des Postwachstums sagen, steht dagegen quer zum herrschenden Modell. Beide Seiten stehen sich derzeit sprachlos gegenüber. Dabei ist klar: Mit Effizienz allein kommen wir nicht weiter, wir brauchen mehr Strategien, etwa die Konsistenzstrategie, das heißt, wir müssen in Kreisläufen wirtschaften; die Suffizienzstrategie, also das Leben im rechten Maß, sowie Resilienzstrategien, die uns weniger anfällig gegenüber Krisen und Schocks machen. Wir brauchen alle, eine Strategie allein wird nicht reichen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 40.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen






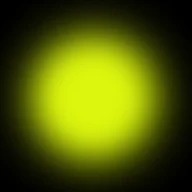




meistkommentiert
Ungerechtigkeit in Deutschland
Her mit dem schönen Leben!
Kompromiss oder Konfrontation?
Flexible Mehrheiten werden nötiger, das ist vielleicht gut
Eine Chauffeurin erzählt
„Du überholst mich nicht“
Niederlage für Baschar al-Assad
Zusammenbruch in Aleppo
Der Check
Verschärft Migration den Mangel an Fachkräften?
Kinderbetreuung in der DDR
„Alle haben funktioniert“