Der Siegeszug des Fahrrads in Utrecht: Die Rad-Megacity
Radfahren in Utrecht ist eine Art Besuch im Paradies. Erkenntnisse über die Autorepublik Deutschland gibt es gratis dazu.

Breite rote Bänder überall – die Häuser und Autostraßen scheinen in Utrecht nur dazu da, um den Raum zwischen den endlosen Radwegen auszufüllen Foto: Jochen Tack/imago
UTRECHT taz | Die gemeinsame Tour geht gleich mit einem Fehler los. „Sie fahren vor?“, frage ich. Ronald Tamse guckt etwas irritiert. Der 55-Jährige ist Utrechts Generalverkehrsplaner und Entwickler der Radinfrastruktur, seit 25 Jahren. In den Niederlanden, sagt er, fahre man selbstverständlich nebeneinander, „man will sich doch unterhalten, oder?“ Und er zeigt auf die vielen anderen ringsum. Klar, antwortet ertappt der Besucher aus dem Fahrrad-Drittweltstaat Deutschland und weiß sogleich, wie konditioniert er ist: Daheim müssen RadlerInnen immer aus dem Weg, auf die Seite, sich klein machen.
Breite rote Bänder überall – die Häuser und Autostraßen scheinen in Utrecht nur dazu da, um den Raum zwischen den endlosen Radwegen auszufüllen. Gleich geht es über einen zentralen Platz, Vredenburg. 35.000 RadfahrerInnen sind hier täglich unterwegs, erzählt Tamse, „im Durchschnitt“. Können also auch mal über 50.000 sein. Alle Radpisten sind immer sicher abgetrennt, mit eigenen Ampelanlagen, mit intelligenten Wegeführungen an komplexeren Kreuzungen, auch beim Linksabbiegen. Das funktioniert? „Die Schaltungen tüftelt ein Kollege aus. Ich halte ihn für einen Magier.“
Radwege planen und bauen, sagt Tamse, dürfe „keine Ideologie sein. Radwege sind ein Werkzeug.“ Er zeigt unterwegs mehrere umgebaute Kreuzungen und Wegeführungen, immer anders. Es komme jeweils auf die Gegebenheiten an, auf Fußgängerströme, und wie man Autos leite und wegleite: Mit anderen Straßenbelägen, weißen Strichen, etwas höher gelegten Parkplätzen neben der Fahrbahn und Begrenzungen, die nicht wie solche wirken. „Manchmal sind es kleine psychologische Tricks. Wir bauen ja alles für die Leute.“
Der weite Platz vor dem Dom ist eine Art shared space geworden. Radler und Fußgänger sind die eine Strömung, die wenigen Autos fahren wie von Geisterhand gelenkt einen Bogen, sehr langsam sowieso, weil ein paar runde, flache Steine in der Mitte stehen. „Man muss immer von den Menschen her denken, wer verhält sich wie?!“ Wieso hier überhaupt Autos fahren dürfen? Nur Lieferverkehr, Sonderausweise, sagt Tamse. Und grundsätzlich: „Man kommt auch in Utrecht mit dem Auto überall hin.“ Dann zeichnet er mit den Händen eine Art Labyrinth in die Luft. Heißt: Oft halt über verschachtelte Wege. Das ist zu komplex, also lassen es viele bald.
Anfahrt Nach Rotterdam, Amsterdam oder Arnheim ist man von Utrecht per Bahn in rund 30 Minuten (jeweils im 15-Minuten-Takt per IC). Die Städte sind auch mit Überlandradwegen verbunden, weitgehend kreuzungsfrei.
Rundradeln Die Stadt Utrecht empfiehlt die Polderroute und Schlösserroute.
Nazizeit Historisch erste Wahl ist die Liberation Route mit ihrem Zentrum in der Gegend östlich von Utrecht rund um Arnheim: Wie zäh die Befreiung der Niederlande 1944/45 (anders als Belgien) von den Nazis war, Stichwort: Schlacht von Arnheim. Die Liberation Route, entstanden in Holland, ist eine Ehrenamtler-Initiative der westeuropäischen Länder, Deutschland inklusive www.liberationroute.com/de
Radsport Einzige Stadt weltweit, die Startetappe war für die drei wichtigsten Rennen: Giro d´Italia, La Vuelta und Tour de France.
Radfahren ist Kultur
Auch die Niederlande waren mal Autoland, auch Utrecht war nach dem Krieg für Blechdosen vielspurig ausgebaut worden und zuasphaltiert. Dann passierte zweierlei fast gleichzeitig: die Ölkrise Anfang der 70er Jahre und heftige Proteste, vor allem in der City von Amsterdam: „Stoppt den Kindermord.“ Über 400 Kinder waren damals durch Autos zu Tode gekommen, jedes Jahr. Die Menschen wollten sichere Städte. Es begann also von unten.
Machen denn alle BürgerInnen heute alles mit? Na ja, sagt Tamse, „Menschen mit Angst vor Veränderung gibt es auch bei uns. Auch wir haben Nimbys.“ Nimby heißt: Not in my backyard. Ja, gerne die Stadt lebenswerter umbauen, aber nicht an Gewohnheiten und Bequemlichkeiten rütteln und meinen Parkplatz vor der Haustür lassen! „Aber das legt sich immer schnell“, sagt Tamse. „Radfahren ist bei uns Kultur, ein Sozialverhalten.“
Das kulturlose Deutschland hat drei schwere Lasten: Es ist Erfinderland des Automobils, hat eine fatale Schumacher-Vergangenheit und immer noch kein Tempolimit (Niederlande: tagsüber Tempo 100 auf Autobahnen). Eine Riege tatenloser deutscher Verkehrsminister tat ihr Übriges. Und es sei auch sonst manchmal seltsam in Deutschland, erzählt Tamse: Im Juli war er als Referent bei der Eurobike-Messe in Frankfurt. „Sie hatten mir ein Hotel ziemlich außerhalb gebucht, aber direkt an einer Autobahn-Auffahrt.“ Echt, die Radmenschen? „Ja, aber wahrscheinlich haben sie es gut gemeint. Und es gab auch eine Straßenbahn.“
In den Niederlanden, erzählt Tamse, radeln auch die Kinder des Königs, Ministerpräsident Rutte kommt zu Terminen auf dem Zweirad. Alle tun es, zumindest zeitweilig. Und weil alle wissen, wie es auf dem Rad ist, wissen auch alle beim Autofahren, wie sich die vor und neben einem fühlen und verhalten. Das macht das Miteinander kooperativer und sicherer. Einen Fahrradhelm trägt hier niemand.
Unter Magiern
Utrechts Zahlen sind spektakulär: 94 Prozent der Haushalte haben ein oder mehrere Fahrräder, insgesamt sind es in der 360.000-Einwohner-Stadt mehr als eine Million. Jeder 3. Haushalt hat kein Auto. Auf 1.000 EinwohnerInnen kommen 302 Autos, bei uns sind es 580. Knapp 60 Prozent der Utrechter fahren per Rad in die Innenstadt, 51 Prozent nehmen das Rad für den Schulweg oder zur Arbeit (hierzulande sind schon 15 Prozent modal split ein hoher Wert). 132 Euro pro Bürger gibt die Stadt pro Jahr für Radinfrastruktur aus (an die 250 Millionen seit 2015), in Deutschland sind es je nach Gemeinde 2-10 Euro per annum, selten 20.
Und dann ist da Utrechts neues Fahrradparkhaus, 2019 eröffnet, gleich am und unter dem Bahnhof. Es hat 12.500 Stellplätze, Weltrekord. Noch mehr als die Zahl wirkt das Gebäude, wenn man es durchradelt. Die Stellplätze sind auf drei Stockwerken jeweils in zwei Etagen untergebracht, stellenweise geht es bis zu 250 Meter geradeaus, nichts als Speichengefährte neben einem. Digitale Anzeigen verraten die aktuelle Auslastung und wo freie Plätze sind. Die ersten 24 Stunden sind umsonst. Die Ausfahrten führen gleich zu den Gleisen oder in die autofreie Innenstadtzone.
Allein im Bahnhofsviertel gibt es 21.000 bewachte Radparkplätze. Trotzdem glauben 47 Prozent der Innenstadtbewohner, dass das noch zu wenig ist.
Wir radeln weiter zum weitläufigen Uni-Campus, wo die Radwege in Regenbogenfarben gestaltet sind. Bald macht sich Enttäuschung breit. Auch hier kein Stau. Also, wo ist mal ein Fahrradstau? Ronald Tamse winkt ab: Jetzt im Sommer seien Ferien, zudem viele Studierende woanders. Auf Youtube, sagt er, finden sich Sequenzen, wie sich RadlerInnen zu vielen Dutzend binnen Sekunden vor einer Ampel zusammenknubbeln und manchmal erst mit der zweiten Grünphase über die Kreuzung kommen.
Tamses Philosophie heißt: Nicht einfach möglichst viele Radkilometer bauen. Sondern intelligent gucken, wo was passt. „Verkehre trennen, aber immer zusammen denken. Wir fragen vorher Geschäfte und Anwohner nach ihren Ideen und Wünschen. Wir wissen übrigens schon lange, dass Fußgänger und Radfahrer mehr Geld in die Geschäfte bringen als Autofahrer. Die fahren ja meist durch.“
Utrecht ist auch jenseits des Daseins als Fahrrad-Megacity eine maximal relaxte Gemeinde. Da ist die nette Altstadt, der gotische Dom und pittoreske Grachten, die keinen Vergleich mit dem völlig überlaufenen und überteuerten Amsterdam scheuen müssen. In den typischen Utrechter Werftkellern sind direkt am Wasser Cafés und Restaurants untergebracht. Und diese Ruhe, plätscherndes Wasser statt Autobrumm! Dennoch: Tourismus-Kampagnen gibt es kaum, man lässt sich lieber entdecken.
Selbstbewusste Radler
Ronald Tamse zeigt mir einen weiten Kreuzungsbereich in einer 30er-Jahre-Siedlung mit viel Platz daneben, auf dessen Umbau er offensichtlich richtig stolz ist. Alles fließt, die Schwärme an Fußgängern, Radlern und langsamen Autos kommen sich nicht ins Gehege. „Das klappt gut. Vielleicht bin ich ja auch ein Magier.“ Um gleich einzuschränken: „Wir haben auch schon so viele Fehler gemacht und mussten nachkorrigieren, sogar hier. Und es gibt auch Stellen, wo wir nicht recht weiterkommen. Ich könnte auch den ganzen Tag herumfahren, nur an Wegen, mit denen ich noch nicht zufrieden bin.“
„Wie breit sollte denn ein Radweg sein?“, fragt er dann und antwortet gleich: „Mindestens drei Meter, zwei fahren nebeneinander und einer kann überholen.“ Drei Meter! Bei uns kämpfen Radinitiativen für zwei Meter breite Bike Lanes. Und die aufgepinselten „Sicherheitsstreifen“ sind manchmal nur 80 Zentimeter breit. Mit Sicherheit haben diese Malerarbeiten auf Asphalt nichts zu tun: Rechts gehen zack die Autotüren auf, links rasen die Blechdosen eng vorbei. Auf Niederländisch heißen diese hilflosen Streifen übrigens Moordstrookjes: Todesstreifen. In Utrecht: Fehlanzeige. Auch keine Autos, die auf einem Radweg parken, nirgends. Dann hätte, sagt Tamse, „schnell mal ein Radfahrer seinen Schlüsselbund in der Hand“. Und ratsch.


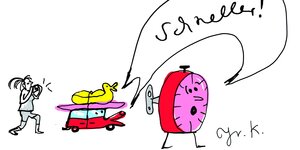


Leser*innenkommentare
Harald Thielen-Redlich
Wir waren vor 2 Wochen da und ein junger Mann erklärte uns das Utrechter Verkehrskonzept eines deutschen Ingenieurs von 1958, Max-Erich Feuchtinger. Die Grachten zuschütten und darauf Autobahnen bauen - kein Witz! Die letzten Spätfolgen wurden erst vor Kurzem beseitigt. Will sagen politisch wurden in den 70ern, bei der Entscheidung gegen das Auto und für das Fahrrad, ganz, ganz dicke Bretter gebohrt. Davon sollten wir lernen!
www.researchgate.n...otor_Age_1960-1980
Mysan
Mitnichten ist das Auto, schon allein wegen seiner Kosten, ein inklusives Verkehrsmittel, wie hier teilweise suggeriert wird. Was ist denn mit Hugo B. oder Ali K., die sind gehörlos und haben Probleme mit dem Gleichgewicht? Hört doch bitte auf einzelne Bevölkerungsgruppen herauszupicken um der "anderen Seite" Ignoranz oder fehlende Achtsamkeit vorzuwerfen, bevor es eine Tatsache ist oder sich anbahnt. (Stattdessen: Kann jemand beisteuern wie es (dort) um die Zufriedenheit beim Thema Mobilität in dieser oder jener Gruppe steht ?). Es geht hier um Entwicklungen für die Lösungen gefunden werden müssen. Die Welt wird nicht auf Morgen neu angestrichen. Ist es wirklich undenkbar, dass es nicht nur eine mögliche (Transport-)Lösung geben kann und ein Miteinander möglich ist?
Für mich unstrittig ist: Autoverkehr wird und muss etwas von seiner Vormachtstellung abgeben, kommt aber von einem hohen Niveau, denn er ist zu dominant im Verbauch von Platz (und Geld). Damit gehen fraglos einige Veränderungen der Gewohnheiten einher.
Ich war gerade dreieinhalb Monate mit dem Rad unterwegs und davon auch ca. 1500 km in Deutschland.
Mein Eindruck: VerkehrplanerInnen oder zuständige AmtinhaberInnen haben wenig Verständnis für die Bedürfnisse von AlltagsradlerInnen und die Infrastruktur ist häufig nicht nutzbar. Sehr häufig, teilweise alle 300 Meter muss ich anhalten, die Seite wechseln, zurück auf die Fahrbahn, ein Stück fliegen, Ampel, etc.
Die Kompetenz, die sich der Herr hier im Artikel angeeignet hat, fehlt in Deutschland noch; oder ExpertInnen werden nicht gefragt. In manchen Städten tut sich schon was, bloß leider meist nicht Bedarfsgerecht.
Noch eine abschließende Frage: Finden Sie es normal wenn z.B. eine Mitbewohnerin ihre Pizza oder ihre Brötchen beim 200 Meter entfernten Laden mit dem Auto holt? Zitat: "Strecken, die länger als mein Auto sind, fahre ich". Zum Fahrradfahren muss man nicht sportlich sein, außer es soll schnell gehen. Geht auch langsam.
Andi S
Persönlich glaube ich, dass der Radverkehr weiter aufgewertet werden muss. Aus systematischer Sicht, muss öffentliche Verkehrsmittel in Kombination mit dem Übergang in den PKW-Verkehr bevorzugt werden. Deutschland hat in Summe ein Winterproblem (und mal ehrlich, Radfahrern bei schlechten Wetter begeistert nicht jeden) und eine kleinteilig Besiedlungsstruktur.
Und bevor jemand kommt, in den Niederlande sei das alles auch so, dem gebe ich mal eine Makrokennzahl: Sowohl die Niederlande als auch Deutschland haben ca. 550 kfz je 1000 Einwohner. Dementsprechend ist meine Schlussfolgerung aus der Makroperspektive: In urbanen Zentren hat der Radverkehr in den Niederlande eine hohe Bedeutung, in der Fläche aber genau so autofokusiert wie Deutschland.
Und damit kommen wir zur gesellschaftlichen Rezeption des Radverkehrs: Viele nehmen das als urbanes akademisches Elitenprojekt wahr, dass an der kleinteiligen und teilweise weitläufige Besiedlungsstruktur vorbei geht. Oder einfacher gesagt: wo heute nur jede Stunde an Werktagen ein Bus fährt und alles außer den lokalen Läden 30 Minuten Radfahrern kostet, wird auch mit viel Engagement es schwierig bleiben.
Am Ende bleibt: Herz und Hirn muss gewonnen werden…
Fred Wischkowsky
Hab ihr mal geschaut wie viele Straßenbahnen sich in niederländischen Großstädten jenseits der Küste finden?
Utrecht hat genau eine Durchmesserlinie mit einem Abzweig die noch dazu unnötigerweise am Hauptbahnhof gebrochen ist. Das deutlich kleinere Krefeld in Deutschland hat ein ganzes Netz.
Deutschland mag Autoland sein, aber selbst der Westen hat mehr als jedes anders westliche Land Straßenbahnen erhalten.
Mag sein, dass das Fahrrad hier deutlich, aber es ist mehr als despektierlich deswegen von Kulturlosigkeit zu sprechen.
So wie Deutschland etwas mehr Fahrrad gut tun würde, aber derart viel Fahrradinfrastruktur zerstört die Notwendigkeit für effizienten ÖPNV und benachteiligt damit körperbehinderte und unsportliche Menschen.
Rudolf Fissner
"schön wärs aber leider verbietet das die StVO.!!"
Der Faktenchek sagt etwas anderes.
Keine StVO verbietet Radschnellwege, Radwege, Fahrradstraßen ...
Vorstadt-Strizzi
@Rudolf Fissner Getrennte Radwege sind Verkehrseinrichtungen. Dazu sagt StVO § 45 (9):
1 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind NUR DORT anzuordnen, WO DIES auf Grund der besonderen Umstände ZWINGEND ERFORDERLICH IST. 2 Dabei dürfen Gefahrzeichen nur dort angeordnet werden, wo es für die Sicherheit des Verkehrs erforderlich ist, weil auch ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig erkennen kann und auch nicht mit ihr rechnen muss. 3 Insbesondere Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs dürfen nur angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die DAS ALLGEMEINE RISIKO einer Beeinträchtigung der in den vorstehenden Absätzen genannten Rechtsgüter ERHEBLICH ÜBERSTEIGT.
Zusammen mit dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit im Haushaltsrecht (Art. 114 Abs. 2 Satz 1 GG, § 6 HGrG, § 7 BHO) ist dies selbst für gutwillige Kommunen weitgehend ein de facto Verbot von von baulich getrennten Radwegen.
Strolch
Interessant wäre, wie der Umbau von statten ging und was wie lernen könnten.
Ich war am WE das erste Mal mit meinem Sohn (Grundschule) auf den Rädern in der benachbarten Großsstadt mit ca. 120.000 Einwohnern. Dorthin ist ein "Radschnellweg" gebaut worden. Dafür wurde sogar ein 10-15m hoher Hügel platt gemacht, damit der Weg ebener ist.
Der Weg zwischen den Ortschaften war ok - nein, der war super. Breit, man konnte nebeneinander fahren selbst wenn ein Rad entgegen kam. Innerhalb der Stadt dann, die Katastrophe. Große Kreuzungen zu queren (gut lässt sich nicht zwingend vermeiden), die Ampeln für Fußgänger und Radfahrer sahen aber teilweise Stopps zwischen den Fahrbahnen vor, da nicht alle drei Ampeln zur Querung gleichzeitig oder lange genug grün waren. Zudem häufiger Wechsel von eigenem Radweg und Weg auf der Straße, etc. Ob ich das ein 2. Mal mit Kind mache?! Ich glaube nicht.
P.S. Der Radschnellweg geht dann innerhalb meines Orts weiter. Aber auch da gibt es eine Lücke von 500m. Hier muss man plötzlich durch ein Wohngebiet, dann wird man über eine Ampel geleitet, die ewig nicht grün wird, um dann über eine Nebenstraße geleitet wieder neben der Autoschnellstraße zu landen. Oder anders gesagt: Durch die Unterbrechung ist der Gedanke eines "Schnellwegs" im Eimer.
Sandor Krasna
Die Alternative zum Auto ist nicht das Fahrrad, sondern es sind Züge, Straßenbahnen, S-Bahnen und U-Bahnen. Das Fahrrad ist eine Alternative zum Gehen zu Fuß.
Uranus
@Sandor Krasna Doch, das Fahrrad ist schon eine Alternative für das Rad. Einer Statistik nach (ich weiß leider nicht mehr die Internetseite) sind 66 % der Strecken, die mit dem Auto zurückgelegt werden, kürzer als 10 km. Die meisten der Autofahrer*innen könnten für solche Strecken auf das Fahrrad umsteigen. Leider wird Autofahren aber noch zu stark subventioniert und verkehrspolitisch zu stark unterstützt und so machen das nur wenige - wenn auch zuletzt mehr.
Niels Ringelmann
@Sandor Krasna Natürlich ist das Fahrrad für das Auto, daß auch viele für Kurzstrecken benutzen. Es ist aber auch ein super Zubringer zur Bahn, wie man auch in den Niederlanden sieht.
Strolch
@Sandor Krasna Ich mag das Rad. Den ÖPNV nicht. Strecken bis 5km würde ich gerne mit dem Rad fahren. Weitere eher mit dem Auto. In beiden Fällen ist nach meiner Erfahrung der ÖPNV langsamer. In meiner "Kleinstadt" sogar um Welten langsamer, da fast nichts fährt...
jox
@Sandor Krasna Die niederländischen Städte zeigen, dass das nicht so ist.
Und ich kann das aus Erfahrung sagen, denn ich habe kein Auto, und nutze nur relativ selten ÖPNV, den Rest mache ich mit dem Rad. Mit dem Rad hat man einen Radius von ca. 10 bis 15 Kilometer, mit dem ebike auch etwas mehr. Wenn man sich seinen Alltag mit kurzen Wegen gestaltet, reicht das dicke. Klar kann das nicht jeder, aber es geht leichter als man denkt.
Sicher werden sich jetzt Leute fragen, wie das geht - sie müssen doch selber mit dem Auto weit längere Strecken zurück legen? Die Antwort ist, man gestaltet sich den Alltag nach dem Auto, und wenn man aufs Fahrrad umsteigt (oder viel besser gar nicht erst mit dem Autofahren anfängt), wählt man recht automatisch kürzere Wege. Es gibt ein paar Dinge, auf die ich dann lieber verzichte, weil sie zu weit weg sind und mir Zug fahren in dem Fall zu anstrengend ist. Aber dafür gibt es andere Dinge die man eher macht und auch schön und wichtig sind.
Francesco
Ein paar Bilder wären nett, damit man sich das vorstellen kann.
jox
@Francesco Oh, da gibt es auf Youtube einige, bitte hier:
www.youtube.com/re...echt+cycling+city+
Und nicht zu vergessen: www.youtube.com/c/NotJustBikes
Francesco
@jox Danke
Rudolf Fissner
"Der 55-Jährige ist Utrechts Generalverkehrsplaner und Entwickler der Radinfrastruktur, seit 25 Jahren."
Im kleinen spielt die Musik in Utrecht. Schlicht und einfach auf kommunaler Ebene!
Und Deutschlands Opposition schielt wie Schafe hoch zum Bundes-Verkehrsminister und wartet auf die allein selig machende Superlösung, statt in den Spiegel und vor die eigene Haustür zu schauen.
Solche Entwicklungen wie in Utrecht wären in DE schon seit Ewigkeiten möglich.
Kommunen in denen es "grüne" Mehrheiten gibt, existieren schon seid Jahrzehnten. Mit Bremen haben wir sogar ein Bundesland mit aktuell rot-rot-Grüner und vormals ewig eine rot-grüne Regierung.
Wunderwelt
@Rudolf Fissner Solche Entwicklungen wie in Utrecht wären in DE schon seit Ewigkeiten möglich."
-> schön wärs aber leider verbietet das die StVO.!!.. ..
...ist tatsächlich so. Viele Gemeinden würden aktuell gerne umbauen...dürfen sie aber nicht wegen dieses Monstergesetzes, welches maßgeblich noch aus Zeiten des dritten Reiches stammt...
... Steht übrigens sogar im Koaltionsvertrag, dass da etwas am Gesetz geändert werden soll...aber Hr. Wissing ist da sehr "geduldig"..
Janix
So schön könnte es sein
PS: "strookje" mit zwei o
Huber Ursula
Vielen Dank für den Superartikel!
Vielleicht etwas scharf geschrieben,das schadet nach meiner Meinung aber nicht,
Es macht einfach klar wie verrückt und unmenschlich bei uns die Verkehrsplanung läuft! Allein die Ausgaben für Radfahrer, ein paar Euro, und über hunderte für den Autoverkehr!! Hier kann man schon mal etwas deutlich benennen!
Django
@Huber Ursula Mir fehlt aber die eigene Recherche. Den städtisches Chefplaner für Radverkehr begleiten ist das eine, sich ein eigenes Bild der Lage zu machen (Fußgänger befragen!), ist das andere. Beim eigenen Bild fängt eigentlich der Journalismus an.
Uranus
Danke für den Artikel und Einblick! Liest sich inspirierend.
Schade, dass Utrecht trotz der vielen Radfahrer*innen den Verkehr trennt und noch nicht autofrei ist. Aber das ist jammern auf hohem Niveau. Vielleicht kommt das ja noch. Wie hoch ist da das Tempolimit innerorts?
"Eine Riege tatenloser deutscher Verkehrsminister tat ihr Übriges."
Hinsichtlich fahrradfreundlichem Verkehrsgestaltung stimmt das. Im allgemeinen waren die alles andere als tatenlos: Ausbau von Straße und Flugverkehr, Rückbau der Schiene ...
Rudolf Fissner
@Uranus Das mag man sich ja wünschen, dass es keine Autos mehr gibt.
Aber Utrecht zeigt, wie massig viel die Kommunen DE pragmatisch in Eigenregie bereits erreicht haben könnten.
Wen die Kommunen weiterhin nur nicht umsetzbaren utopischischen Zielen hinterherlaufen sollen, wird das mit dem Radverkehr nie etwas in De.
Eine politische Opposition für eine Verkehrswende, die sich nur auf den Verkehrsminister versteift, der für die kommunale Planung nicht einmal zuständig ist, meckert nur auf niedrigem Niveau herum.
jox
@Uranus Ich denke, wenn Historiker den "Siegeszug" des privaten Automobils mal genauer untersuchen, dürfte sich herausstellen, dass die Autoindustrie oft sehr tatkräftig nachgeholfen hat, den ÖPNV zu beerdigen. In einigen Fällen ist das bekannt.
Rudolf Fissner
@jox Klar doch. Und in Utrecht hat "die Autoindustrie" dann wohl ein Auge zugedrückt. Das sind doch Verschwörungstheorien.
Uranus
@jox Zumindest Aufkauf und Stilllegung von ÖPNV durch Auto/Ölindustrie in den USA wurde, meine ich, in der Arte Doku "Erdzerstörer" aufgezeigt:
www.youtube.com/watch?v=sWlbnNDu6OE
Eine ähnliche Reportage über Deutschland las/sah ich noch nicht. Fände ich aber sehr interessant. Vorstellbar ist das ja. Mensch schaue sich bpsw. die verkorkste Bahnpolitik an ...
Wunderwelt
Danke für diesen Artikel.
Ganz offensichtlich sind uns die Niederlande mal wieder meilenweit voraus..die haben verstanden, dass Städte mit mehr Fahrrädern und weniger Autos einfach viel schöner (auch akustisch) sind...dass es gesünder ist Fahrrad zu fahren und ein Stück weit glücklich macht.
Im Auto sitzt man dagegen die ganze Zeit und fühlt sich vielleicht mächtig, allerdings nur so lange kein Stau ist...glücklich macht das sicher nicht.
Die deutsche Automentalität und die Verhaftung durch die Autoindustrie (von wg. Steuern und Arbeitsplätzen) war vielleicht mal ein Segen, erweist sich mittlerweile aber immer mehr als Fluch.!!
Und apropos Fahrradparkhäuser: Extra 3 berichtete mal über das kürzlich in HH Eppendorf gebaute Fahrradparkhaus..und das man dort nicht mit dem Fahrrad hinein fahren.. Ich konnts kaum glauben, aber es stimmt wirklich: man kann sein Fahrrad nur entweder eine Treppe hoch tragen oder auf einer schmalen Schiene hochschieben. Bei meinem Besuch war das Ding auch so gut wie leer..wen wunderts..
D-Land ist in Sachen Fahrrad dann wohl wirklich ein Drittweltstaat...
..aber wer braucht schon Fahrräder...sollen sie doch Porsche fahren...
Fred Wischkowsky
@Wunderwelt Dafür sind wir den Niederlanden in Sachen Straßenbahn meilenweit voraus, wo man das Gefühl bekommt, dass die Küstenregion maßlos bevorzugt wurden und der Rest benachteiligt wird.
In den 80ern hat Utrecht eine Stadtbahnlinie mit Abzweig wiedereingeführt und hat man in den 90ern und 2000er lieber Radwege gebaut als da weiterzumachen.
Das mag bei der niederländischen Geographie und in einigen wenigen flachen Städten wie Münster vertretbar sein, in den restlichen Großstädten braucht es aber einen leistungsfähigen ÖPNV an erster Stelle vor dem Fahrrad.
Rudolf Fissner
@Wunderwelt "..aber wer braucht schon Fahrräder...sollen sie doch Porsche fahren..."
Wer ist denn in der RRG Berliner Verkehrsplanung Porschefahrer? Das finde ich mal interessant. Ich tippe auf die Linkspartei
resto
Auf dem Bild sehe ich keine e-bikes und keine Raserbikes, sondern bequeme City-Bikes - gut so. Es scheint, als ginge es in Utrecht entspannter zu als bei uns; vor allem für Fußgänger:innen, v.a. Alte, Kinder, Menschen mit Behinderungen.
jox
@resto e-bikes sind auch in den Niederlanden populär. Aber das Fahrrad ist halt ein Alltags-Verkehrsmittel und weniger ein Sportgerät.
Tom Truijen
@resto Das ist natürlich quatsch, es gibt auch junge Leuten die schnell vorankommen wollen. Aber es ist auch gar nicht schlimm da die Fahrradstreifen oft breit genug zum überhohlen sind.
guzman
„Alle Radpisten sind immer sicher abgetrennt, mit eigenen Ampelanlagen, mit intelligenten Wegeführungen an komplexeren Kreuzungen, auch beim Linksabbiegen.“
Das ist ja schön aber gar nicht nötig, bzw. dieser Aufwand würde in Deutschland Jahrzehnte in Anspruch nehmen. - - Stattdessen sollte in Städten generell Tempo 25 gelten, dazu Parkmöglichkeiten für den MIV stark einschränken. Dann können alle Vehikel ziemlich problemlos gemeinsam auf die Straße. Die Abtrennerei geht am Ende nur auf Kosten der Fußgänger, die sollten tatsächlich als einzige Verkehrsteilnehmende ihren abgetrennten Raum behalten, überall und vor allem ausreichend breit (min. 3m!). Shared Space ist für Fußgänger nervig, Kinder wollen auch mal von der Hand (außerdem, für viele Menschen mit Behinderung ist das auch problematisch).
Uranus
@guzman Ich stimme zu. Die Verkehrswende wäre so viel einfacher und effektiver, scheitert wohl aber an den vielen Autofreaks. Womöglich braucht es eine langsam-Wasser-aufkochen-Strategie, da sich sonst zu viele Autosüchtige darüber beklagen würden, dass sie nicht mehr mit ihrer Blechkiste zur Bäckerei um die Ecke fahren können.
rero
@guzman Tempo 25 wünsche ich mir auch als Radfahrer nicht.
Am Rad habe ich keinen Tacho.
E-Biker empfinden das erst recht als langsam.
Uranus
@rero Sondern? Bisher sind es 30 km/h in vielen Wohngebieten.
Ebikes sind doch meist die mit Tretunterstützung und diese endet bei 25 km/h. Wer schneller als 25 km/h mit so einem Ebike radeln will, muss voll selbst in die Pedalen treten.
rero
@Uranus Eben.
Bei 30 km/h sollte es mindestens bleiben.
Django
@rero Tempo 25 ist für mich schon recht flott, und dabei werde ich kaum noch überholt. Und in Amsterdam letzten Sommer waren die meisten recht zügig unterwegs, aber eben nicht > 25 km/h.
rero
@Django "Kaum noch überholt"
Eben.
Das meine ich ich.
Es gibt Radfahrer, die schneller sind.
Übrigens auch Radfahrerinnen.
Nobodys Hero
Ich habe lange Zeit in Utrecht gewohnt. Es war eine schöne Zeit und in meiner Zeit dort wurde auch das besagte Fahrradparkhaus unter Utrecht Centraal fertiggestellt. Allerdings muss ich sagen ist der Bericht aus meiner Sicht sehr einseitig geschrieben. Ich war in Utrecht gerne mit dem Rad unterwegs, aber es ist bei weitem nicht so, daß man jeden Winkel der Stadt auf Radwegen erreichen kann. Des weiteren ist es schon so, daß die Niederländer nichtsdestotrotz extrem viele Autos haben auch in der Stadt. Wenn man aus Utrecht herauswill ist das Rad keine Alternative, im Zug habe ich sehr wenige Räder gesehen. Außerdem sind die Autobahnen egal in welche Richtung noch voller als in Deutschland.
Autos, sprich Lieferwagen auf dem Radweg erlebt man schon oft, vielleicht nicht wenn man mal kurz da ist um sich etwas zeigen zu lassen, aber im Alltag wenn man dort wohnt ist das normal. Nur der Umgang der Niederländer damit ist anders. Es beschwert sich wirklich niemand, das habe ich dort nie erlebt, das ist in Deutschland anders. Es gibt für die vielen Lieferanten die, die kleinen Geschäfte entlang der Radwege anfahren einfach oft überhaupt keine andere Möglichkeit. Das Fahrradparkhaus war wirklich eine super Sache. Allerdings muss man hier aus dazusagen, ganz billig ist das nicht und man braucht eigentlich auf Dauer eine NS (Nederlandse Spoorwegen) Karte um das praktikabel nutzen zu können.
Alles in allem ist mir der Artikel zu tendentiös, zu unkritisch. Meine Kollegen sind wirklich alle zum Einkaufen ständig nach Deutschland gefahren. Nicht nur weil es hier günstiger ist, sondern weil sie in den Niederlanden keine großen Einkaufszentren haben, die sie so bequem mit dem Auto anfahren können. Des weiteren muss man sagen: es ist schön, wenn man Radfahren kann, aber als ich dir Hand gebrochen hatte und auf den Bus angewiesen war, war ich froh, daß ich mein Auto nicht abgeschafft hatte.
Nobodys Hero
@Nobodys Hero Ich stelle das Auto nicht generell als unverzichtbar dar, ich will damit nur sagen, wenn man einfach aus gesundheitlichen Gründen nicht radfahren kann ist Utrecht nicht schön.
guzman
@Nobodys Hero Schade, nach der berechtigten Kritik an der Dominanz des MIV auch in den Niederlanden, dass sie dann am Ende doch noch das Auto als praktisch unverzichtbar ‚hinstellen‘. Das ist es auch unter den wirklich miesen Bedingungen in Deutschland nicht. Es geht gut ohne Auto, wenn man nicht gerade extrem bequemer Mensch ist.
White_Chocobo
@guzman Es gibt auch Menschen, die krank, alt oder behindert sind und nicht ohne Weiteres fahren können. Den wichtigen Hinweis von Nobodys Hero, dass er seine Hand gebrochen hatte und deshalb froh war, sein*ihr Auto nicht abgeschafft zu haben, sollte nicht ignoriert werden. Mit Bequemlichkeit hat das nun alles nichts zu tun.
Ajuga
@White_Chocobo Nach 2 Generationen motorisierte Individualmobilität als stadtplanerische Leitlinie/planke kann man natürlich nicht von heute auf morgen alles umstellen. (So wie es anderthalb Generationen brauchte, um das Stadtbild von Pferdeverkehr auf Verbrennungsmotor umzustellen.)
Wichtig ist, würde ich sagen, folgendes: "Stadt" als etwas zu begreifen, wo man *nicht nur* mit Rad, Öffis und zu Fuß irgendwo hinkommen kann, sondern *auch* mit Autos, und ihre Entwicklung in direse Richtung zu planen. Und nicht mehr als etwas, wo man *auch* mit anderen Verkehrsmitteln als dem PKW irgendwo hinkommen kann.
Das ist doppelt klug, da momentan niemand vorhersehen kann, wie motorisierte Individualmobilität in anderthalb bis 2 Generationen aussehen wird - Fahrräder und Öffis, ganz zu schweigen von Füßen, werden dann immer noch dasselbe sein und dieselben Rahmenbedingungen erfordern. Planung, die diese Verkehrsmittel bevorzugt, ist also langfristig resilient; auf die heutigen Diesel/Otto-PKW ausgelegte Planung ist eine Sackgasse.
jox
@White_Chocobo > Es gibt auch Menschen, die krank, alt oder behindert sind und nicht ohne Weiteres fahren können.
Menschen mit Behinderungen werden durch unser extrem autolastiges System nicht unterstützt. Manche Menschen sind sehbehindert und können nie fahren. Kïnder können sich nicht eigenständig bewegen, was ein Unding ist.
Und Menschen die altern können und dürfen micht mehr fahren, wenn Sehvermögen, Übersicht, Gedächtnis und auch Reaktionsvermögen abnehmen. Die sitzen dann im Zweifelsfall in so einem Vorort-Einfamilienhaus und kommen da mangels vernünftigem ÖPNV nicht mehr weg. Oder sie fahren obwohl sie es nicht mehr können und dürfen und verursachen so tödliche Unfälle. Gerade in Deutschland mit seiner Demografie wird das noch ein Riesenproblem.
guzman
@Nobodys Hero Leider muss ich ihnen recht geben, wobei die Niederlande im Vergleich zu Kopenhagen noch gut abschneiden. Nach all den Jubelarien in der Qualitätspresse‘ war es ernüchternd zu sehen, welche extreme Bevorzugung Autofahrende in Kopenhagen weiterhin genießen.
Jossito
@guzman A propos Kopenhagen:
'...Nach dem Copenhagenize Index ist Utrecht die drittfahrradfreundlichste Stadt weltweit, hinter Kopenhagen und Amsterdam[16]....'
Quelle: Wikipedia
White_Chocobo
Was mir in diesem und vergleichbaren Artikeln immer fehlt ist die Perspektive von Personen, die nicht fahrradfahren, z.B. Fußgänger*innen, Menschen mit Behinderung oder älteren Menschen, die das ggf. nicht mehr können. Auch der Artikel erwähnt im Grunde genommen nur eine junge bis jüngere Generation (von Schulkindern bis zur erwerbstätigen Bevölkerung). Alles darüber hinaus spielt offenbar in den Reflexionen keine sonderlich große Rolle.
Ich war erst vor wenigen Tagen in den Niederlanden und ja, die Fahrradwege sind toll ausgebaut usw., aber das heißt nicht, dass die Radfahrer*innen deshalb rücksichtsvoller oder verantwortungsvoller fahren würden. Als Fußgänger*in muss man extrem aufpassen und da die Nähe zwischen Fahrradfahrer*innen und Fußgänger*innen größer ist als zwischen Fußgänger*innen und Autofahrer*innen, wird das Risiko nicht unbedingt geringer. "Selbstbewusste" Fahrradfahrer*innen, wie im Artikel genannt, sind eben nicht unbedingt auch rücksichtsvolle Verkehrsteilnehmer*innen.
Davon ab, würde mich interessieren, wie die Situation während der Wintermonate ist, wie die Arbeitgeber*innen auf die radfahrende Belegschaft eingestellt sind usw.
Gummistiefel
@White_Chocobo Gibt auch Fahrräder für Behinderte. Für viele muss ein Fahrrad zwingend zwei Räder haben und einen Sattel auf dem man über dem Rahmen sitzt. Es gibt so viele Spielarten, Trikes (Dreiräder) mit und ohne Verkleidung, einspurige Liegeräder, Tandem, vierrädrige Räder mit und ohne Verkleidung, Lastenräder mit zwei oder drei Rädern,...Dazu zähle ich sogar Röllstühle, die ebenfalls in einer Verkehrsberuhigten Stadt besser zurecht kommen als in einer autofreundlichen Stadt.
Konrad Ohneland
@White_Chocobo Ah ja, danke für den üblichen Beitrag.
Dann wollen wir mal: Die Menschen mit Behinderung oder ältere Menschen werden tatsächlich nicht erwähnt, aber sagen Sie mal selbst: Haben die es in Deutschland soviel leichter? Ein Zitat aus dem Text, das ihnen vielleicht entgangen ist: „Man kommt auch in Utrecht mit dem Auto überall hin.“ Vielleicht nicht einfach, aber ein Krankentransport oder Ähnliches findet doch wohl seinen Weg. Fussgänger sind nicht gefährdeter als hier. Ein bisschen Aufmerksamkeit im Strassenverkehr ist für alle Verkehrsteilnehmer*innen unabdingbar. In den Niederlanden haben halt eher die Fahrradfahrer Vorrang und nicht die Autos. Musste mich auch in Dänemark umgewöhnen, aber dafür hab ich zehn Minuten gebraucht. Wo ist denn da bitte das Problem? Ihre Unterstellung über die "selbstbewussten" Radler*innen lasse ich mal aus.
Und was den Winter betrifft: Fahren Sie nicht im Winter Fahrrad? Bei geräumten Wegen geht das nämlich schon. In D werden mal gern die Schneeberge (sofern vorhanden) auf den Radweg geschoben, da macht das natürlich weniger Spass. Was die Arbeitgeber:innen damit zu tun haben, erschliesst sich mir nicht. In Büros gibt es ganzjährig Garderoben?
Šarru-kīnu
@Konrad Ohneland Laut aktueller Umfragen des ADFC nutzen 2/3 der Bundesbürger ihr Fahrrad komplett nicht während der Wintermonate. "Fahren Sie nicht im Winter Fahrrad?" zeugt also schon von einer gewissen Realitätsferne würde ich sagen.
Django
@Šarru-kīnu Wobei "Winter" für diese Menschen im November beginnt (könnte ja regnen) und im April endet... Ich werde nach 15 Jahren beim gleichen Arbeitgeber von den Kollegen immer noch angestaunt wie ein Mondkalb, wenn ich bei Temperaturen um den Gefrierpunkt (viel kälter wird's nicht mehr in Berlin) und Regen mit dem Fahrrad ankomme.
Rudi Hamm
Kennen sie den Unterschied zwischen Utrecht und der schwäbischen Alb?
Utrecht ist topfeben, die schwäbische Alb ein Berg nach dem anderen.
Für viele und im Besonderen ältere Menschen ist ein Fahrrad (selbst e-bike) daher leider, leider keine Alternative.
Auch sind die Winter auf der schwäbischen Alb viele härter und kälter als in Utrecht.
Ich finde es toll, wenn Städte endlich mehr auf das Fahrrad als Verkehrsmittel setzen, ich bewundere was Utrecht gemacht hat, aber es ist eben nicht 1:1 auf alle Regionen übertragbar.
Gummistiefel
@Rudi Hamm Im Winter fahre ich nicht mehr mit dem Rad. Der Grund ist das viele Salz. Fahrräder sind nicht für den Einsatz im Salzgeschwängerten Winter geeignet. Der Materialverschleiß ist eneorm. Und nach jeder Fahrt das Rad abzuwaschen und die Kette etc. zu ölen ist mir dann doch zu viel Aufwand geworden.
jox
@Rudi Hamm Die meisten größeren Städte sind recht eben. München, Hannover, Berlin, Köln, Hamburg und so weiter - Stuttgart ist da eher eine Ausnahme und mit eBike kommen weniger sportliche Menschen auch in Stuttgart gut voran.
Viele kleinere Städte liegen an Flüssen, weil dies seit Jahrhunderten auch Verkehrsverbindungen sind, und an Flussufern gibt es auch keine grossen Steigungen. Das Problem sind sichere Radwege mit genug Platz, den muss man schaffen.
Django
@Rudi Hamm Ja, ich kenne den Unterschied. Mir leuchtet nur nicht ein, warum aus der topografischen Situation der Schwäbischen Alb (bzw. gerne auch Stuttgart als Hauptstädtle - ich habe dort mal gelebt) eine allgemeines Argument gegen eine fahrradfreundliche Infrastruktur abgeleitet werden soll. Was in Utrecht toipografisch geht, geht in Bremen, Hamburg oder Hannover genauso gut.
164 (Profil gelöscht)
Gast
@Rudi Hamm Nein, Deutschland ist im Schnitt nicht so "topfeben" wie die Niederlande. Dennoch gibt es eine Menge Leute (auch in Stuttgart!) die lieber mit dem Rad als mit dem Auto fahren möchten. Sollen die das nicht sicher und bequem ohne dauernd Riesenumwege machen zu müssen tun können? Die Unterschiede in der Topographie können doch nicht im Ernst ein Argument gegen eine vernünftige Infrastruktur sein!
Francesco
@Rudi Hamm Welche größere Stadt liegt denn auf der Schwäbischen Alb?
Rudolf Fissner
@Rudi Hamm Auch im Mittelgebirge lassen sich Radschnellwege mehr oder weniger eben führen. Zudem leben die allermeisten Mittelgebirgler in den Ortschaften entlang der Flüsse in den Tälern. Auch dort im Mittelgebirge ist also viel Potential für den Ausbau von Radschnellwegen.
Stefan Engels
@Rudi Hamm Ach, bitte. Spätestens, seit es eBikes gibt, ist das kein Argument mehr. Ich lebe in Ostfriesland, das ist so topfeben wie Utrecht, und trotzdem sind wir meilenweit von so einer Infrastruktur entfernt, auch auf Schulwegen. Selbst Münster kann da nicht mithalten, nicht ansatzweise. Das ist kein geographisches, sondern allein ein mentalitäts- und politisches Problem. Gegen die Autolobby kommt hier keiner an.
Rudolf Fissner
@Stefan Engels "Autolobby"
Wer ist den in all den roto-rot-grünen Kommunen denn nun die Autolobby.
Ich finde diesen Hinweis nur platt. Es gibt keine "Autolobby". Ganz DE ist auf das Auto fixiert und vermag planerisch nicht bis zum nächsten Stadtteil hinaus zu denken.
Bei uns in Bremen (seit Ewigkeiten mit grünem Verkehrssenator) gibt es zwar Mercedes als mit größten Arbeitgeber. Der quatscht aber in die Verkehrspolitik der Stadt und des Landes null hinein. Lobbyspielchen finden nicht statt.
Was es gibt sind finanzielle Prioritäten, die die Stadt setzt. Und das sind eben nich die Radwege. Es bleibt regelmäßig be Ankündigungen vor den Wahlen und ab und an wird eine kurze Stecke der seit 2014 geplanten Radschnellwege umgesetzt. Bei dem jetzigen Ausbautempo wird uns der Meeresspiegel noch vor der endgültigen Fertigstellung erreicht haben.
Stefan Engels
@Rudolf Fissner Klar, die ganzen Auto-Nimbys. Einzelhändler, die glauben, dass sie kaputtgehen, wenn das Umland nicht in die Stadt kommt. Leute, die - auch in grünen Städten - gratis Anwohnerparken wollen, fragen Sie mal Palmer in Tübingen. Die halbe FAZ; die ganze FAZ-„Technikredaktion“. All die Zulieferer, die im Sauerland dem Bürgermeister erklären, dass es ohne Autoindustrie nicht geht. Ich habe da drei Jahre Lokaljournalismus erlebt, ich kenne das Spielchen - unterschätzen Sie das nicht.
Rudolf Fissner
@Stefan Engels Natürlich gibt es Konflikte. Aber zeigen Sie doch mal den Konflikt in ihrem Städtchen auf, wo die Kommune einen Radschnellweg plant und dieser wegen Anwohnerparken verhindert wurde.
Ich wette, diesen Konflikt gibt und gab es nie, weil die Stadtplaner schlicht die Jahrzehnte nicht in die Pötte gekommen sind.
Wie Herr Tamse im Artikel schon sagt: "Radwege planen und bauen [...] dürfe „keine Ideologie sein. Radwege sind ein Werkzeug.“. Durch das stumpfe Vertreiben von Autofahrern gibt es null neue Radwege.
Francesco
@Rudolf Fissner Bei uns gibt es wegen Anwohnerparken eine Lücke in einer Fahrradstraße. So ganz verstehe ich den Grund nicht, ist aber so. Vermutlich könnten die Anwohner gegen die Fahrradstraße klagen, weil nach den Richtlinien kein objektiver Bedarf (zuwenig Radverkehr) besteht.
Uranus
@Rudi Hamm Vor der Erfindung des Autos war die schwäbische Alb entsprechend unbesiedelt?
Heute wohnen da ausschließlich Gehbehinderte und Senior*innen?
Alle Einwohner*innen kleben sich seit Jahrzehnten aus Protest immer wieder auf die Straßen wegen fahrradfeindlicher Verkehrsstrukur. Auch bei Wahlen wählen die meisten ökologische und fahrradfreundliche Parteien. Eigentlich sind das alle heimliche Ökos.
Schwäbische Alb hat keine Schneeräumfahrzeuge und kann sich auch keine samt Personal beschaffen ...
/Sarkasmus/
J. Straub
@Rudi Hamm Von Regionen ist doch auch nicht die Rede, aber in den Städten sollte man endlich anfangen. Also statt schwäbische alb eher Stuttgart oder Ulm.
Jan Schubert
@J. Straub Stuttgart ist auch nicht Münster. Aufgrund der sehr komprimierten, geschlossenen Bauweise in der Innenstadt ist das Fahrradfahren dort außerordentlich unattraktiv. Die Höhendifferenz zwischen meinem Büro in der Innenstadt und meinem Heim beträgt ca. 250 m, das ist bei der Tour de France schon eine Bergwertung der dritten Kategorie.
guzman
@Jan Schubert alle Welt fährt inzwischen anstrengungslos mit E-Bike (leider auch da wo es völlig unnötig ist) und sie wollen uns erzählen, dass ein paar Höhenmeter das Radfahren unmöglich macht? ( nebenbei, was sind schon 259 Höhenmeter für einen halbwegs gesunden Menschen, das sind auf 5km ca 5% das packt man bergauf in einer halben Stunde, bergab sind es dafür nur 10 Minuten nichtstun bzw. etwas Bremsen)
White_Chocobo
@J. Straub Hä? Das Argument von Rudi Hamm zählt doch auch für Städte. Sie tun ja gerade so, als ob alle Städte absolut eben wären. Viel Spaß aus San Fransicso eine Fahrradstadt zu machen.
Abgesehen davon lässt sich das Argument von Rudi Hamm auch dahingehend erweitern, als dass E-Bikes einfach auch sehr teuer sind. D.h. selbst wenn man nicht mehr ganz körperlich fit ist und sich für ein E-Bike entscheidet, muss dieses auch finanziert werden. Da sind schnell mal ein paar Tausend Euro zusammen.
Aber das juckt an dieser (!) Stelle natürlich nicht. An anderer Stelle können wir dann wieder larmoyante Anklagen über Klassismus in der taz lesen.
Natürlich sind das alles keine Gründe, um nicht für eine andere Art des Verkehrs zu sein, aber ich finde die Ignoranz gegenüber den diversen Problemen schon beachtlich und mittlerweile wirklich anstrengend, weil immer so getan wird, als ob man irgendwelche Konzepte 1:1 übertragen könne und dabei die spezifischen Herausforderungen kaum berücksichtigt. Lieber schreibt man eine Lobeshymne fürs gute Gewissen, kritisiert den eigenen Ort und hat ansonsten für die hiesigen Probleme auch keine Lösungen parat.
Stefan Engels
@White_Chocobo Jedes eBike ist billiger als ein Auto.
resto
@J. Straub Waren Sie schon einmal in Stuttgart? Da ist es wie auf der Schwäbischen Alb.
Herbert Eisenbeiß
Drittweltstaat, soso... man darf nicht vergessen, dass im Gegensatz zu den Niederlanden Deutschland auch über ausgeprägte Mittelgebirge und Alpen verfügt.
Nicht jede Stadt in Deutschland ist so flach wie Utrecht.
sdkjgfsdgf
@Herbert Eisenbeiß Und die Städte sind logischerweise auf den Gipfeln der Gebirge angesiedet…
Schon mal in Basel oder Zürich gewesen?
Uranus
@Herbert Eisenbeiß Deswegen gibt es in Deutschland 48 Millionen Autos? Wieviele Einwohner*innen der 83 Millionen wohnen denn in den Mittelgebirgen und den Alpen und wieviele auf den Bergspitzen?
Wunderwelt
@Herbert Eisenbeiß Ich weiß nicht ob Sie es schon mitbekommen haben..aber es gibt da diese neumodische Erfindung..
...wie heißt die noch gleich.?...ach ja:
-> E-Bike
Tom Truijen
@Wunderwelt .... Kann sich aber nicht jeder leisten. Ein E-bike ist mittlerweile so teuer wie ein günstiges gebrauchtes auto.
Wunderwelt
@Tom Truijen Das heißt dann ja im Umkehrschluss:
Jeder der sich ein Auto leisten kann..kann sich auch ein E-Bike leisten..
-> Ausgezeichnet..!! dann kanns ja auch gleich losgehen mit der Zukunft der Mobilität.. ;-)
Harry Hauber
@Herbert Eisenbeiß Aber Hamburg und Berlin und somit die beiden größten Städte in Deutschland.
Alfred Sauer
Sehr inspirierender Bericht. Ich bin davon überzeugt, dass solche Maßnahmen die Lebensqualität in Städten erheblich verbessern können. Ein Problem scheint aber aber dennoch nicht gelöst und hier sollte man ggf. dann auch nicht zu dogmatisch vorgehen. Menschen die in einer Stadt wohnen aber zur Arbeit pendeln müssen sich auf einen reibungslosen ÖPNV verlassen können. Ich brauche im Schnitt 30 - 40 Minuten mit dem ÖPNV zu meiner Arbeitsstelle, seit das Bahnchaos zunimmt im Schitt 60 - 90 Minuten. Manchmal fällt der Verkehr komplett aus (Ca. 2 mal im Monat). Was mache ich dann als reiner Radbesitzer? Ohne Auto wäre ich manchesmal überhaupt nicht zur Arbeit gekommen oder sehr sehr spät. Was mich nicht nur wegen der Spritpreise ärgert. Termine lassen sich so nicht wahrnehmen.
Django
@Alfred Sauer Ich habe vor Kurzem irgendwo einen Artikel in einem Online-Medium gesehen, der hevorhob, dass DE das Thema der z.T. sehr langen Arbeitswege anpacken muss, wenn es etwas werden soll mit der Verkehrswende. Mit der Zusatzinfo, dass die Länge des Arbeitswegs umgekehrt proportional zum "sozioökonomischen Status" ist, d.h. Bezieher:innen niedriger Einkommen haben signifikant häufiger lange Wege, auch weil sie häufiger den Arbeitsplatz wechseln (müssen), aber nicht jedesmal umziehen können / wollen. Habe leider vergessen, wo das stand.
Francesco
@Django Hast du einen Link? Ich hätte vermutet, dass es gerade umgekehrt ist.
Francesco
@Alfred Sauer Am besten ÖPNV und Fahrrad kombinieren.
Django
@Francesco Radfahrer:innen im ÖPNV sind ein zweischneidiges Thema. Fahrradmitnahme braucht viel Platz und generiert im Verhältnis dazu wenig Fahrgeldeinnahmen für die Unternehmen.
Francesco
@Django Eine Möglichkeit: Ein Klapprad. Machen Kollegen von mir so. Eine andere Möglichkeit für den Weg zur Arbeit (habe ich lange gemacht): Mit dem Rad zum Bahnhof und dort abstellen, am Zielbahnhof ein Fahrrad deponieren für die Weiterfahrt.
Konrad Ohneland
@Alfred Sauer Der ÖPNV ist noch ein ganz anderes Thema, da pflichte ich Ihnen bei.
Goldi
"Fahrrad-Drittweltstaat Deutschland" wie wahr, wie wahr. Dankeschön für den augenöffnenden Artikel! Daumen hoch!