Digitales Ausmisten: Gegen das Grundrauschen
Im Internet ist viel Lärm. Ein Entrümpeln des virtuell Angehäuften kann befreiend sein, weil es das Selbstwertgefühl stärkt.

Das Smartphone zu entrümpeln kann befreiend wirken – Sie müssen es ja nicht gleich ganz entsorgen! Foto: maxxyustas/imago images
Wäre unser Dasein im Internet eine Wohnung, dann wäre die bei den meisten wohl ziemlich unaufgeräumt. Etliche Kisten voll verstaubtem Kram, die sich in jeder Ecke meterhoch türmen. Viel zu viele Möbel, die jeden Weg zustellen und wahrlich nicht von einem Auge für kohärentes Innendesign zeugen. Überall lägen vollgeschriebene Zettel, Hefte und Bücher – Gekritzel, das beim besten Willen nicht mehr zu entziffern ist. Es würde dringend Zeit, alle Fenster aufzureißen und einen großen Sperrmüllcontainer zu bestellen.
Aber das Internet ist eben kein physischer Ort. Darum finden sich auf unseren Computern, Laptops und Smartphones, Gaming-Konsolen, Tablets und anderen internetfähigen Gadgets etliche Apps, Profile, Postings – vor allem also Daten, über die die meisten wohl schon längst den Überblick verloren haben. Das Ende eines Jahres und der Beginn eines neuen könnte daher ein guter Zeitpunkt sein, um sich einen Überblick zu verschaffen. Wer bin ich eigentlich im Digitalen? Und wie viel von mir gibt es eigentlich? Es mag sich zeigen: Vieles davon ist Gerümpel. Sich dessen zu entledigen, kann befreiend sein.
Um sich die eigene Wohnung mit Krempel vollzustellen, braucht man Geld und Platz. Sicherlich, manchmal werden Bücher am Straßenrand verschenkt. Oder auf einem Flohmarkt lässt sich günstiger Krimskrams kaufen. Doch braucht schließlich jedes Ding seinen Platz – bis eben keiner mehr übrig ist. Das Internet aber ist ein weites Feld. Hier bezahlen wir unsere Zugänge und Güter vor allem mit: Daten. Darum ist die Verlockung auch so groß, hier noch eine App runterzuladen oder sich in jenem sozialen Netzwerk anzumelden. Es kostet ja nichts – und vielleicht wird diese eine digitale Kommodität das Leben endlich angenehmer machen. So wie sie es alle versprechen.
Apps wollen Aufmerksamkeit
Zum Beispiel die Pflanzen. Wie schnell können die krank werden. Zum Glück gibt es eine App, die mit nur einer Fotoaufnahme mitteilen kann, was die Pflanze hat, was sie braucht. Oder das praktische digitale Kochbuch. Jeden Tag gibt es mindestens ein neues Rezept mit ganz herrlichen Zutaten – die man direkt auf einen digitalen Einkaufszettel setzen kann. Sie machen Sport? Das sollten Sie auf jeden Fall. Eine App kann helfen. Oder vielleicht gleich drei oder vier – für jeden Tag der Woche eine. Yoga, Pilates, Eigenkörpergewichtstraining. Darauf achten, dass die Übungen ohne Springen sind, sonst stört es die Nachbarn von unten. Und auf keinen Fall das Meditieren vergessen, wo kämen wir denn da hin! Scrollen Sie für Stunden durch den App-Store, um die Meditationsanwendung zu finden, die Ihnen am meisten Ruhe bringt. Freilich, all diese kleinen Programme können ungemein hilfreich sein. Zusammengenommen werden sie schnell zu einer Kakophonie der aufploppenden Botschaften. Besonders dann, wenn Pushnachrichten nicht ausgestellt werden. Dann wird deutlich: Diese Apps haben Bedürfnisse, sie wollen sich mitteilen.
Jede digitale Identität erzeugt Druck
Dabei haben wir noch gar nicht von den sozialen Medien gesprochen. Der endlose Reigen an Wörtern, Sätzen, Nachrichten, Fotos, Videos, der durch diese Plattformen zieht und, ob wir wollen oder nicht, ein Bild von dem wiedergibt, wer wir sind – im Internet. Manche noch ganz frisch, vor einigen Tagen eingestellt, nah dem, der wir derzeit sein wollen. Andere Jahre alt, peinlich berührend, von einer Zeit, einer Person zeugend, mit der wir heute vielleicht gar nichts mehr zu tun haben wollen. Und diese Plattformen wollen ja auch immer wieder neu befüllt werden. Sie sind nicht zufrieden damit, dass Sie gestern etwas gepostet haben – Sie müssen es heute noch mal tun. Sonst geht Ihr Algorithmus kaputt.
Dann gehen Sie in sich und überlegen, wo Sie sich über die vielen Jahre schon überall angemeldet haben. Wer ist nicht noch bei StudiVZ, obwohl er längst kein Student mehr ist? Wer bei Linkedin, obwohl er keinen Job sucht? Da sind die Blogbeiträge von vor zehn Jahren, in denen Sie versucht haben, Poesie zu verfassen. Oder die Reisebeiträge, in denen Sie Ihre vielen Erlebnisse verarbeiten wollten. Die hat damals niemand gelesen, was, wenn sie heute jemand entdeckt?
Denken Sie nur an die vielen Abonnements, die Sie noch abgeschlossen haben. Der Digitalausgaben diverser Zeitungen. Oder die vielen Newsletter, die jede Woche im E-Mail-Postfach landen. Jede Mail macht das schlechte Gewissen größer, dass wieder eine Woche vergangen ist, in der keine einzige dieser sicherlich wichtigen Postillen gelesen wurden. All das lässt sich löschen, der Ballast lässt sich nehmen.
Überforderung, Erschöpfung, Konzentrationsprobleme
Arthur Bohlender ist Psychologe mit eigener Praxis in Berlin. Der Umgang mit digitalen und sozialen Medien ist einer seiner Schwerpunkte. Er erlebe es öfter, dass Menschen zu ihm kommen, die Probleme mit dem Internet haben. „Viele haben das Gefühl, dass sie nicht nach eigenem Antrieb handeln“, sagt er. Vielmehr seien es Pushnachrichten, E-Mails und andere vermeintliche Verpflichtungen, von denen sich die Menschen getrieben fühlen. Sie hätten ständig das Gefühl, ihre vielen Kanäle pflegen zu müssen. Das könne sich auf unterschiedliche Weise äußern und zum Problem werden. „Überforderung, Erschöpfungszustände, Schwierigkeiten, sich noch zu konzentrieren.“ Einige empfänden den Drang, ständig ihre vielen Profile auf dem neuesten Stand zu halten. Andere bräuchten das Feedback von anderen Menschen – die Bestätigung, gesehen und gehört zu werden. Daher: „Digitale Entrümplung kann gut für das Selbstwertgefühl sein“, sagt der Psychologe.
Es gehe darum, diesen Konsum bewusst zu pflegen. Und auch, sich zu vergegenwärtigen, dass das Preisgeben privater Details im Internet risikoreicher ist als im eigenen Umfeld. Man könne sich eben nie sicher sein, wer das alles sehen kann. „Das Persönliche wird frei zugänglich. Das kann durchaus auch positive Seiten haben. Aber man muss sich eben bewusst sein, dass es so ist“, sagt er. Denn gerade durch diese Internet-Persona, die sich viele aufbauen, könne eine höhere emotionale Belastung entstehen. Durch das digitale Entrümpeln hingegen wieder eine Steuerbarkeit entstehen. Er gibt diese Empfehlung seinen Patienten immer wieder. „Wer aufräumt, wird aktiv. Trennt nützlich von unnützlich, erlangt wieder Kontrolle“, sagt er.
Löschen kann erholsam sein
Es kann also helfen, sich am Ende eines Jahres einen analogen Stift und Zettel zu greifen und im Gehirn zu googeln: Wo im Internet sind wir eigentlich? Und wie? Was davon tut uns gut, bringt uns Freude? Was trägt zur Last bei? Und dann gilt es zu löschen. Profile zu leeren, Seiten aus dem Netz zu nehmen. Accounts zu schließen, Abos zu kündigen. Noch einmal die Blogposts von damals durchlesen, um sie dann der Existenz zu berauben. Vielleicht drei der fünf Social-Media-Präsenzen verschwinden zu lassen, als wären sie niemals da gewesen. Diese Seite von uns, die aufrechtzuerhalten so viel Mühe gekostet hat. Vielleicht bemerken wir ja, dass dieses Grundrauschen, das ständige Surren, etwas leiser wird.
Und vielleicht merken wir auch, dass das Internet als solches und das Smartphone, das bei vielen schon mit im Bett liegt, eigentlich viele Annehmlichkeiten bringt. Kein Teufelswerk ist, sondern menschengemacht. Und damit gleichzeitig gewinnbringend und kraftraubend. Finden wir die Orte in diesem Netz, die uns wirklich bereichern. Der Rest darf lautlos werden.

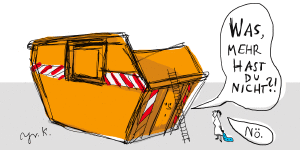


Leser*innenkommentare
Florian S. Müller
"alles ist so monoton
ohne smartphone"
(Graffiti, anonym)
Io Jap
"It's the economy, stupid."
Die meisten Apps buhlen um die Aufmerksamkeit der Users (ein englisches Wort, daher nicht gegendert) und darin liegt das Geschäftsmodell und somit der Zweck der App.
Eine Möglichkeit, dem zu entgehen, ist der konsequente Verzicht auf proprietäre Software und die ausschließliche Verwendung freier Software, also Open Source.
Diese hat ganz andere Ziele, i.d.R. nicht Datensammelei und Attention Grabbing. Wer z.B. Android nutzt, sollte den Google Play store gleich aus dem System werfen und durch F-Droid.org/ ersetzen und nur Apps von dort runterladen.
Da das Internet am PC viel weniger invasiv ist als ein Handy, welches man schlimmstenfalls sogar dabei hat, stellt sich eine andere Frage: Braucht man überhaupt ein Handy? (Ich habe diese Frage für mich vor Jahren negativ beantwortet.)
SimpleForest
@Io Jap Hab ein Handy, aber das ist kein Smartphone. Nur als Nachsatz für Ihren Abschluss - in dem Satz sollte besser Smartphone statt Handy stehen. Ansonsten stimme ich Ihnen zu was Open Source angeht, und das man am Computer sich wesentlich besser vor den Kritikpunkten des Artikels schützen kann.
Io Jap
@SimpleForest Ja, ein klassisches Handy ist weniger destruktiv als ein Smartphone. Das Konzept der Erreichbarkeit, immer und überall, wäre für mich aber in jedem Fall zu störend.
Kithaitaa
Digital Detox/Minimalism, so wichtig. Schöner Artikel, und "Finden wir die Orte in diesem Netz, die uns wirklich bereichern. Der Rest darf lautlos werden." ist ein sehr gutes Schlusswort.