SPD und Ampel: Das Orakel von Germany
Viel spricht für eine Ampelregierung auch wenn die schwierig wird. Trotzdem könnte Olaf Scholz werden, was Joe Biden für die USA ist.

Illustration: Katja Gendikova
Zu den paradoxen Charakteristika unserer Zeit zählt: Je bedrohlicher die Lage und um so verunsichernder die Polykrisen sind (Corona, Wirtschaft, Klimakatastrophe), desto zentraler wird das Sicherheitsbedürfnis der Menschen. Eigentlich braucht es radikale Änderungen, aber gerade deshalb ist es verständlich, dass die Bürger und Bürgerinnen beim Wählen vorsichtig sind.
Denn wer will schon riskante Experimente, wenn sowieso schon überall alles kracht und kollabiert? Wer etwas verändern will, muss zugleich versprechen, dass alles schon ganz gemäßigt und solide angegangen werde. Auch das ist eine Lehre des deutschen Wahlsonntags.
Die SPD hat gewonnen, aber nicht triumphal. Die Union ist gerade noch mit einem blauen Auge davongekommen. Auch sonst blieb alles im Rahmen, und bei der berühmten Links-rechts-Achse steht es eher fifty-fifty. Die Wähler und Wählerinnen haben gesprochen. Aber was wollen sie uns damit sagen?
Zunächst: Die Sozialdemokraten haben diese Wahl gewonnen, und zwar gar nicht so undeutlich. Schließlich liegen sie nicht nur knapp 1,6 Prozentpunkte vor der Union. Die Union hat rund 10 Prozentpunkte verloren, die SPD 5 gewonnen, und nimmt man die Umfragen der vergangenen Jahre, hat sie sogar 10 Punkte zugelegt. Gemessen an der Ausgangslage ist das ein mittleres Wahlwunder.
Es wäre zu billig, das alleine auf Zufälle oder auf Personen zu reduzieren. Was heißt denn Sozialdemokratie für den Großteil der Wähler und Wählerinnen? Auf Seite der normalen Leute stehen, für die Arbeiter sein, dafür sorgen, dass es gerecht zugeht, garniert mit etwas gesellschaftspolitischer Modernisierung. Wenn Sozialdemokraten nur ein wenig den Eindruck erwecken, in dieser Hinsicht ein wenig glaubwürdiger zu werden, dann werden sie zurzeit gewählt.
Nach Hartz IV
Die Deutung, dass die SPD bloß einen guten Wahlkampf gemacht habe, die Union eben einen schlechten, greift schon etwas arg kurz. Olaf Scholz ist maßvoll, aber markant nach links gerückt. Der eher linke und der eher rechte Flügel der Partei zogen an einem Strang. Mit den Botschaften Mindestlohn, Respekt und ein investierender Staat zeichnete die SPD ein kongruentes Bild und macht damit sogar ihr Hartz-IV-Trauma vergessen. Der Kandidat verkörperte die Botschaft: Scholz kann’s, der wird das solide machen.
Bloß: Armin Laschet ist ja auch nicht der unfähige Volltrottel, als der er jetzt gerne hingestellt wird. Aber er repräsentierte eine zerrissene Partei, die nicht mehr weiß, wo sie hinwill. Eigentlich hatte er schon verloren, bevor alles begann. Man erinnere sich an das Fiasko im Parteivorstand bei der Nominierung des Kandidaten. Es geht alles schief, rief Wolfgang Schäuble da mal in einer der vielen Krisensitzungen in der Nacht aus. So war es.
Die Sozialdemokraten wurden also stärkste Partei, weil sie Sozialdemokraten sind – und nicht, weil Olaf Scholz smart genug ist, Lachkrämpfe zu vermeiden, wenn er durch vom Hochwasser zerstörte Städte latscht.
Vielleicht hilft ja ein Blick über den deutschen Tellerrand hinaus. Sozialdemokraten haben in vielen Ländern Europas in jüngster Zeit Wahlen gewonnen. Sie regieren in ganz Skandinavien, in Dänemark, in Spanien und Portugal, und mit Joe Biden sitzt ein Mann im Weißen Haus, der viel mit Olaf Scholz gemeinsam hat. Er ist ein Mann aus dem Zentrum seiner Partei, der sich mit einem erstarkten linken Parteiflügel arrangierte, der als Präsident linker ist, „als es der Senator Joe Biden je war“ (Die Zeit).
Das Erfolgsrezept: Mitte-Links
Biden punktet heute mit den klassisch progressiv-sozialdemokratischen Botschaften. Dazu gehört, dass die Gesellschaft „von unten und aus der Mitte heraus wieder aufgebaut“ werden müsse. Denn die Entfesselung der Märkte und der Trickle-down-Effekt haben nicht funktioniert. Denn die Reichen werden reicher, die Armen ärmer.
Die Menschen wollen nun soziale Sicherheit, ordentliche Löhne und nicht wie Nummern behandelt werden. Sie wollen auch nicht herumkommandiert werden. Man liegt gar nicht so arg schief, wenn man in Olaf Scholz den Joe Biden Deutschlands sieht.
Daraus wird nicht automatisch ein neues sozialdemokratisches Jahrzehnt, wie es manche plötzlich schon proklamieren. Anders als in früheren Epochen verkörpern die Sozialdemokraten keinen planetarischen Zeitgeist. Die Gesellschaften sind polarisiert und die Wahlsiege sind auch viel zu knapp.
Heute wird man – jedenfalls in Demokratien mit Verhältniswahlrecht – oft mit 25 Prozent Stimmenanteil schon stärkste Partei. Das bedeutet aber auch, dass Sozialdemokraten eher klapprigen Koalitionen vorstehen und dabei so viele Kompromisse eingehen müssen, dass sie am Ende wenige Spuren hinterlassen. Abgesehen von der Ausnahmefigur Antonio Costas in Portugal sitzt kaum ein regierender Sozialdemokrat auf einer soliden strategischen Mehrheit.
Aber: Es gibt eine Nachfrage nach Sozialdemokratie, die dann zum Tragen kommt, wenn das Angebot einigermaßen stimmt.
Sogar Kommunisten können siegen
Es ist vielleicht nur ein skurriler Zufall, dass in der zweitgrößten Stadt Österreichs – in Graz – zeitgleich zur deutschen Bundestagswahl bei den Kommunalwahlen die Kommunisten stärkste Partei (!) wurden und die konservative Volkspartei gleichsam zertrümmerten.
Die Grazer Kommunisten präsentieren sich seit 25 Jahren volksnah, bescheiden und auf der Seite der Benachteiligten. Das Ergebnis sind jetzt 30 Prozent (die Grünen haben 16, die Sozialdemokraten fast zehn, was sich auf eine satte Mehrheit links der Mitte summiert). Klar hat dieser Erfolg der KPÖ etwas Irreales. Aber er ist auch ein Symptom.
Zurück nach Deutschland. Die Union hat zwar den Traum noch immer nicht aufgegeben, sich irgendwie zurück ins Kanzleramt zu tricksen. Aber diese Versuche haben eine bescheidene Legitimität. Gewiss, das Grundgesetz steht dem nicht im Wege. Aber Armin Laschet als Kanzler würde der Botschaft der Wählerinnen und Wähler schon arg widersprechen.
Die Union, die sich gerade im Schlammcatchen übt, wirkt nicht einmal verhandlungs-, geschweige denn regierungsfähig. Im Grunde sollte daher alles auf die Ampel aus SPD, Grünen und FDP zulaufen. Nur: Diese Konstellation versetzt niemanden in wirkliche Feierlaune. Die Gewählten auch nicht.
Rot-Grün war ein logisches Projekt
1998 war das anders. Da kletterten wir Journalisten vor der SPD-Baracke in Bonn auf die Laternenmasten, um im Meer der Feiernden irgendetwas zu sehen. „Rot-Grün, Rot-Grün“, skandierten Tausende. Damals hatte eigentlich keiner mit Rot-Grün gerechnet. Eine von der SPD geführte Große Koalition schien vor der Wahl unausweichlich. Aber kaum waren die Hochrechnungen einigermaßen klar, erschien Rot-Grün wie ein logisches Projekt, das dem Zeitgeist entsprach.
Knapp dreißig Jahre vorher war das wahrscheinlich auch nicht anders gewesen, als sich die Brandt-SPD mit der FDP Walter Scheels zusammen tat, als Allianz einer modernistischen Sozialdemokratie mit dem liberalen Teil des deutschen Bürgertums.
Bei der Ampel bekommt kaum jemand leuchtende Augen. Das beginnt schon mit der Sozialdemokratie, für die es heute keine Verlockung sein kann, in die Mitte zu rücken, sich Richtung liberaler Gesellschaftspolitik zu modernisieren. Sie ist, simpel gesagt, in dieser Richtung modern genug.

Dieser Text stammt aus der taz am wochenende. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im Wochenendabo. Und bei Facebook und Twitter.
Sie muss eher wieder Repräsentant der sogenannten einfachen Leute werden, die mit Recht lange das Gefühl hatten, dass sich für sie niemand mehr interessiert. Die Sozialdemokraten müssen eher geerdeter, gewerkschaftlicher werden, aber zugleich die Balance mit den jüngeren, städtischen linken und linksliberalen Milieus halten. So wie das Joe Biden macht, der die White Working Class im Mittelwesten ansprechen muss und zugleich die Fans von Alexandria Ocasio-Cortez.
Die soziale Krise und der Kampf gegen die Klimakatastrophe verlangen einen intervenierenden starken Staat, der baut, investiert, modernisiert, begrünt, Stromleitungen legt, die Infrastruktur für die E-Mobilität schafft. Dabei können sich Sozialdemokraten und Grüne ja noch recht leicht treffen.
FDP ist auf der Suche nach sich selbst
Das Problem ist eine FDP, die im Grunde schon lange nicht recht weiß, was sie sein soll, liberale Bürgerrechtspartei im Traditionsstrom der Aufklärung oder AfD für Besserverdienende mit Schick und Geschmack? Das ist übrigens auch nicht völlig neu. Auch vor vierzig Jahren war sie zerrissen zwischen dem Linksliberalismus von Hildegard Hamm-Brücher und Co auf der einen Seite und einem piefig-provinziellen, sehr rechten Nationalkonservativismus, der viele Basisorganisationen prägte. Parteivorsitzende der FDP hatten immer einen Wackelkurs zu gehen. Das ist auch das Problem von Christian Lindner, der deshalb viele Leute irritiert, weil so recht nicht klar ist: Wer ist das eigentlich? Was will er?
Vielleicht hilft der FDP ja ein Blick auf ihr Wählerpotenzial. Bei den Jungwählern bis 24 Jahre sind die Liberalen stark. Mehr als 20 Prozent der Jüngeren haben die FDP gewählt. Man kann vermuten, dass viele dieser Wähler eine Fantasie gewählt haben. Die Jungwähler sind nicht alle 18-Jährige aus der Erbengeneration, die schon im Gymnasium Ralph-Lauren-Hemden tragen und im Kinderzimmer vor ihrem Computer von einem Leben im Investmentgeschäft träumen. So viele deprimierende Jugendliche gibt es gar nicht. Diese jungen Leute haben die FDP gewählt, weil sie sie für frischere Grüne halten und für etwas lustiger als die Sozis. Für vernünftig, faktenorientiert und unideologisch.
Man stelle sich vor, die FDP würde ein paar Dogmen abschütteln und sich in Richtung dieser Fantasie entwickeln. Dann hätte die Ampel neben einer Mehrheit vielleicht sogar auch noch eine Geschichte zu erzählen.



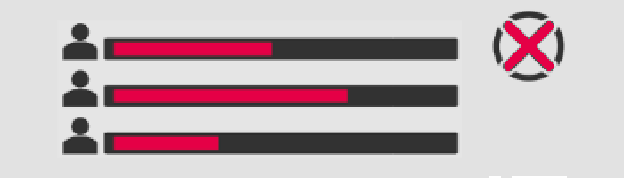



Leser*innenkommentare
Joachim Petrick
Auch wenn das, zugegeben, Glückskeks fern, nur als hart bitteres Brot wahrgenommen werden kann, sollte als Ergebnis des Schmalspur Bundestagswahlausgangs 2021, bei dem SPD vor allem in neuen Bundesländern Zugewinn errang, Rückspiel der Groko bei umgekehrtem Vorzeichen mit SPD Kanzler Olaf Scholz an der Spitze als Option auf dem Tisch bleiben, abzuwägen, was passiert, wenn die CDU/CSU als Srömungsstruktur unterwegs innerlich zerstritten in erschüttern desolatem Zustand muttifern auf Oppsoitionsbänken neben der AfD im Deutschen Bundestag sitzt, ausgewildert in beachtlichen Teilen zu Vereingigung in Bund, Ländern mit AfD strebt, ob es da gesellschaftlichpolitisch nicht angesagt ist, UNION mit Groko als Scharnier an der Seite SPD unter Druck nun stärkerer Opposition aus Grünen, FDP, Linkspartei diszipliniert natürlichere Weise deren Schrumpfungsprozess in Richtung SPD, Grüne, FDP, Linkspartei statt in Richtung AfD einzuleiten, Ergebnis zu vermeiden, dass AfD 2025 als Großstruktur bei nächster Bundestagswahl auf dem Bildschrim der Demoskopen erscheint?
BazaarOvBirds
"Denn die Entfesselung der Märkte und der Trickle-down-Effekt haben nicht funktioniert. Denn die Reichen werden reicher, die Armen ärmer."
Ist schlichtweg eine fehlerhafte Analyse, denn der Kapitalismus lebt von gezielten Fesseln an den richtigen Stellen; weder von bloßer Entfesselung der Märkte (dies hätte soziale Implikationen), noch von willkürlicher, oder in Summe gar im Interesse von sozial Schwächeren stehender, Intervention.
Together_First
Sehr gute Analyse. Bin gespannt, ob die Fantasiepartei wirklich ein paar Fantasieschritte geht. Und wenn nicht und die Grünen am Ende sagen, so nicht, dann ist es eben so, aber keine muss der verpassten Chance hinterherweinen. Man muss nicht zu allem "ja" sagen.
Galgenstein
Die Frage ist: wo gibt's mehr Stillstand? Mit Jamaika oder der Ampel?
Welche Konstellation ist wirksamer gegen den Klimawandel?
Mustardmaster
"Die SPD hat gewonnen, aber nicht triumphal. "
Hier widerspricht sich der Autor schon im nächsten Absatz:
"Zunächst: Die Sozialdemokraten haben diese Wahl gewonnen, und zwar gar nicht so undeutlich. Schließlich liegen sie nicht nur knapp 1,6 Prozentpunkte vor der Union."
Der Vorsprung von 1,6% ist nach meinem Empfinden sehr knapp.Reines Glück. Und wenn die stärkste Partei von einem Viertel der Wähler gewählt wird, finde ich ich den Titel "Gewinner" etwas großkotzig. Am wenigsten schlecht abgeschnitten wäre passender. Oder : Letzter Verlierer. ;-)
Kai Nothdurft
"Trotzdem könnte Olaf Scholz werden, was Joe Biden für die USA ist."
Ja stimmt - die zweite Wahl.
32533 (Profil gelöscht)
Gast
@Kai Nothdurft Ich weiß nicht, ob Sie es auch so meinen. Für mich war Joe Biden die zweite Wahl - hinter Bernie Sanders.
Einen deutschen Sanders konnte ich bislang noch nicht entdecken. Und auch keinen, dem es zuzutrauen wäre.
Womit wir wieder bei den Eiern wären.
Martin Rees
In PazifistInnen-Sachen/
Wäre es wohl doch zum Lachen/
Wenn eine SPD/
Wie ich das seh/
Kann das Programm nicht mitmachen./
//
10/21, MR
//
taz.de/Abkommen-ue...enverbot/!5745773/
//
Martin Rees
Scholzomat, wenn Sie es schaffen/
Das Gebot, dass "Atomwaffen/
Sind verboten"/
Jetzt auszuloten/
Würden wir PazifistInnen gerne gaffen./
//
Oktober 2021, MR
tomás zerolo
"Man stelle sich vor, die FDP würde ein paar Dogmen abschütteln und sich in Richtung dieser Fantasie entwickeln."
Ahem. Ich würde mir das ja auch wünschen. Dann aber würden sie ihre grössten Geldquellen verlieren.
Mondschaf
„Bei den Jungwählern bis 24 Jahre sind die Liberalen stark. [....] ..vor ihrem Computer von einem Leben im Investmentgeschäft träumen. So viele deprimierende Jugendliche gibt es gar nicht. Diese jungen Leute haben die FDP gewählt, weil sie sie für frischere Grüne halten und für etwas lustiger als die Sozis. Für vernünftig, faktenorientiert und unideologisch.“
Sehr lustig. Thelen und Maschmeyer haben mit Großspenden an die FDP die Grundlage für Nutzung digitaler Ansprache gelegt. Digital first, (Be)Denken second. Jungwähler*innen der FDP träumen vom Lindner-StartUp oder sie wollen Influencer*innen werden. Im Privatfernsehen lädt der Löwe zum Besuch seiner Höhle ein. Der Fuchs hat erkannt, dass die Spuren der Gäste nur in die Höhle hineinführen.
F inanzstarke
T helen
P artei.
Lowandorder
@Mondschaf Ja. Heute tue ich mich mit Robert Misik auch schwer. Die hier konstatierte “Sehr lustig“-Kritik - anschließe mich.
& zudem - sorry - verrutschte Parameter
“
Knapp dreißig Jahre vorher war das wahrscheinlich auch nicht anders gewesen, als sich die Brandt-SPD mit der FDP Walter Scheels zusammen tat, als Allianz einer modernistischen Sozialdemokratie mit dem liberalen Teil des deutschen Bürgertums.“
Mit Verlaub - That’s wrong.
Während - wie hier zu recht konstatiert - heute eine orientierungslos vor sich hintaumelnde FDP mit dem “alten Blödmann“(PUseiPerle!) Lindner als Gallionswitzfigur in Frage steht!
Hatten damals die Jungtürken IM NRW Willi Weyer - HochaufdemgelbenWagen Löckchen Walter Scheel - der schwer braun(Mende)lastigen F.D.P. runderneuernd die Punkte weggekloppt & “die Zöpfe abgeschnitten! Schonn But!
“… ein logisches Projekt, das dem Zeitgeist entsprach.“ war Willy Brandt + Walter Scheel - gerade nicht. Insbesondere Onkel Herbert Wehner - war striktemang dagegen. Newahr
Nein - es war Willy Brandt - der nach Wahlkämpfen von unterirdischen Diffamierungen (Wer war Herbert Frahm? => Ol Conny!;(( bis “mit dem Hut in der Hand - zieht der Willy durch das Land“ als kleinKennedey in offener Limousine - die Schnauze voll hatte! Alle düpierte & beherzt zugriff! Gellewelle.
Der Rest ist Geschichte. Normal.
Will sagen - die Karten lagen nach der aE dahinsiechenden Dr. 🪖et 🥬 für Rot-Grün - ungleich klarer auf dem Tisch.
& vor allem aber:
Ist/war/ist das zur Wahl stehende “Personal“ für die res publica - die Republik des Souveräns - der Bürger also - und zwar querbeet durch alle Parteien - justament von geradezu atemberaubender bis dato ungekannter Mittelbissuboptimalität • mit zudem vielfältig Dreck am Stecken.
Nicht nur - daß von der noch amtierenden Regierung mehrer Minister (Andi - Jens - B’Scheuert …bitte selbst einsetzen;)( - von rechts wegen in den Knast gehören.
& das aktuelle Personal? => gleich ff =>
Budzylein
@Lowandorder Das mit den Punkten im Parteinamen der FDP stimmt nicht. Es war genau umgekehrt: Die Punkte (F.D.P) wurden 1968 eingeführt, dem Jahr, in dem Scheel den FDP-Bundesvorsitz von Mende übernahm und sich allmählich die sozialliberale Koalition anbahnte. Insofern waren die Punkte eher ein Symbol für das Abschneiden der alten Zöpfe. 2001 hat die FDP die Punkte wieder abgeschafft.
Lowandorder
@Budzylein Danke. Sie haben recht.
Das zerschlissene Mäntelchen der Erinnerung - wa - 🥳 -
de.wikipedia.org/w...mokratische_Partei
Aber ganz schön braun!
“ Bis in die 1950er Jahre hinein standen einige Landesverbände der FDP rechts von den Unionsparteien, die ihrerseits anfänglich noch Konzepten eines christlichen Sozialismus nachhingen. Mit national orientierten Grundwerten wurde um Stimmen auch ehemaliger Nationalsozialisten und Beamter des NS-Staates geworben. So ist es dann für die damalige Einordnung bezeichnend, dass die FDP im Deutschen Bundestag stets „rechts außen“ zu finden war, indem ihr die Plätze rechts von der Union zugewiesen werden.…“
& Däh
“… Die FDP stimmte im Bundestag gegen das von CDU und SPD Ende 1950 eingebrachte Entnazifizierungsverfahren. Auf ihrem Bundesparteitag 1951 in München verlangte sie die Freilassung aller „so genannten Kriegsverbrecher“ und begrüßte die Gründung des Verbands deutscher Soldaten aus ehemaligen Wehrmachts- und SS-Angehörigen, um die Integration der nationalistischen Kräfte in die Demokratie voranzubringen. Die nach Werner Naumann benannte Naumann-Affäre (1953) kennzeichnet den Versuch alter Nationalsozialisten, die Partei zu unterwandern, die in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen viele rechtskonservative und nationalistische Mitglieder hatte. Nachdem die britischen Besatzungsbehörden sieben prominente Vertreter des Naumann-Kreises verhaftet hatten, setzte der FDP-Bundesvorstand eine Untersuchungskommission unter dem Vorsitz von Thomas Dehler ein, die insbesondere die Zustände in der nordrhein-westfälischen FDP scharf rügte. In den folgenden Jahren verlor der rechte Flügel an Kraft, die extreme Rechte suchte sich zunehmend Betätigungsfelder außerhalb der FDP.“
& sodele - das Jungtürkenintermezzo =>
Wahl%-Achterbahn - bis zum vorläufigen Tiefpunkt: Die FDP mit 73 Stimmen über 5% - stellte mit Thomas Kemmerich den Ministerpräsidenten von Thüringen - mit den Stimmen der Arschlöcher für Deutschland!
Lowandorder
@Lowandorder & das aktuelle Personal =>
Na klar! Schlimmer geht immer - wa!
Normal
Wirecard => ein Gröfimaz Scholz - der sich dieserhalb/Wirecard - nicht erinnert. Ein CDU/CSU designierter Gröfimaz Merz als BlackRocker (& btw ein Präsi Herbarth in Karlsruhe - der via (s)einer Anwaltskanzlei mit Cum-ex in ein offen kriminelles Steuerbetrugssystem involviert war!)*
& als Schlagobers der CDU/CSU Kandidat -
Die Öscher Prent Armin Lasset - der öffentlich bekundet - daß ihm die Brandschutzvorschriften nur ein Vorwand waren! Um Hambi abzuräumen! Unfaßbar!
Was nämlich in Italien oder Frankreich aufgrund derer Untersuchungsrichtertradition - ihn längst in den Knast - U-Haft - befördert & zur Durchsuchung & Versiegelung seines Büros einschließlich Beschlagnahme - auch seines Digitalkrams geführt hätte. Und seinem Staatskanzleichef Nathanael Liminski dürfte ähnliches blühen •
Aber eine weisungsabhängige StA NRW - hält in vorauseilendem Gehorsam schön die Füße still •
Soweit mal & Na Mahlzeit
unterm—— servíce —-*
“ Cum-ex Geschäfte
Von Einzelnen wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Cum-Ex-Geschäfte in Harbarths ehemaliger Kanzlei Shearman & Sterling „zur juristischen Reife“ gebracht worden seien.[41] Lars Wienand schrieb hierzu auf T-Online.de über Harbarth: „2000 steigt er bei der Großkanzlei Shearman & Sterling LLP ein. Seine Zeit dort fällt in die Jahre, als auch dort die Cum-Ex-Modelle ausgetüftelt werden. Um den Staat auszuplündern.“
de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Harbarth
Danach kommt noch weiteres zumindest unappetitliches - was aber alles - so auch von Christian Rath inne taz - abwegig unter Befangenheit etc rubiziert wird: Sojet Jurist gehört schlicht nicht nach Karlsruhe! Bin mir sicher - ein mE unverzichtbares Hearing vor Bundestag & Bundesrat hätte der feine Herr nicht überstanden •
Alwin3012
Es reicht mit den angeblichen H4 Trauma. Das existiert nur in linken Kreisen.
Ich bin seit 1990 Mitglied der SPD und der IGM, seit meiner "Ankunft" im Westen.
Als Betriebsrat spreche ich mit hunderten "Malochern", auch wenn die sich so schon lange nicht mehr sehen.
Als Gewerkschaftler habe ich die Schliessung von Conti in Bamberg begleitet. Da ist nicht von einem H4 Trauma zu spüren, im Gegenteil.
Von 700 Betroffenen hatten 58% schon vor Schliessung wieder einer Arbeit gefunden.
Auf Ablehnung stößt weniger H4 als solches sondern die Gleichbehandlung von 20 wie auch 58 jährigen.
Ein Beraten von Bill Clinton hat mal auf einen Zettel geschrieben "it´s the economy, stupid".
Viele junge Leute mit denen ich spreche sehen bei den Grünen und er SPD nicht genügend Kompetenz in Fragen der Wirtschaft, wollen eine "Leitplanke" gegen die Rufe der Linken.
Gerade hier im Grenzgebiet Bayern/Thürigen wird schnell klar auf welcher Seite hohe Löhne gezahlt werden, und wer dort regiert.
mensch meier
@Alwin3012 Was ein Unsinn!
Der Lohn in Thüringen ist doch nicht gesunken als Ramelow gewählt wurde.
Unter schwarz-schwarzen Konditionen war das Lohngefälle doch genauso... Und es wurde durch die CDU als Niedriflohnsektor so installiert.
O-Weh
@Alwin3012 "it´s the economy, stupid" - Das könnte auch von Bernie Sanders sein. Politische Begriffe sind in den USA nämlich bischen anders besetzt. Unter "economic policy" fällt dort alles, wo es ums Geld geht, also zB auch Sozialhilfe, Rente, bezahlbare Mieten, usw.
Nicht wie hier, wo "Wirtschaftspolitik" gleichgesetzt wird mit wahlweise Unternehmern (CDU) oder der Industrie (SPD) alles recht zu machen.
Andreas J
@Alwin3012 Das H4-Trauma existiert nicht in linken sondern in armen Kreisen. Gibt offensichtlich immer noch SPDler die das nicht wahrhaben wollen. Das war der Preis für Schröders Niedriglohnsektor mit dem er die europäische Konkurrenz aus dem Weg räumte. Scheiß Seeheimer Kreis.
32533 (Profil gelöscht)
Gast
@Alwin3012 Da hätten Sie mal besser mit dem ein oder anderen Empfänger von HartzIV sprechen sollen. Die meisten von denen sind Tafel-Gänger.
Gewerkschaften und Arbeitslose: KEINE Liebes-Beziehung.
Wohl dem, der primär den Lohnabstand auf seiner Agenda hat.
Der "Beraten" von Herrn Clinton hätte besser etwas anderes auf einen Zettel geschrieben, Herr Grimm.
Was Bayern und Thüringen angeht: mal auf die dort angesiedelten Betriebe schauen. Dann fällt es Ihnen vielleicht wie Schuppen aus den Haaren.
Äpfel und Glühbirnen gibt Kompott mit Scherben. Wer's mag ...
Lowandorder
@32533 (Profil gelöscht) anschließe mich - beiden Vorrednern.
Fehlt eigentlich nur noch ollen Münte:
“Wer nicht arbeitet - soll auch nicht essen!“
Er & GazpromGerd - Klassenverräter •
Nothing else.
kurz - Volkers 👄 Ruhrgebiet =>
“Die bede & Puffreisenunternehmer Peter Hartz kriminell - alle in eenen Sack & mit Papa Wrangel “immer feste druff!“Triffst immer die richtigen! Woll“
BazaarOvBirds
Also ich bekomme bei den mit der Ampel anstehenden gesellschaftlichen Liberalisierung, dem voranschreitenden klimafreundlichen Strukturenwandel (so hoffe ich als einfache Bürger*in zumindest) und auch den Steuersenkungen (ganz ehrlich, sogar ihr Leser*innen hier werdet zugeben müssen, dass die Steuerlast in Deutschland absurd hoch ist) und der Entbürokratisierung durchaus Hype.
mensch meier
@BazaarOvBirds Unsere Steuerlast ist nicht hoch.
Wir bekommen nur weniger staatliche Dienstleistung als schön wäre.
Und als Normalverdiener muss man sich vor Augen halten, dass jeder Cent Steuerersparnis zu substanziellen Verschlechterungen bei den Leistungen führt.
Denn die was wir sparen, sparen die Großverdiener zehnfach!
Pfanni
„Die Grazer Kommunisten präsentieren sich seit 25 Jahren volksnah, bescheiden und auf der Seite der Benachteiligten“
Dass Kommunisten auch ganz anders können, nämlich wenn sie keine Opposition befürchten müssen, bewiesen die deutschen Kommunisten nach 1945. Zunächst „vereinigten“ sie sich mit der SPD in der sowjetisch besetzten Zone (heute würde man eher von feindlicher Übernahme sprechen) zur SED. Diese war dann 40 Jahre lang die Staatspartei der DDR. Ein „Paradies der Werktätigen“ konnte sie nicht schaffen. Mangelwirtschaft und misstrauische Überwachung des Volkes waren die Regel bis zur Wende 1989.
Das kam nicht von Ungefähr: Die DDR-Kommunisten folgten den Lehren von Marx (der die Theorie lieferte) und Lenin (der die Praxis in der Sowjetunion vormachte).
Viele Linke möchten heutzutage nicht mehr gern daran erinnert werden, aber in der deutschen Linkspartei träumen immer noch manche von einer DDR 2.0. Möge das den Österreichern und den Deutschen erspart bleiben erspart bleiben.
Lowandorder
@Pfanni 🍳 🥵?
Pfanni
@Lowandorder Eine Antwort in Klartext würde mir weiterhelfen!
Andreas J
"macht damit sogar Hartz-IV-Trauma vergessen". Bestimmt nicht für die Harz4-Traumatisierten. Was für Blödsinn.
O-Weh
206+118+45 = 369, ein Sitz mehr als absolute Mehrheit. Das ist die Option, über die bisher niemand spricht. Weil gut 70 Jahre Vergangenheit dagegen sprechen. Wurde aber ja schon oft genug betont, daß nach dieser Wahl alles anders ist.
Sofern sie sich klar auf die Zukunft orientiert, spräche für die CSU soger einiges für einen radikalen Bruch.
* Armin Laschet und die CDU allein als Verlierer dastehen lassen. Wer zuletzt lacht …
* Den Hauptauftrag der Wähler wahrnehmen und weiterhin bayerische Landes-Interressen in der Bundesregierung vertreten. Zuverlässigkeit gebaut auf machtpolitischem Pragmatismus.
* Damit beste Aussichten für die nächste Bayern-Wahl. Hauptgegner der CDU dort waren schon 2018 die Grünen, nun womöglich noch die SPD mit Kanzlerbonus. Besser als mit einem Bündnis im Bund könnte man beiden gar nicht den Wind aus den Segeln nehmen.
* In Bayern würde sich ein Bündnis gegen die CSU quasi verbieten, sollte es möglich werden: Grüne oder SPD müssten als Junior die CSU stützen, um die Bundes-Koalition nicht zu gefährden.
* Der absehbar ein paar Legislaturperioden andauernden Marginalisierung der Union ein Schnippchen schlagen. Bayerischen Exzeptionalismus zementieren.
* Die mit der CDU geteilte Weltanschauung steht sowieso meilenweit hinter "mia-san-mia"
Für SPD und Grüne widerum dürfte der inhaltliche Hauptkonflikt mit der FDP - der investierende Staat - sich mit der CSU leicht ausräumen lassen - sofern bloß in Bayern genug ankommt - das war schon immer die Quintessenz der CDU in der Bundesregierung. Sie dazu in Sicherheitsfragen bischen poltern lassen und ein paar symbolische Erfolge - auf mehr Personal und Budget kann man sich eh einigen.
Der Haken: Das Projekt müsste innerhalb der CSU erdacht werden. Hat es öffentlichkeitswirksam in linkem Milieu seinen Ursprung, ist es eine Todgeburt. (das hier liest doch niemand, oder?)
sàmi2
@O-Weh Ich lese da vor allem viele Argumente, das nicht zu machen.
O-Weh
@sàmi2 "… für die CSU …" ist die Sammlung.
Für R-G wären das zu schluckende Kröten, um Schlimmeres zu verhindern: Die "roten Linien" der FDP.