Rolle des Geschlechts bei Krankheiten: Warum Frauen häufiger Covid haben
Frauen erkranken häufiger an Covid-19 – und Männer schwerer. Auch bei anderen Erkrankungen gibt es große Unterschiede zwischen den Geschlechtern.

Die Krankheitssymptome sind bei Frauen oftmals anders als bei Männern Foto: Natalia Bazina/plainpicture
Wenn ein Virus geschlechtsspezifische Organe wie etwa die Gebärmutter einerseits oder die Prostata andererseits trifft, ist klar, dass er Männer und Frauen in unterschiedlichem Maße trifft. Doch gilt das auch für Viren, die über die Atemwege in den Körper gelangen? Gilt es also auch für Covid-19? Die Antwort darauf ist laut einer Schweizer Studie ein klares Ja.
Das Forscherteam um Catherine Gebhard von der Universität Zürich sieht – nach Durchsicht des international zur Verfügung stehenden Datenmaterials – in der Coronapandemie einen abermaligen Beleg dafür, „dass das Geschlecht im Gesundheitsbereich eine bedeutende Rolle spielt“. So fand man in China bei Männern eine ums 2,4-fache höhere Covid-19-Sterberate als bei den Frauen. In der Schweiz ist sie 1,6-mal so hoch, und in Deutschland machen die Männer 53 Prozent aller Coronatoten aus, obwohl sie beim Anteil der positiven Fälle klar in der Minderheit sind. Was im Endeffekt heißt: Frauen erkranken zwar häufiger, und – wie die Forscher zudem ermittelt haben – langwieriger als Männer, doch die erkranken dafür schwerer und tödlicher an Covid-19.
Die Ursachen für diese Unterschiede sind vielfältig. So ist schon länger bekannt, dass Männer einen ungesünderen Lebensstil pflegen, beispielsweise mehr rauchen, mehr Alkohol trinken und öfter übergewichtig sind, was sich generell auf ihre Widerstandskraft bei Infekten niederschlägt. Frauen hingegen hat die Evolution mit einer besonders starken Immunantwort ausgerüstet, weil sie als Schwangere und Stillende direkter und stärker in der Versorgung des Nachwuchses gefordert sind – und um den dreht sich bekanntlich in der Evolution fast alles.
Eine Schlüsselrolle spielt beim weiblichen Immunitätsvorsprung, wie Gebhard ausführt, das Östrogen. „Es ist denkbar, dass das weibliche Immunsystem aufgrund dieser hormonellen Besonderheit schon in einem frühen Stadium von Covid-19 aktiv wird und es daher seltener zu schweren Verläufen kommt“, so die Kardiologin, die seit 2016 in Zürich zur Gender-Medizin forscht.
Eine Schlüsselrolle spielt beim weiblichen Immunitätsvorsprung das Östrogen
Ihr Forschungsbereich, in dem es um die geschlechtsspezifischen Besonderheiten von Krankheiten geht, erfreut sich in den letzten Jahren – nach langem Schattendasein – einer zunehmenden Aufmerksamkeit in der Medizin. Denn Frauen erkranken anders als Männer, aber diagnostiziert und behandelt werden sie oft gleich.
Östrogen schützt die Gefäße
Das zeigt sich etwa beim Herzinfarkt, der lange Zeit als eine Männerdomäne galt. Was zwar immer noch stimmt, wenn es um die jüngeren Jahrgänge geht, weil Frauen in dieser Phase wegen ihres Östrogens über einen effektiven Gefäßschutz verfügen. „Doch mit den Wechseljahren endet dieser Schutz“, betont Hugo Katus, Direktor der Kardiologie am Universitätsklinikum Heidelberg. Frauen bekämen ihren Herzinfarkt deshalb etwa sieben Jahre später – doch am Ende sei bei ihnen das Risiko für den koronaren Gefäßverschluss ähnlich hoch wie beim Mann.
Bei über 65-jährigen Frauen mit Herzinfarktsymptomen dauert es bis zu viereinhalb Stunden, bis sie in der Notaufnahme sind. Bei gleichaltrigen Männern geht das etwa eine Stunde schneller.
Frauen sterben hierzulande häufiger an Herzkrankheiten, obwohl diese bei Männern deutlich öfter auftreten.
Kindliches Asthma wird bei Mädchen später diagnostiziert als bei Jungen, weil sie beim Atmen seltener die krankheitstypischen Pfeifgeräusche abgeben, sondern oft nur einen trockenen Husten haben.
In einer Umfrage unter rund 2.400 Frauen mit chronischen Schmerzen gaben gut 45 Prozent der Befragten an, mindestens einmal von einem Arzt gehört zu haben, dass sie sich ihre Schmerzen nur einbilden würden.
Bei den Symptomen gibt es allerdings große Geschlechterunterschiede. „Frauen berichten seltener über Brustenge und den starken Vernichtungsschmerz im Brustraum“, berichtet Katus. „Stattdessen stehen bei ihnen unspezifische Symptome wie Schwitzen, Bauchschmerzen und Übelkeit im Vordergrund.“ Der Grund: Weil sie ja bei ihrem Infarkt in der Regel schon älter sind, gelangen bei ihnen weniger Schmerzsignale zum Gehirn. „Außerdem finden wir bei ihnen, wenn sie mit den typischen Beschwerden einer Angina pectoris zu uns kommen, deutlich seltener eine Durchblutungsstörung im Herzen als bei Männern“, betont der Kardiologe. „Warum das allerdings so ist, wissen wir nicht.“
Deutlicher öfter findet man bei Frauen allerdings Autoimmunerkrankungen. Bei der rheumatischen Erkrankung Lupus kommen auf jeden männlichen Patienten neun weibliche, und bei der Multiplen Sklerose ist das Verhältnis eins zu vier. Die Ursache ergibt sich aus der bereits erwähnten Immunstärke der Frauen: Ihre Immunabwehr ist generell aggressiver – und greift dadurch auch öfter körpereigenes Gewebe an. Bei der Gicht ist es hingegen umgekehrt: Sie trifft in vier von fünf Fällen einen Mann. Der Grund: Zu den Hauptauslösern dieser Gelenkerkrankung zählen Fleisch und Alkohol, und die werden von Männern in deutlich größeren Mengen verzehrt.
Der Hang zum Alkohol bedingt zwangsläufig, dass Männer etwa viermal so häufig eine Abhängigkeit von ihm entwickeln. Bei Depressionen und Ängsten ist es wiederum umgekehrt, sie treffen das weibliche Geschlecht mehr als doppelt so häufig wie den Mann. Wobei der bei einer Depression oft durch Reizbarkeit, Aggressionen oder ein Suchtverhalten mit Zigaretten und Alkohol auffällt, während Frauen eher in Niedergeschlagenheit, Essstörungen, Freudlosigkeit oder Antriebsmangel versinken. Dieser Unterschied hat viel mit traditionellen Rollenerwartungen zu tun: Dem angeblich so starken Geschlecht wird eher ein aggressiv-expansives Verhalten zugestanden als der Frau.
Bei den Therapien für ihre Krankheiten zeigen Mann und Frau ebenfalls deutliche Unterschiede. „Einige Medikamente wirken bei Frauen deutlich schlechter, außerdem treten unerwünschte Arzneimittelwirkungen bei ihnen häufiger auf“, sagt Vera Regitz-Zagrosek, die an der Berliner Charité das Institut für Geschlechterforschung in der Medizin gegründet hat. So bringen die bei Bluthochdruck und Herzinsuffizienz eingesetzten ACE-Hemmer dem Mann einen Überlebensvorteil, während Frauen dabei eher mit dessen Nebenwirkungen zu kämpfen haben, wie etwa Reizhusten und Herzrhythmusstörungen. Was nicht heißen soll, dass diese Mittel bei ihnen unwirksam sind.
Aber Regitz-Zagrosek rät Frauen ausdrücklich, dass sie ihren Arzt nach frauenspezifischen Erfahrungen mit Medikamenten sowie nach Empfehlungen für eine angepasste Dosierung befragen.
Der behandelnde Mediziner wiederum darf damit rechnen, dass seine Patientinnen ihn öfter aufsuchen und bereitwillig seinen Therapien folgen, während Männer unkooperativer sind und im Zweifelsfall einfach nicht mehr in die Praxis kommen. Andererseits greifen Frauen – über die verordneten Medikamente hinaus – etwa doppelt so oft zu Arzneimitteln, die man rezeptfrei in den Apotheken bekommt. Dadurch werden sie am Ende für den Arzt dann doch ähnlich unberechenbar wie der Mann.
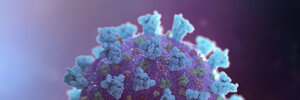










Leser*innenkommentare
janwesend
Das Thema "Warum ... häufiger Corona ..." verfehlt der Artikel leider zu 100%.
Ich biete folgende Gründe an:
1. Im Sozialverhalten mehr Körperkontakt unter Frauen.
2. Größere Impfskepsis bei Frauen (persönliche Beobachtung; Statistik liegt mir nicht vor; gibt es wohl auch nicht; für Deutschland gibt es ja nicht einmal verlässliche Gesamtzahlen)
3. Frauen gehen häufiger zum Arzt (s. Vorkommentar)
Zu Gesundheitsthemen allgemein ist der Artikel interessant. Kritisieren möchte ich aber, dass sich Gendermedizin offensichtlich nur für Frauen interessiert und nicht für beide Geschlechter. Erkennt man an Formulierungen wie "Frauen erkranken anders als Männer" statt "Frauen und Männer erkranken unterschiedlich". Derjenige der meint, das sei zu spitzfindig, darf gerne schreiben: "Männer erkranken anders als Frauen".
HP578
@janwesend Die Impfskepsis bei Frauen ist nicht nur ein Gefühl, sondern statistisch belegt. In Österreich, z.B., haben laut Impfdashboard des Gesundheitsministerum wesentlich weniger Frauen (nach Anteil) eine Impfung als Männer.
Tiefling-Hexer
@janwesend Der Artikel ist gut, aber die Überschrift ist schlecht gewählt. Da wollte man wohl über den aktuellen Bezug Interesse wecken.
deifelschen
@janwesend Das Problem hierbei ist, dass die meisten Medikamente, etc. an Männern häufiger getestet werden, es in der Medizin hauptsächlich um die männliche Symptomatik geht, wie gerade am Beispiel Herzinfarkt im Artikel. Die Kardinalssymptome sind auf den männlichen Organismus ausgelegt, erstaunlich wenige Menschen in der Praxis wissen darum, dass sich der Herzinfarkt bei Frauen häufig anders zeigt.
www.infomedizin.de...kt-frau-unerkannt/
Der männliche Organismus ist deutlich besser erforscht als der weibliche, gleichwohl möchte ich Ihnen zustimmen, dass man durchaus auch "unterschiedlich" hätte schreiben können. ;)
HP578
@deifelschen Das Problem dabei ist, dass an Frauen im gebärfähigen Alter nicht so ohne Weiteres getestet werden darf, weil sie ja (unerkannt) schwanger sein könnten, und dann potentiell sowas wie Contergan-Kinder passieren könnten. Da Frauen unter dem gebärfähigen Alter Kinder sind, an denen man auch nicht so leicht experimentieren darf, bleiben nur mehr Frauen nach der Menopause übrig, die aber hormonell und körperlich sich auch wieder kräftig von Frauen im gebärfähigen Alter unterscheiden.
Das Problem ist also nicht, dass man Frauen benachteiligen will, sondern gerade, dass man sie nicht benachteiligen will. Und die schlechte medizinische Erforschung ist dann ein Nebeneffekt davon.
Herma Huhn
@janwesend Die Formulierung Frauen erkranken anders ist insofern richtig, weil die Schulmedizin an männlichen Patienten und Probanden erforscht und entwickelt wird.
Mediocre
@Herma Huhn Ein weit verbreiteter Mythos der schlicht nicht stimmt! Um eine Zulassung für Frauen und Männer zu bekommen müssen Medikamente auch an beiden Geschlechtern erprobt werden. Die Pharmaindustrie hat auch kein Interesse daran Frauen zu vernachlässigen, denn Frauen sind tatsächlich die weitaus größere Kundengruppe in der Apotheke! Was stimmt, die Studienlage bei Schwangeren ist oft dürftig.
Existencielle
Bei "Frauen erkranken häufiger an Covid, Männer dafür schwerer" fällt mir sofort der typische Effekt ein, dass Männer meist nicht bzw. erst sehr spät zum Arzt gehen, während das bei Frauen zwar auch, aber deutlich weniger der Fall ist. Das wiederum würde bedeuten, dass die Dunkelziffer, was leichte Verläufe angeht, bei Männern höher ist, da diese sich nicht diagnostizieren lassen und sich zuhause auskurieren. Und dadurch gleichzeitig (in Kombination mit den im Artikel bereits genannten Risikofaktoren wie Rauchen, Trinken, etc.) das Risiko für einen schweren Verlauf erhöhen, indem sie erst dann professionelle Hilfe suchen, wenn sie schon fast nicht mehr alleine stehen können. Ich finde es ein Versäumnis, dass in diesem ansonsten sehr guten Artikel dieser Punkt überhaupt nicht angesprochen wird.