Die These: Wer denkt, braucht kein Triell
Wer Debatten mit Baerbock, Scholz und Laschet wie Sportwettkämpfe inszeniert, hat die Wählerinnen und Wähler aus dem Blick verloren.

Hilfreich oder sinnfrei? Mediales Großereignis Triell Foto: Sven Simon/Imago
Kein Mensch braucht ein Triell, erst recht keine drei Trielle. Ein Quadrupell wäre auch nicht besser. Schon das klassische Duell ist ein Instrument politischer Verdummung, das Gegenteil von Aufklärung. Es ist weder informativ noch unterhaltsam. Es ist, als würde man 90 Minuten drei Würstchen – eines davon ein Ersatzprodukt auf Sojabasis – beim Gegrilltwerden zuschauen. Und am Ende wird man doch nicht satt.
Wobei es nicht ganz stimmt, dass „kein Mensch“ solche Spiegelfechtereien braucht. Die Medien selbst brauchen mediatisierte Ereignisse. Das Publikum braucht sie nicht, auch nicht die Wählerin, der Wähler.
Gerne wird angeführt, das Triell spreche Menschen an, die „noch unentschieden“ oder generell „nicht so sehr an Politik interessiert“ seien. Angeblich würde damit eine Zielgruppe erreicht, die man mit politischen Inhalten sonst nicht erreiche. Tut man das? Ist das so?
Denken wir uns versuchsweise ein Publikum, das nicht ahnt, wofür Annalena Baerbock steht, wofür Laschet – und wer der Glatzkopf da auf der linken Seite eigentlich ist. Dieses Publikum folgt dann in epischer Länge einer beflissenen Abfragerei von sozial-, steuer-, wirtschafts- oder klimapolitischen Details? Und entscheidet sich dann? Auf Grundlage von was genau?

Dieser Text stammt aus der taz am wochenende. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im Wochenendabo. Und bei Facebook und Twitter.
Am 26. September 1960 war es der Schweiß. Beim ersten Fernsehduell überhaupt traf ein dynamischer und professionell geschminkter John F. Kennedy auf einen fahrigen, schlecht rasierten Richard Nixon. Laut Umfrage hätten Unentschiedene, die der Debatte nur über das Radio folgten, Nixon ihre Stimme gegeben. Wer den Mann aber schwitzen sah im Fernsehen, tendierte – natürlich – zum coolen Kennedy.
Vergleichbares wirkte – und wirkt noch – im Zusammenhang mit Barack Obama. Der Mann hatte einfach einen swag, einen fist bump und allgemein eine Coolness, die noch heute ein progressives Publikum für ihn einnimmt.
Kein Wort über seine Ausweitung des Mordprogramms mit Drohnen, seine Rettung der Wallstreet, seine Deals mit der Pharmaindustrie. Kein Wort darüber, dass ein Obama – mit vergleichbar populistischen „Ich werde in Washington aufräumen!“-Methoden – einen Donald Trump erst ermöglicht hat, kein Wort auch über sein offenbar redliches Bemühen, sich seinen Status vergolden zu lassen. Aber, hey, konnte er nicht schön „Amazing Grace“ singen?
Was zählt, auch hierzulande, ist Oberflächliches. Das Triell war darauf nur ein Vorgeschmack. Ist dieses Lächeln echt? Hat er „sch“ wieder mit „ch“ verwechselt? Weil er nervös war? Hatte er rote Ohren? Weil er sich ertappt fühlte?
Mehr Grimasse als Inhalt
Fernsehen verführt dazu, eher in Grimassen als in Parteiprogrammen zu lesen. Wir können nichts dagegen tun. Das Gesicht ist die Benutzeroberfläche des Menschen, darin etwas lesen zu wollen eine anthropologische Konstante. Sympathie sollte – siehe Obama – kein Faktor bei der Wahlentscheidung sein.
Ich persönlich halte beispielsweise Reinhard Bütikofer auf mehreren menschlichen Ebenen für ein abstoßendes Scheusal. Auf politischer Ebene aber, hört man aus Brüssel oder Straßburg, macht er sehr gute Arbeit. Also solls mir recht sein, verdammt.
Der Gipfel der menschelnden Idiotie ist der sogenannte „Biertest“ und die Frage, mit welchem der Kandidatinnen oder Kandidaten man „gerne mal ein Bier trinken“ wollen würde. Da hatte beispielsweise ein kumpeliger Jedermann wie George W. Bush gegenüber einem linkischen Nerd wie John Kerry die Nase vorn – sogar bei Demokraten.
Erfunden wurde der „Biertest“ übrigens von einer US-Brauerei. Was als Gag zum Wahlkampf gedacht war, wurde von Journalistinnen und Journalisten ganz ernsthaft aufgegriffen. Endlich mal ein Maßstab, an dem sich menschliche Anziehung ablesen lässt! Bier! Seitdem ist die Wählerschaft eingeladen, sich zu fragen, welchen Kandidaten sie besonders gerne mag – statt sich selbst die Frage vorzulegen, ob der Kandidat sie mag und im Zweifel auch etwas für sie tun würde.
Beobachten konnte man diesen Unfug auch nach dem zweiten Triell, als keine Geringere als WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni dafür zuständig war, aktuelle Umfrageergebnisse vorzulesen. Eine der ersten Fragen lautete allen Ernstes, welcher Kandidat, welche Kandidatin denn „am sympathischsten“ rübergekommen sei.
Ein Triell ist vielleicht genau das, was wir verdienen. Ganz sicher ist es das, woran die Medien verdienen
Was ungefähr dem intellektuellen Niveau einer leicht verstolperten Wahlkampfhilfe der Popsängerin Judith Holofernes entspricht, die sich nach einer Begegnung mit Baerbock auf Instagram darüber freute, jene sei voll „wach“ und ganz „da“ gewesen. Also nicht „schläfrig“ oder „irgendwie abwesend“.
Das Triell zieht wie ein Staubsauger jeden Quatsch an, der im Vorfeld von Wahlen so im Umlauf ist. Dazu gehört, ich erwähnte es, die Pest der Demoskopie. Es ist nicht nur so, dass nachweislich „Umfragen“ und die sich darauf ergebende spekulative Arithmetik eine Wählerschaft dazu verführen, „strategisch“ zu wählen – und also nicht, was sie einfach wählen würden, würden sie einfach wählen dürfen.
In den Eingeweiden von Vögeln lesen
Es ist auch so, dass die Demoskopie sich gerne irrt, mag sie auch noch so „repräsentativ“ sein. Das hat sich in der Vergangenheit häufig erwiesen, von Sachsen bis Washington, und es wird in der Gegenwart immer wieder ausgeblendet. Wenn „neue Zahlen reinkommen“, schaltet das Hirn aus. Dann übernimmt Jörg Schönenborn und interpretiert, was Stochastiker und Statistiker so errechnet haben wollen. Ebenso gut könnte er, wie die Auguren im alten Rom, in den Eingeweiden von Vögeln lesen: „Die Leber scheint mir eher verkümmert, es könnte demnach für Rot-Rot-Grün reichen …“
Womit wir endlich alle Faktoren beisammen hätten, die das Triell als das ausweisen, was es ist – Politik als sportifiziertes Ereignis.
Ein Ereignis, an dem vor allem die Medien selbst ein großes Interesse haben. Wer mit Aufregung handelt, muss die Aufregung um jeden Preis hochhalten. Auch dann, wenn es im Grunde nichts zu berichten gibt. Schon klingen Interviews mit Politikern oder Politikerinnen wie Gespräche mit Bundesligaspielern gleich nach der Partie: „Und, woran hattet jelegen?“
Beim letzten Triell war es keine Geringere als die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, die in Adlershof als Sportreporterin darüber berichtete, es hätten sich „Teams“ gebildet, die, nach Parteien getrennt, die Sendung auf Leinwänden verfolgt hätten. Dabei sei auch mal „gejohlt“ und „gejubelt“ worden. Es war von Sprechchören die Rede, bei der CDU wurde gar der Stadionklassiker „Seven Nation Army“ von den White Stripes auf Laschet umgedichtet.
Beim Triell treten trainierte Leistungssportler gegeneinander an, um erstens selbst keine Fehler zu machen und zweitens dem Gegner „Tiefschläge“ zu versetzen. Vor dem zweiten Triell war es die Bild-Zeitung, die mit der Frage titelte, ob es Armin Laschet diesmal gelinge, Olaf Scholz „k. o.“ zu schlagen. Da „schaltet“ ein Kandidat „überraschend auf Angriff“, geht ein anderer „in die Defensive“, aus der er sich nur mit Disziplin herausarbeitet. Fehlte nur noch, dass Baerbock „aus der Tiefe des Raums“ gekommen wäre. Fragen müssen „pariert“ werden, wie Bälle, bestenfalls volley, das Foul ist verpönt.
Ohne korrekte Zeitnahme freilich wäre die „Blödmaschine“ (Markus Metz und Georg Seeßlen über den Sport) nicht funktionstüchtig. Selbst dieser Aspekt spielt beim Triell eine Rolle. Als liefe eine Schachuhr mit, werden Redezeiten gestoppt und gegeneinander abgeglichen. Vermutlich, so die neuesten Erkenntnisse, sind dabei Fehler gemacht worden. Möglich, dass das Triell deshalb wiederholt werden muss. Und Baerbock hat es verstanden, mit ihrem Hinweis auf die laufende Uhr eines schweigenden Konkurrenten „Fairnesspunkte“ zu sammeln.
Mit Liveticker und Countdown
Es mag kein böser Wille sein, alles auf einen Wettkampf zu drehen, ein kommerzieller ist es allemal. An Wahlabenden lässt sich das schon länger beobachten, inzwischen ergreift es aber auch den Wahlkampf selbst – inklusive „Liveticker“ und Countdown bis zum Showdown. Die ganze Sprache, in der über Politik berichtet wird, ist von der des Sportjournalismus kaum mehr zu unterscheiden. Schade nur, dass sich nicht auch politische Winkelzüge wie Spielzüge in Zeitlupe wiederholen lassen.
Die Welt ist komplex und Politik die Kunst des Machbaren, das Bohren dicker Bretter. Der Wahlkampf in seiner televisionären Zuspitzung (ergänzt um das Geschnatter in den Kloaken der „sozialen“ Medien) ist das exakte Gegenteil. Ein Triell ist vielleicht genau das, was wir verdienen. Ganz sicher ist es aber das, woran die Medien verdienen.
Wer um seine seelische Hygiene bemüht ist und sich den Glauben an die Demokratie nicht nehmen lassen will, sollte diesem entwürdigenden Theater keinerlei Beachtung schenken.


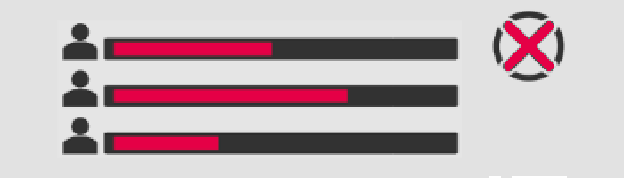



Leser*innenkommentare
Karl Kraus
Schließe mich vollumfänglich an.
TazTiz
Die Kandidaten-Duelle der Vergangenheit hatten ein gewisse Berechtigung, da es ja irgendwie Lagerwahlkämpfe waren. Die aktuellen Prognosen lassen solche Bevorzugung von zwei oder jetzt 3 Parteien eigentlich nicht rechtfertigen. Insbesondere die Grünen, derzeit ja nur 6stärkste Kraft im Bundestag, gehören trotz eigener Ambitionen da nicht hin. Seinerzeit wurde Westerwelle als Kanzlerkandidat der FDP auch nicht eingeladen, zu Recht.
Wenn überhaupt, sollten alle Parteien, die in der Prognose bzw. bei Umfragen stabil über 3% liegen, eingeladen werden. Dann kann der Wähler sich ein echtes Bild machen.
Zeuge14
@TazTiz ""sollten alle Parteien, die in der Prognose bzw. bei Umfragen stabil über 3% liegen, eingeladen werden."" Gute Idee...ich bin sicher, das gäbe ein vernunftbefreites Gemetzeln. Und kann nur hoffen, das "insbesondere" die Vertreterin der Partei mit den "eigenen Ambitionen" da klugerweise gar nicht erst hingeht. War doch nett, das Geflirte von SPD und Grünen da gestern zu sehen;-)
Günter
Wenn's mal wenigstens was sportliches gewesen wäre...das waren drei leere Plastiktüten....
Tom Farmer
Abgeordnetenzahl nur anhand der Wahlbeteiligung besetzen. Nichtwähleraanteil der Abgeordnetenplätze besetzen von der wahlberechtigten Bevölkerung per Losentscheid.
Wir brauchen entweder mutigere Politik oder mutigeres Wahlsystem. Die Langweiler da die im Triell hinken allesamt der Realität und der Bereitschaft Dinge anzupacken weiten Bevölkerungsanteilen hinterher.
HoboSapiens
@Tom Farmer Spannende Idee!
Da würden aber ei in ihr ganz schön verdutzt aus der Wäsche schauen vom politischen Establishment.
Bei der Wahlbeteiligung in diesem Land ist meine nächste Legislaturperiode im DB wahrscheinlicher als ein Lottogewinn, immerhin.
Spannend ist in dem Atemzug welche CDU Politiker wohl nicht über ein Direktmandat in den DB einziehen und sich Ihren Platz am Schweinetrog mit der Landesliste sichern... Hat ja keiner was zu verschenken von den vielen Herren und wenigen Damen...
Damit ist dann auch geklärt wie man wieder auf knapp 100 MDB kommt.
Man hat sich abgesichert...
...und sicher ist eben sicher.
Tom Farmer
@HoboSapiens Losentscheid ist eine ganz alte Idee aus dem Demokratieurland Griechenland vor weit über 2000 Jahren. War tragfähig und stabil und die Vertreter waren oft Leute aus der Praxis. Im DBT sitzen vorwiegend Juristen, Verwaltungsfachleute, Beamten. Das ist leider Teil des Problems.
Rainer B.
Drei Dinge muss man dazu nur wissen:
1. Der Wechselwähler ist ein scheues Reh.
2. Stimmen werden nicht verschenkt, sondern abgegeben
3. Vor der Wahl ist nach der Wahl.
Schnetzelschwester
@Rainer B. Zu 2.: Die Stimmen werden abgegeben, danach hat man nichts mehr zu sagen.
Rainer B.
@Schnetzelschwester Herbert Wehner (SPD) hat es einmal treffend so ausgedrückt: „Der Wähler legitimiert mit seiner Wahl die Entscheidungen, die anschließend gegen ihn getroffen werden.“
kischorsch
Ich brauch diesen Zirkus auch nicht. Ich kucke einfach auf das, was die Parteien in der letzten Wahlperiode gemacht bzw. nicht gemacht haben und entscheide mich dann, ob ich das weiter so haben möchte.
Deep South
Wenn man sich tagtäglich mit Politik beschäftigt, wenn man sorgfältig alle Wahlprogramme ließt oder ideologisch vorgewärmt sowieso irgendwo alles ganz genau weiß, dann braucht man solche Formate sicher nicht.
Für Leute, die Politiker nur von Wahlplakaten mit platten Slogans kennen oder von Ausschnitten aus vorgefertigten Bundestagsreden, für die isses bestimmt nicht falsch, die Kandidaten auch mal in Diskussionen und Fragekreuzfeuer zu erleben.
Das kann sicher keine Auseindnerstzung mit Parteiinhalten ersetzen, aber auf alle Fälle das Bild ergänzen.
Ich find auch, dass es zuviele solcher Sendungen gibt und die Runden meist nur an der Oberfläche kratzen. Aber ich finds trotzdem ein wenig von oben herab, diese "Trielle" prinzipiell als Futter für die Nichtdenkenden zu einzuordnen.
Ingo Bernable
Warum sollte man die Prognosen denn eigentlich nicht aus den Eingeweiden von Vögeln orakeln? Der ganze Wahlprozess ist doch ein derart mittelbarer, dass sich tatsächlich die Frage stellt ob dabei nicht irgendwo der demokratische Gedanke auf der Strecke bleibt und das Ganze nicht eher den charakter eines gesellschaftlichen Rituals hat mit dem die Legitimation der sich daraus ergebenden Regierung hergestellt wird.
Gewählt wird ja eigentlich der Bundestag, die Legislative also, der wahlkampf dreht sich aber nahezu ausschließlich um die Kandidat*innen für´s Kanzleramt, die Exekutive also, und selbst dabei herrscht völlige Unklarheit über Koalition und Kabinett. So kann etwa eine Stimme für die Grünen genauso gut in eine Koalition mit Schwarz-Gelb münden, wie in eine mit Rot-Rot, wobei die damit verbundene politische Marschrichtung in sehr, sehr vielen Themenfeldern eine diametral entgegengesetzte wäre.
Selbst wer die Stimme nicht nach Kanzler*innen-Präferenz vergibt, sondern nach inhaltlichen Kriterien für die Direktkandidierenden, wählt diese in eine Position in der diese Überzeugungen annähernd irrelevant sind weil sie als Parteimitglieder dem Fraktionszwang unterliegen.
Schließlich wäre auch noch zu fragen wie gut ein auf vier Jahre gewähltes Parlament incl. Regierung zum demokratischen Gedanken der Repräsentation passen wenn gleichzitig die Wahlpräferenzen des Demos derart volatil sind, dass es sehr gut möglich ist, dass zum Zeitpunkt zu dem der*die neue Kanzler*in den Amtseid ablegt diese*r bereits schon keine Mehrheit mehr in der Wahlbevölkerung hat. Wenn aber die Regierungsmehrheit aus einer Momentaufnahme einer Stimmung resultiert die sehr viel kürzer Bestand hat als die Legislaturperiode dauert lässt sich auch hier kaum mit einer wirklichen Repräsentation argumentieren.
Schnetzelschwester
@Ingo Bernable "So kann etwa eine Stimme für die Grünen genauso gut in eine Koalition mit Schwarz-Gelb münden, wie in eine mit Rot-Rot, wobei die damit verbundene politische Marschrichtung in sehr, sehr vielen Themenfeldern eine diametral entgegengesetzte wäre."
Genau das macht mir am meisten Bauchschmerzen.
Ich persönlich empfinde Wahlen nach den zwei GroKos nur noch als Farce, die dem Volk vorgaukeln soll, es hätte die Zusammensetzung der Regierung irgendwie im Griff.
Ich bin diese aufgeblasenen Selbstdarsteller sooo müde. Und ja, zur Aufrechterhaltung meiner psychischen Gesundhet meide ich derartige politische Wrestling-Shows.
Jossito
Die Antithese
Wer denkt, kann auch das Triell zur Ergänzung seiner Erkenntnisse und Erfahrungen nutzen. Besonders bezüglich verschiedenster Aspekte der Persönlichkeit der Figuren. Sie stehen, und das war offensichtlich, in solcher Situation unter starkem Anforderungsdruck. Ihr Verhalten, ihre Mimik, Gestik, Körperhaltung, Stimmlage (Baerbocks Stimmhöhe und Sprechrhythmus haben sich mE seit der Steuer- und Plagiatsgeschichte signifikant verändert) und ihre Reaktionen auf berechtigte und unberechtigte Argumente, auf Angriffe, Unfairness und logische/rhetorische Herausforderungen, die Verwendung von Textbausteinen, Phrasen, Floskeln, emotionale Signale, Gefühlsausdruck, Umgang mit dem ‚Zeitgeist‘, Humor unter Stressbedingungen, ... All das interessiert mich. Auch, weil ein Interview, besonders zu zweit, selten die Gruppendynamik erzeugt, die einen Blick hinter die Maske ermöglicht. Trielle haben einen bedeutend höheren Energielevel, nicht hinsichtlich des politischen Diskurses, aber hinsichtlich der persönlichen Komponenten, die in einer Gruppe jeder gegen jeden auf den Prüfstand kommen. Da bricht häufig so manches Coaching-Konzept zusammen. Oder wird grotesk erkennbar.
Das Wahlprogramm überlebt oft weder den Wahlsieg noch die Konfrontation mit der Realität. Bleibt bestenfalls guter Wille, schlimmstenfalls Geschenk an das Klientel. Die Persönlichkeit hingegen ist weitestgehend konsistent. Dass Politik, besonders das politische Verhalten von Führungspolitikern, auch einen enormen anthropologischen Aspekt hat, halte ich für ziemlich plausibel. Mich interessiert das Persönliche und das Politische in einer Figur als die zwei Seiten einer Medaille, die es gilt zu erkennen. Das mag bei Robotern oder brainwashed people in gleichgeschalteten Systemen anders sein.
Im Übrigen habe ich den Eindruck in einem Land zu leben, wo diejenigen, die primär mit dem Kopf fühlen, von denen lernen lernen können, die überwiegend mit dem Bauch denken und umgekehrt.
06792 (Profil gelöscht)
Gast
Wahl O Mat verpflichtend machen. Was am Ende oben steht muss gewählt werden. Alle Kandidaten werden anonymisiert und machen nur noch ihr Abstimmungsverhalten öffentlich. Fertig.
Diese Politik Show in der jeder Kandidat einfach behaupten kann er würde sich für die kleinen Leute, die Wirtschaft und für das Klima sowieso einsetzen ist mittlerweile komplett albern.
Danke für den Artikel.
chop suey
@06792 (Profil gelöscht) Wahl O Mat... Das erinnert mich an einen Artikel über die damaligen Versprechen von Frau Merkel. Schienennetz, Digitalisierung, etc. Wenn ich jetzt wieder Schlagwörter wie Entfesseln höre, dann gerate ich ins Grübeln. Haben die Unternehmen nicht aus der Pandemie extrem profitiert?! Es gibt auch noch einen Artikel vom Spiegel zur FDP und wie sie Unternehmen vergrault. usw.
Letztendlich würde ich mich nicht nur auf das Wahlprogramm festlegen wollen. Hilfreich ist natürlich der Blick auf die vergangenen Legislaturperioden.
Auch muss man leider sagen, dass viele Ämter durch Abgeordnete besetzt werden, die keinerlei Kompetenzen dafür besitzen, was dann dazu führt, dass unendlich viele Steuergelder verschwendet werden. Auch mangelt es heutzutage an Selbstkritik. ein kleines Beispiel. AKK will auch in der kommenden Regierung einen Ministerposten bekleiden, weil sie der Meinung ist, dass sie den bisherigen Job sehr ordentlich gemeistert hat.
Ingo Bernable
@06792 (Profil gelöscht) "Wahl O Mat verpflichtend machen."
Das halte ich für überhaupt keine gute Idee weil es auf die maximale Verkürzung hochgradig komplexter Themen auf binäre Stimme zu/nicht zu Entscheidungen hinauslaufen würde und manche Themen von vornherein durchs Raster fallen.
www.zeit.de/politi...cher-thorsten-faas
Fabian Wetzel
Sehr gut.
Markus Wendt
Danke, einfach danke!
75787 (Profil gelöscht)
Gast
Danke Herr Frank. Sie fassen all das sehr treffend in Worte zusammen, was einem ansonsten beim Betrachten dieses Formats an negativen Gefühlen überkommt. Mittlerweile scheint die medial inszinierte Verflachtung auf allen Kanälen widerspruchsfrei stattzufinden.
hanuman
DAS RITUAL...
entscheidet, nicht die inhalte: die medien fragen nicht danach, welche inhalte der kandidat verbreitet, sondern wieviele minuten lang er applaus erhalten hat, ob sein anzug klemmt, wie oft er sich verspricht... politik und medien stehen sich in nichts nach - deshalb dank für die enttarnung.
Nifty_Monkey
Danke, Arno Frank. Meine Bitte: Den Artikel in "Würstchen aus der tiefe des Raums" umtaufen.
Lowandorder
“The Games & Shows must go on!“
Neil Postman “Wir amüsieren uns zu Tode!“
& immer vorne =>
Marshall McLuhan “Die elektrische Braut“ - zB
Lowandorder
@Lowandorder & Däh - mein Sidekick => - 🥳 -
“ Moin
"Arno kanns doch " - Erfreulich, dass er's macht.“
anschließe mich - 🧐 -
Zeuge14
Ah, wie wunderbar auf den Punkt - auch sprachlich - gebracht. Dem bleibt nix hinzuzufügen. Und trotzdem werde ich mir das heute Abend nochmal antun. Evtl. gibt es ja wiedr so eine nette Gelegenheit zu offensichtlich Humorigem wie die weiterlaufende Zeitnahme, bei der Annalena dann aus der Tiefe des Raumes kommen kann. Medienverarsche - ich freu mich drauf. Bin auf die morgigen Kommentare dazu hier gespannt.
tomás zerolo
"Wer denkt, braucht kein Triell"
Ne, klar. Aber was ist mit all denen, die nicht denken?
Yossarian
@tomás zerolo Das sind Stammwähler.
97287 (Profil gelöscht)
Gast
@tomás zerolo Die gehen dann zur Wahl, nachdem sie sich die Kandidaten im Fernsehen angeguckt haben und deren Argumente gehört haben. Die die kein Triell gesehen haben, also die Denker, lesen die Taz und wählen die Partei oder den Verein der gerade in ihrem Kietz angesagt ist. Mein Programm ist meine Wahl.
CarlaPhilippa
@tomás zerolo Bei denen hilft auch ein Triell nicht.
rero
Danke. :-)
Deshalb habe ich diese Sendung nicht gesehen und schaue mir grundsätzlich Sendungen dieser Art nicht an. Ich finde sie schlimm.
Schnetzelschwester
@rero Die sind auch nicht gut für den Blutdruck.
32533 (Profil gelöscht)
Gast
Eine gute These - wie ich finde.
Garniert mit sehr anschaulichem Material. Ganz ohne Bilder, aber mit möglichen Rückgriffen auf eigene Erinnerungen und Fantasien.
Um mit dem Beispiel JFK und Nixon zu beginnen: damals habe ich Kennedy angehimmelt (auch ohne ihn gesehen zu haben) und als Statthalter Gottes auf Erden fantasiert. Einer jener Menschen, der zu Legendenbildungen taugte. Nach und nach bröckelte doch einiges ab.
Nixon war für mich, vor allem in den Jahren seiner Regentschaft, das personifizierte Böse. Damals kannte ich noch nicht die Dualität aus Wesen und Erscheinung, Form und Inhalt. Damals gab es meist nur schwarz oder weiß, Gut oder Böse für mich.
In der JETZT-Zeit schaue ich keine Talk-Shows. Wenn ich mal reinzappe, dann schalte ich auf stumm, erfreue oder ärgere mich an/ über das Optische ... und ziehe bald mit meiner Karawane weiter.
Dem Fazit des Autors, gegen das er im Übrigen selbst verstößt, stimme ich nicht zu. Beachtung und Aufmerksamkeit sind unbedingt nötig. Aber dazu muss sich keiner diese Sendungen anschauen - und anschließend entrüsten. (Ich befürchte, das ist tendenziell eine Alters- und Erfahrungsfrage. Deswegen bin ich mittlerweile Jüngeren gegenüber etwas nachsichtiger.)
Wer um seine seelische Hygiene - die sich bekanntermaßen auch körperlich manifestiert - bemüht ist, sollte erst für die Bildung der nötigen Widerstandskräfte (Resilienz) sorgen.
Bernhard Mayer
Wer denkt, braucht kein Triell
Könnte es sein daß ich mir deswegen solche Sendungen erspare?
Rudi Hamm
"Wer denkt, braucht kein Triell"
Nein, brauchen wir wirklich nicht!
Ich stelle in Frage, ob Wahlkampf überhaupt Sinn macht. Ich habe meine Wahlentscheidung schon lang vor dem Wahlkampf getroffen, dazu hatte ich 4 Jahre Zeit das wirkliche Tun der Parteien zu beobachten. Wieso sollte ich all den Wahlversprechen überhaupt glauben schenken, man wird doch eh nur belogen.
Wenn CDU und SPD jetzt plötzlich von Dingen reden, die sie 16 Jahre verschlafen haben, dann glaube ich denen kein Wort mehr, siehe schnelles Internet, Digitalisierung, Schul- und Gesundheitswesen und vieles mehr.
Es wundert mich, dass überhaupt noch so viele Wähler überhaupt der CDU und SPD ein Wort glauben.
Rudolf Fissner
Falsch. Das Ding ist wer nur über das Triell berichtet hat den Wähler aus den Blick verloren. Wer dann auch noch journalistisch auf eine Parte ausgerichtet ist hat den Faden völlig verloren.