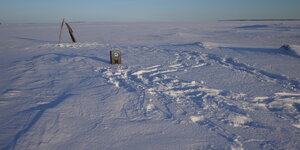Virtual-Reality-Projekt „Umwelten“: Polymorphe Wesen tönen mich an
Das Konzerthaus Berlin verleiht VR-Brillen für das Virtual-Reality-Projekt „Umwelten“. Visuell ist das Erlebnis dabei eindrucksvoller als die Klänge.

Die Tänzerin Takako Suzuki bei der Premiere Foto: Markus Werner/Konzerthaus Berlin
Die VR-Brille kommt per Kurier ins Haus; wie symptomatisch für eine Zeit, da mensch (noch) nicht in die Konzertsäle darf. Das Konzerthaus Berlin hat die Auszeit genutzt, um ein außergewöhnliches Projekt zu realisieren: Eine virtuelle Soundlandschaft für die Oculus Quest ist entstanden, für die der Komponist Mark Barden Hunderte von Klängen entwickelt und der Musiker und 3-D-Designer Julián Bonequi eine interaktive virtuelle Umgebung kreiert hat.
Nun gehört eine Oculus Quest nicht zu den Dingen, die durchschnittliche KonzerthausbesucherInnen zu Hause haben, auch für Digital Natives ist eine VR-Brille noch ein teures Extra. Meine eigene Erfahrung ist gleich null; umso gespannter bin ich beim Auspacken.
Interessierte können sich auf der Website des Konzerthauses um die Teilnahme bewerben.
Das Online-Tutorial sehe ich zweimal an, bewältige dann erfreulich mühelos die Einrichtung meines virtuellen Spielfelds und bin angenehm überrascht, mich plötzlich in einem wohnlichen Panorama-Saal mit fantastischen Ausblicken auf eine alpenähnliche Berglandschaft wiederzufinden. Doch diese Idylle ist nur das Eingangsfenster in einen weitaus befremdlicheren Kosmos.
Ich wähle die Lernwelt, in der ich üben soll, mich zu bewegen, und werde unversehens in outer space katapultiert. Obwohl ich weiß, dass ich mit beiden Beinen fest auf dem Wohnzimmerteppich stehe, ist meine spontane Reaktion Angst, gegen die ich mich nicht wehren kann, weil sie irgendwo aus dem Rückenmark kommt. Denn die dünne Plattform, auf der ich mich befinde, schwebt in der Luft und ist umgeben von gigantischen polymorphen Wesenheiten, die mich turmhoch umschweben und zu pulsieren scheinen.
Mit Laserstrahlen zielen
Nach dem ersten Schock gelingt es mir, meinen Laserstrahl zu bedienen. Ich kann mich mit seiner Hilfe im Raum bewegen und soll, sagt der Infotext, damit auf die riesenhaften Wesen zielen, die mich umgeben. Das scheint mir ein sehr unfreundlicher Akt zu sein, aber ich tue es.
Die lila Riesenamöbe vor mir färbt sich blau, verstärkt ihr bedrohlich multiples Dröhnen (viel später werde ich verstehen, dass es sich dabei um Klänge handelt, die liebevoll und sehr differenziert vom Konzerthausorchester eingespielt worden sind) und scheint sich auf mich zu zu bewegen. Trotzig wiederhole ich die Attacke, fühle mich aber unbehaglich und inzwischen auch etwas unsicher auf den Beinen.
Glücklicherweise gibt es einen „stationären Modus“, in den ich wechsle, nachdem ich mich erinnert habe, welcher Button zurück ins Menü führt. Erleichtert lasse ich mich auf einem Stuhl nieder, bevor ich die Reise in die eigentliche „Umwelten“-Landschaft antrete.
Hier gefällt es mir besser, denn die Wesen, die sie bewohnen, sind nicht ganz so überwältigend riesig, und es gibt mehr Boden unter den Füßen. Ich bin auf einer kleinen Insel gelandet, wo ich mich von einem Ring zarter, in der Luft hängender Objekte umgeben finde, die Rankpflanzen sein könnten, vielleicht auch seltsames Meeresgetier.
Jedes Wesen ist von einer eigenen Klangwolke umgeben
Per Laserstrahl kann ich mich auf andere Inseln beamen. Jede ist von einem anderen polymorphen Wesen bewohnt, jede Wesenheit ist umgeben von einer eigenen Klangwolke. Manche sind physisch geradezu unangenehm, enthalten Anteile von kreischenden, quietschenden, latent aggressiven Sounds, andere verbreiten eine eher kontemplative Stimmung.
Wenn mir etwas zu viel wird, entspanne ich auf einer Insel, auf der eine Reihe von niedrigen, friedlich vor sich hin tönenden Sukkulenten (oder so) zu wachsen scheint. Insgesamt finde ich die interaktiven Features überschaubar: Es gibt ein paar kleine Objekte – einmal Knospen, das andere Mal schwebende Kugeln –, die bewegt werden können.
Mir gelingt es aber nicht, die Objekte in eine neue Anordnung zu bringen, und das An- und Abschwellen der dazugehörigen Klangwelt sowie die Stereo-Effekte, die durch die Bewegung entstehen, sind gut gemacht, wirken aber nicht wirklich spektakulär. (Und dabei erfordert so etwas wahrscheinlich eine immense Rechenleistung.)
Angelehnt an Zeichnungen von Ernst Haeckel
Erst später, nach der Experience, finde ich auf der Website des Konzerthauses ein Making of, in dem ein Buch unauffällig in die Kamera gehalten wird: Es enthält Zeichnungen des 1919 verstorbenen Zoologen Ernst Haeckel, der unter anderem mit dem Buch „Kunstformen der Natur“ berühmt wurde. Jetzt verstehe ich, woher die Meerestier-Anmutung der tönenden Wesenheiten kam.
Außerdem ist im Video schön zu sehen, wie Komponist und Orchester mit allerlei originellem Gerät hantieren und an Klängen frickeln: Alles, was in „Umwelten“ erklingt, ist analog von Hand und Mund gemacht.
Es ist ein geradezu irrwitziger Aufwand für ein Klangerlebnis, das sich während meiner persönlichen Experience aber in der Wahrnehmungshierarchie der Sinne klar hatte unterordnen müssen. Der visuelle Überwältigungseffekt war nun einmal viel stärker.