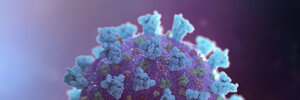Sechs Monate Alltag mit Corona: Unter der letzten Überlebenden
Was, wenn man einen völlig neurotischen Blick auf die Krise wählte? Die taz-KulturRedaktion über das Pandemieleben. Teil 4.

Draußen Stille, innen Chaos. Oder innen Stille, draußen Chaos? Foto: Ute Grabowsky/photothek/imago-images
Die Nekrose war locker, leicht feucht mit gelben Ablagerungen, die Haut drumherum violett schimmernd, dabei prall und aufgedunsen, erfroren wirkte sie. Es war Frühling. Einige Furchen und Läsionen weiter blitzte ein gräulicher Schorf unter einem Hemdfetzen hervor. Die Wundumgebung war ein Körper, der sich nur langsam fortbewegte. In jedem seiner Schritte lag die Drohung zu stürzen. Und nie wieder aufzustehen.
Ich dachte an den süßlichen Geruch von Verwesung in dem Haus in Wien, in dem ich gelebt hatte. Eine Frau war in ihrer Wohnung gestorben. Als man sie entdeckte, hatte bereits jede:r im Haus für sich eine Lösung aus Räucherstäbchen, Duftkerzen oder Raumsprays gefunden. Ich hatte zu dieser Zeit Diptyque Paris entdeckt.
Die Hose bedeckte Penis und Skrotum nur noch notdürftig. Er ging auf die Knie. Zwischen Altpapier- und Biotonne rann kurze Zeit später sein Urin übers Pflaster. Er kippte zur Seite, der Ellbogen knickte weg, er sank zu Boden. Wie jung er doch noch war! Und wie es wohl gewesen ist, als er drei Jahre alt war? Oder 15.
Ein anderer brüllte. Ich verstand nur „Messer“. Vielleicht fühlte der gar nichts, obwohl er brüllte. Ein paar Meter weiter weinte eine Frau. Ihr graues Haar war verfilzt, und aus ihrer Nase tropfte dünnflüssiges Sekret. War es möglich, dass auch sie nichts fühlte, obwohl sie weinte?
Im Kokon
Unsere Wohung war unser Kokon geworden, und unsere Welt schrumpfte von Tag zu Tag mehr, während die Rituale immer mehr wurden. Jede Zeitung und jede Nachrichtensendung erwarteten wir in Aufregung, manchmal stündlich. Die Anrufe wurden immer weniger.
Ein alter Bekannter suchte uns zu Hause auf. Bei unserer letzten zufälligen Begegnung war er Gelegenheitstrinker. Nun sah er nach Nekrose aus. Er hatte sich eingepinkelt. Vielleicht zum ersten Mal, denn in der einen Hand trug er noch die Designertasche aus aufgeräumteren Zeiten, in der anderen eine Flasche Bier. Ich gab ihm all das Geld, was ich in meinem Portemonnaie und in der Kommode finden konnte. Hauptsache, er würde ganz schnell wieder verschwinden.
Manchmal, wenn ich aus dem Fenster schaute, stellte ich mir vor, fast alle Menschen in dieser Stadt wären schon tot. Das ging recht gut. Denn im Park vor dem Haus gab es nur noch einen leeren Spielplatz und Autos. Wenig später wären sie unter all den Linden vom Blattlauskot verklebt.
Zwischen Klettergerüsten und Autos tauchten immer wieder kleine Menschengruppen auf. Marodeure, Verlorene, Körper mit Nekrosen. Man konnte sich das so leicht vorstellen, auch dass sie die letzten Überlebenden wären – auf der Suche nach Essbarem. Bald würden sie sich gegenseitig erschlagen.
Irgendwas zwang mich, das wieder und wieder zu denken, obwohl ich es nicht wollte. Waren sie schon immer da und so viele gewesen oder konnte man sie jetzt nur besser sehen? Oder hatte ich sie bloß anders angeschaut? Aus zu Rettenden waren Verlorene geworden. Wie war das möglich?