Berichterstattung über Covid-19: Nicht alles braucht einen Coronadreh
Eine Studie sagt, die Berichterstattung über Covid-19 sei zu negativ gewesen. Nur wie sollen Journalist*innen über eine Pandemie schreiben?

Szenen wie aus einem Seuchenfilm an der deutsch-polnischen Grenze im März Foto: Florian Gaertner/photothek/imago
Ich würde Ihnen gerne sagen: Alles wird gut. Pannen passieren, der Söder kriegt das hin und Bob Dylan hat doch neulich ein neues Album veröffentlicht. Aber ich bin kritisch, grantlig und keine verdammte Happiness-Managerin. Sondern Journalistin.
Wir Journalisten schreiben jeden Tag, was schiefläuft, wo es wie viele Tote gibt, wer wen wie in die Pfanne haut und auf welche Abgründe unsere Welt gerade zuläuft. Wir sind begabte Dramatiker, verliebt in die Tragödie. Und das ist manchmal ein Problem. Denn gerade jetzt in der Coronakrise macht sich ein altes Dilemma des Journalismus bemerkbar: Schreiben Journalisten zu negativ, stumpfen Leser ab oder drehen sich weg. Schreiben Journalisten zu positiv, machen sie sich verdächtig, parteiisch oder unkritisch zu sein.
Kürzlich haben zwei Kulturwissenschaftler von der Universität Passau in einer Studie die Spezialausgaben von ARD und ZDF seit Beginn der Pandemie analysiert. Und kamen zu dem Schluss, dass zu negativ und überhaupt zu viel über Corona berichtet worden sei. Und außerdem zu dramatisierend.
Die Studie wurde – trotz ihrer Erwartbarkeit – viel diskutiert und kritisiert. Die Senderchefs von ARD und ZDF verteidigten sich. So wehrte sich der ARD-Chefredakteur Rainald Becker im Deutschlandfunk: „Journalismus ist nicht dazu da, Lösungen zu finden oder Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Das müssen andere tun. Das muss die Politik tun, das muss die Wirtschaft tun, das müssen die Menschen tun. Aufgabe von Journalismus ist es, eine Wirklichkeit, ein Geschehen zu beschreiben.“
Christian Drosten, der Held
Aber diese Wirklichkeit wird nie einfach nur beschrieben, sie wird immer auch narrativ gestaltet. Die Autoren der Studie, Dennis Gräf und Martin Hennig, hatten die Berichterstattung über Corona unter anderem aus philologischer Perspektive untersucht – also in Bezug auf das Wie der Inszenierung. Da war die Rede von „Hollywood-Ästhetiken“, „dystopischer Endzeitstimmung“ und „Vorabend-Soap“.
Es lohnt ein Blick auf die mediale Inszenierung der Pandemie: Waren die Maßnahmen zum Pandemieschutz 2020 eine Tragödie? Die Figuren und deren Besetzung würde zumindest passen: Christian Drosten als Held, verantwortungsvoll, angefeindet, aber sich höheren Zielen opfernd („there is no glory in prevention“), zeitweise die Antihelden Hendrik Streeck und Armin Laschet mit ihrer missglückten PR zur Heinsberg-Studie.
Und da ist der Chor der Leugner. Die Frage ist nicht immer bloß, inwiefern Realität korrekt abgebildet wird – sondern auch, ob Berichterstattung in Muster verfällt, die dann zu Klischees werden und Desinteresse bewirken. Denn wie viel Tragödie verträgt der Mensch? Bevor das Publikum aufhört, Nachrichten über Corona zu lesen, nur weil es um Corona geht, kann man zumindest einen Kurswechsel in Erwägung ziehen.
Wie ließe sich, mit Blick auf eine „zweite Welle“, die Geschichte der Pandemie narrativ anders gestalten? Nein, ich meine nicht das K-Wort: „konstruktiver Journalismus“. Wie gesagt: Ich bin keine verdammte Happiness-Managerin. Aber das Storytelling könnte besser sein.
Nicht jeder Text braucht einen „Coronadreh“
Erstens: Nicht jeder Artikel braucht einen „Coronadreh“. Porträts und Reportagen zu anderen Themen funktionieren gut ohne den Hinweis auf die schreckliche Zeit, in der wir aktuell leben. Ja, was auf dieser Welt passiert, findet unter besonderen Bedingungen statt: Fußballspiele, Konzerte, Regierungstreffen, Wahlen. Trotzdem braucht es keine Coronakausalität – nicht alles hängt mit der Pandemie zusammen.
Mit dem pflichtbewussten Einflechten der Maskenpflicht, dem Abstand, den Digitalkonferenzen, den Rückverweisen auf den Lockdown gehört das C-Wort schleichend zum Leben wie die Bauarbeiten vor dem Fenster – es nervt, es ist laut, man ignoriert es.
Zweitens, die Dramaturgie: Sind Coronanews immer Titelgeschichten? Wie viele Masken müssen auf eine Seite? Welcher Aspekt muss in die Überschrift? Dass Norwegen Deutschland als Risikogebiet einstuft, sagt natürlich etwas über die Dramatik der Fallzahlen, es sagt aber auch, dass Norwegen eventuell eine sehr vorsichtige Politik verfolgt und schlicht weniger Fallzahlen hat.
Braucht es also hier wirklich eine Eilmeldung? Wenn im Fernsehen auf einen Beitrag über gestresste Eltern wegen der geschlossenen Schulen direkt danach ein Beitrag über die gesundheitlichen Gefahren bei der Wiedereröffnung von Schulen geschnitten wird, ist das Tragödienmuster perfekt erfüllt. Problem wird an Problem geschnitten. Und genau das suggeriert die Ausweglosigkeit, ein Kernelement der Tragödie – egal, was die Figuren machen und wie sie handeln, sie handeln falsch.
Und schließlich: Neben Tragik ist auch die Komik ein Mittel zur Emotionalisierung, und auch in dieser Pandemie gibt es komische Momente, die sich zu erzählen lohnen. Denn – das wusste schon Shakespeare – der Comic Relief, das erleichternde Lachen, gehört zu einer guten Tragödie dazu. Deswegen muss nichts verwässert, gesüßt oder verschwiegen werden. Auch in Krisen dürfen die erzählerischen Instrumente variieren.
Apropos Instrumente. Bob Dylan hat ein neues Album. Es heißt „Rough and Rowdy Days“.
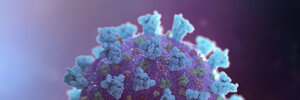








Leser*innenkommentare
Thomas Fluhr
Journalismus könnte Fragen stellen, nicht nur Meinungen ausposaunen.
Momentan hat die 4. Macht im Staat versagt.
Bernd Schlüter
Frau Knobloch zweifelt offensichtlich die Arbeit von Streeck, Laschet und dem Märchenerzähler der Bildzeitung an.
Wenn die Bildzeitung wahrheitsgemäß berichtet hat, was ist daran herumzumäkeln? Sind Sie Bayerin? Aus Bayern kam die Anklage gegen Streeck.
CeeEmm
"Aufgabe von Journalismus ist es, eine Wirklichkeit, ein Geschehen zu beschreiben."
Sinnvoll ist es, zumindest der Versuch davon, das Geschehen von verschiedenen Seiten, aus diversen Perspektiven und Blickwinkeln, zu betrachten und zu beschreiben.
Dazu gehören Hintergrundwissen und Objektivität, damit auch geäusserte öffentliche Kritik.
Nicht nur die "ewigen Spezialisten" Drosten, Streek, Lauterbach und Consorten, RKI und Co sollten zu Wort kommen, auch andere "Kenner der Szene" wie beispielsweise kritischere Stimmen, zB. A. Spelsberg.
Gerade das Fehlen anderer, widersprüchlicher Aussagen Dritter zum gängigen Temor macht das Thema C macht das Thema verdächtig einseitig.
Daran zerbrechen Freundschaften (siehe Kollegin Tania), und bereiten VT Vorschub.
Als Journalist hat man durchaus (viele) Möglichkeiten einen guten Artikel zu schreiben. Mit gut recherchierten diversen Fakten.
Oder viele, dafür schnelle und nur oberflächlich recherchierte mit bereits vorgegebener Meinung und ohne echten Hintergrundfakten (Beispiel Fallzahlen)
Martin Schlüter
BTW: Dylans Album heißt "Rough and Roudy Ways". Ist das der "Comic Relief" dieses Artikels?
4813 (Profil gelöscht)
Gast
Gut recherchieren und dann einen Artikel mit Tiefgang schreiben und nicht drei zum gleichen Thema hinrotzen, so wie es die online Seite der taz gerne macht. Kurzmeldungen sind okay, aber bitte ohne Vermutungen.
Was gar nicht geht ist Corona mit Klima oder anderen Dingen vermischen.
Aufklären statt ideologisieren.
Dieter HEINRICH
Schade drum - die Chance war, weder das C-Thema zu meiden, noch es überzudramatisieren.
Also die Beispiele eines kreativen, konstruktiven, sachgerechten - und mutigen Umganges mit der Pandemie im Alltag zu beschreiben. Das wäre außerordentlich hilfreich dafür, die Entscheider im ÖffGesDienst davon zu überzeugen, dass GEMEINSAM mit den Betroffenen entwickelte Schutzkonzepte auf Dauer tragfähiger sind als einseitige, punktuell angeordnete Quarantänemaßnahmen. Das wünsche ich besonders allen Eltern und Kindern.
Michaela von Caprivi
In aller erster Linie ist die Berichterstattung nur einseitig. Keine Meinungen anderer Virologen schaffen es in die Berichterstattung. Nur in eine Ecke gedrängt. SCHADE
Das macht viel mehr nachdenklich.
sachmah
Journalismus ist halt nur so gut wie die wissenschaftliche Ausbildung der Journalisten. Ich bin Wissenschaftler, kann englisch, kann selber lesen, kenne die Grundlagen und lerne immer dazu wenn ich zu Corona Studien lese. Die Rahmenbedingungen sind hier immer schwer abzuschätzen, so dass die Dramen wie Realität in Italien Spanien und Frankreich und NYC im Frühjahr ebenso realistisch sind wie die Bilder, die Streeck zeichnet. Das sind unterschiedliche Parameter die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen (müssen), die hier einen Einfluss haben. Das Bild ist ohne die Parameter wirklich zu kennen schnell widersprüchlich. Tja, und irgendwie muss man die Allgemeinheit auf Basis dessen vereinfacht informieren. Das ist schwierig. Auch für Experten (bin ich auch nicht). Kernmessage, versucht die Umgebungsparameter so zu halten dass wir ein Heinsberg, aber kein New York bekommen. So. Und das Wie, mit einem möglichst normalen Alltag kombiniert, ist die große Herausforderung.
Ach aber noch eins: das letzte was hier nützt ist die Meinung von Philologen. Sorry. Das ist Naturwissenschaft.
Dieter HEINRICH
@sachmah In der Selbstbeschreibung stimmen wir überein - aber Pandemie=NW? Nur NW?
CoVid Sars-2 als Virus ist NW, inkl. seiner Ausbreitungsweisen - aber wie homoINsapiens damit umgeht, das hat mit NW nur am Überschneidungspunkt "Passive u.aktive Infektion der Einzelperson" zu tun. Da es aber um Viele, SEHR Viele geht, haben wir - ab der dritten Person - das weite Gebiet der anthropolog. Wissenschaften betreten: alles, was das Verhalten von homoINsapiens betrifft....inkl. Philologie.
Also bitte korrigieren.
Ajuga
@Dieter HEINRICH Klar, man kann der Sprachforschung Zeit und Pagerank geben in einer Situation, wo sich ein unzureichend aber täglich besser erforschtes Pathogen weiterhin unzureichend kontrolliert ausbreitet.
Der Tag hat 1440 Minuten bzw rund 0,17 SARS-CoV-2-Übertragungszyklen, und ein Byte hat 8 Bits, und alle Philologie der man in einer zeitlimitierten Situation Platz einräumt, wird zwangsläufig zu Lasten von anderen Wissenschaften gehen.
Viren lesen keine Bücher. Viren spulen ihr genetisches Programm ab, und diese genetischen Programme sind der Philologie ein Buch mit sieben mal sieben Siegeln.
"Aber schön, dass wir drüber geredet haben."
Dieter HEINRICH
@Ajuga Sie schreiben philologische Worte, ich lese sie - und verstehe. Sie lesen philologische Worte über Virenprogramme - und ohne Sprachlogik verstehen Sie nichts davon. Was haben Sie gegen Sprache?!
Abgesehen davon - sobald die Virenprogramme hinreichend beschrieben sind, können wir uns darauf einstellen und entsprechend reagieren - wenn wir w o l l en! Und um heraus zu finden, was uns daran hindert, dazu braucht es k e i n e Naturwissenschaften - es braucht Sozialwissenschaften. Sprachwiss. ist ein kleiner Teil davon, ein unverzichtbarer.....
Heiner Petersen
Danke, der Artikel regt zum Nachdenken an. Nehmen wir alle ein bisschen die Dramatik raus, denn wir müssen noch ne Zeit damit leben....
sachmah
@Heiner Petersen Tipp: wenn es interessiert lesen was es in normalen Zeitungen und seriösen Medien bis NYT gibt. Das Thema ist so divers behandelt. So viele verschiedene Meinungen. Ich finde die Analyse daher ziemlich ungenau bis polemisch, da hat sich wohl jemand in eine Filterblase aufgebaut, sich in die reingesetzt und fängt jetzt das analysieren der selbstgebastelten Wände an. Self-fulfilling prophecy.
Breitmaulfrosch
Wie schreibt man über eine Pandemie? am besten nicht so wie die Süddeutsche Zeitung in dem Artike "In der Todeszone", in dem aus Norditalien berichtet wurde Der Autor parallelisierte dabei die Pest, an der im 17. Jahrhundert 2/3 der Einwohner von Noscia (?) gestroben waren mit Corona, woran 90 von 12.000 Einwohnern gestorben sind.
Es handelte sich tatsächlich um die Stadt mit der höchsten Todesrate in Italien, in der es drei Seniorenheime gibt. Da würde ich mir bei einem Artikel mit dem Titel "In der Todeszone" doch etwas anderes vorstellen. Da ging es wirklich nur darum, Corona-Panik zu schüren.