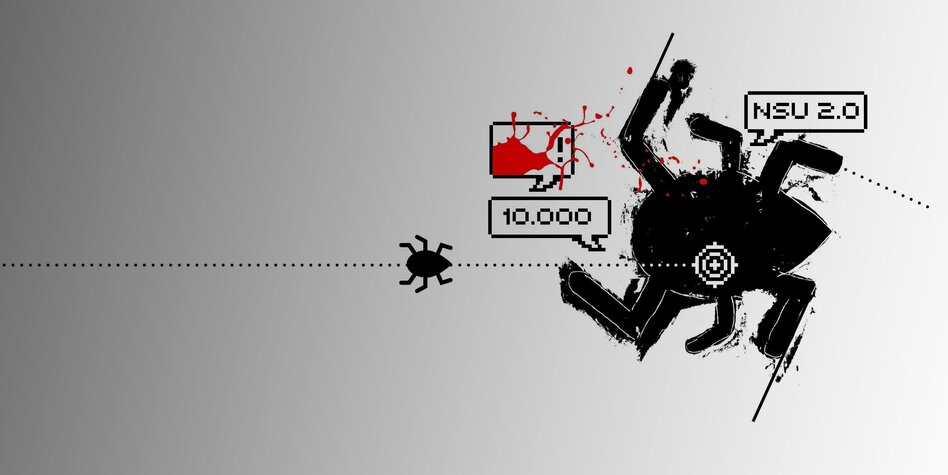
Foto: Illustration: Oliver Sperl
taz-Recherche zu Drohmails:Wer steckt hinter „NSU 2.0“?
Seit Jahren bekommen Menschen, die sich gegen rechts stellen, Morddrohungen vom „NSU 2.0“. Wer verschickt sie? Die Spur führt vor die Haustür eines Polizisten.
5.9.2020, 18:34 Uhr
Eigentlich geht es um versteckte Botschaften in Mails, die jemand nachts verschickt, der gerne „der Führer“ wäre und Menschen damit droht, sie „umzulegen“. Um einen verdächtigen Polizisten, der mit Kolleg*innen rechtsextreme Nachrichten auf Whatsapp austauscht, der Linke auch mal Terrorist*innen nennt und schon 2013 enthusiastisch dafür warb, die AfD zu wählen.
Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Es geht um einen der größten Polizeiskandale, die es in Deutschland je gab, und ein bis zu 60-köpfiges Ermittlungsteam, das anscheinend immer einen Schritt langsamer ist als die Täter.
Doch am Anfang – das passt zu dieser deutschen Geschichte – geht es zunächst nur um ein Fax.
Es ist die Frankfurter Anwältin Seda Başay-Yıldız, die im Sommer 2018 zuerst davon spricht. Başay-Yıldız war Nebenklage-Anwältin im NSU-Prozess. Der NSU ermordete von 2000 bis 2007 aus rassistischen Motiven mindestens zehn Menschen. Başay-Yıldız vertritt aber auch einen Islamisten, der nach Tunesien abgeschoben wird – zu Unrecht, wie ein Gericht urteilt. Zahlreiche Medien berichten über den Fall.
Weil man ihren Mandanten nicht sofort zurückholt, fordert Başay-Yıldız damals von der Stadt Bochum ein Zwangsgeld von 10.000 Euro. „Das Fax ist in der Nacht raus, das Geld muss gezahlt werden“, wird sie in den Berichten zitiert. Das rechtsextreme Hetzportal PI-News schreibt am 1. August, die Anwältin fordere „die Kohle knallhart per Fax ein“.
Am 2. August 2018 bekommt Başay-Yıldız selbst ein Fax, gesendet über einen Onlineanbieter. Als Absender angegeben: Uwe Böhnhardt, der Name eines der toten NSU-Terroristen. Im Fax wird sie als „miese Türkensau“ beschimpft, und ihr wird gedroht: „Als Vergeltung für 10000 € Zwangsgeld schlachten wir deine Tochter.“ Auch der Name der Tochter steht in dem kurzen Text und die Wohnanschrift der Familie. Das Fax endet mit „Gruss NSU 2.0“. Damit beginnt ein Kriminalfall, der das Vertrauen in die Polizei erschüttern wird.
Denn als die Frankfurter Ermittler*innen nachforschen, woher der Absender die Privatadresse und die Angehörigen der Rechtsanwältin kennt, werden sie stutzig: Ausgerechnet im eigenen Haus hat am selben Tag jemand exakt diese Daten abgerufen. Jemand vom Streifendienst aus dem 1. Revier, direkt in der Frankfurter Innenstadt.
Ist es möglich, dass jemand von der Polizei illegal auf vertrauliche Personendaten zugreift, um sie in Drohschreiben zu verwenden, die sich auf rechtsextreme Mörder beziehen?
Die Verwirrung ist groß. Es kommen mehr Schreiben, mal gehen sie an einzelne Adressaten, mal sind es Sammelmails an Redaktionen oder sogar die Ermittler*innen. Mal enthalten sie Geburtsdaten, Privatadressen und Namen von Verwandten, die öffentlich nicht bekannt sind. Mal nur gegoogelte Informationen.
Ermittelt die Polizei in dem Fall, in dem eigene Kolleg*innen in Verdacht stehen, wirklich gut genug?
Die Schreiben beziehen sich aufeinander und manchmal sogar auf andere Drohschreiber*innen. Im Juli 2020, zwei Jahre nach dem ersten Fax, prüft der Generalbundesanwalt, ob er den Fall übernimmt. Der hessische Polizeipräsident wird entlassen, ein Sonderermittler eingesetzt. Bis heute werden immer neue Mails mit Beschimpfungen und Drohungen verschickt. Inzwischen sind es mehr als 80.
Unerträglich für die Betroffenen – und wie ein Stinkefinger in Richtung Polizei.
Wer steckt hinter „NSU 2.0“? Wie werden die Empfänger*innen der Drohschreiben ausgewählt? Und ermittelt die Polizei in dem Fall, in dem eigene Kolleg*innen unter Verdacht stehen, gut genug?
Uns liegen mehr als ein Dutzend der Drohschreiben vor. Wir werten Unterlagen aus, recherchieren in sozialen Netzwerken und Darknet-Foren. Wir sprechen mit Empfänger*innen der Drohungen, mit Ermittler*innen. Und irgendwann stehen wir vor einem Haus in Frankfurt, in dem ein Polizist wohnt, und betätigen die Klingel, an der sein eigener Name nicht steht. Über diesen Polizisten hat die Öffentlichkeit bislang so gut wie nichts erfahren.
Wir sind bereits Anfang 2019 auf ihn gestoßen, bei einer Recherche über zwei andere mutmaßlich rechtsextreme Polizisten im hessischen Kirtorf. Aber die Hinweise waren vage, seine mutmaßliche Rolle war noch unklar. Als der „NSU 2.0“-Skandal sich ausweitet, schauen wir genauer auf die Puzzleteile, finden seinen Namen heraus, Details über seine Person, seine Facebook-Seite. Und dann bekommen wir die Bestätigung: Er ist der Hauptverdächtige, gegen den bis heute im Fall „NSU 2.0“ ermittelt wird. Er heißt Johannes S.
Der Anrufer
Am Freitag, den 17. August 2018 ruft ein Mann bei der taz an, der zu einem der Geschäftsführer durchgestellt wird. Er sagt, er sei Polizist vom Abschnitt 36, Berlin-Wedding. Es gehe um eine Strafanzeige gegen unbekannt, die Hengameh Yaghoobifarah erstattet habe. Yaghoobifarah schreibt seit Jahren für die taz, vor allem eine Kolumne. Der Anrufer fragt nach Yaghoobifarahs Kontaktdaten. Der Geschäftsführer will ihn an eine der beiden stellvertretenden Chefredakteurinnen weiterleiten. Er erreicht sie nicht.
Ein paar Tage später, am 22. August gegen 15 Uhr, ruft der Mann erneut an, mit unterdrückter Nummer. Dieses Mal erreicht er die Chefredaktion. Sie hat in der Zwischenzeit erfahren, dass Yaghoobifarah keinen Kontakt zu einem Polizeirevier im Wedding hatte. Und überhaupt: Irgendetwas stimmt nicht. Sie bittet den angeblichen Polizisten so lange um seine Kontaktdaten, bis er das Gespräch mit einer Drohung beendet: „Ihrer Kollegin blüht noch einiges.“ So hat es die stellvertretende Chefredakteurin in einem Gedächtnisprotokoll festgehalten.
Hengameh Yaghoobifarah bekommt schon länger massive Drohungen, meist wenn ein polarisierender Text veröffentlicht wird. Der letzte große Aufreger war zu diesem Zeitpunkt etwa ein Jahr her, im Oktober 2017 erschien eine Kolumne unter dem Titel „Deutsche, schafft euch ab!“.
Eine Woche vor dem Anruf im August 2018 erwähnt zunächst die Basler Zeitung und dann das Hetzportal PI-News die inzwischen schon fast ein Jahr alte Kolumne und belegt die Autor*in mit diskriminierenden Ausdrücken.
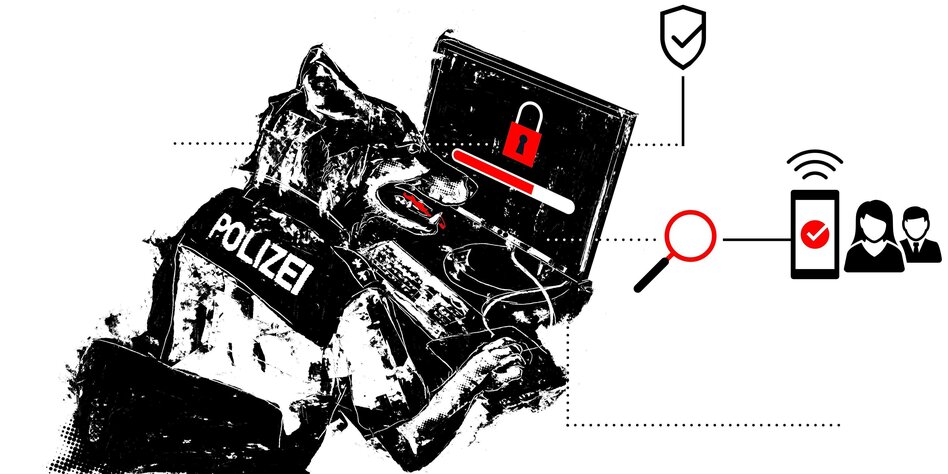
Foto: Illustration: Oliver Sperl
Es hatte zuvor schon Versuche gegeben, Yaghoobifarahs Daten auszuspionieren, mit durchaus aufwendigen Aktionen. 2017 etwa täuschen Unbekannte eine Einladung zu einem Vortrag in die Schweiz vor und gelangen so an Yaghoobifarahs Adresse. Daraufhin werden Pizzen, Zeitungen und Magazine an Yaghoobifarah geschickt, sogar ein Inkassounternehmen meldete sich wegen eines angeblich nicht zurückgezahlten Kredits. In einer anonymen Mail stand: „Ich hoffe, dass Dir mein Spiel ansonsten Spass macht.“
Die beiden Anrufe bei der taz im August 2018 reihen sich da zunächst ein. Dass sie eine besondere Dimension haben, ahnt damals noch niemand. Zwei Wochen zuvor war das erste „NSU 2.0“-Drohfax bei der Frankfurter Rechtsanwältin Başay-Yıldız eingegangen. Doch die Öffentlichkeit weiß davon noch nichts.
Mitte Dezember 2018 wird das Drohfax an Başay-Yıldız durch Medien öffentlich gemacht. Der Skandal in Hessen weitet sich aus. Ein Polizist mit einem privaten Nazimuseum fliegt auf, Polizisten mit Hitlergruß, Polizisten als Reichsbürger und so viele problematische Chatgruppen, dass es schwerfällt, den Überblick zu behalten. In der hessischen Polizei scheinen Rechtsextreme ihre Ideologie frei ausleben zu können, ohne von Kolleg*innen oder Vorgesetzten gestoppt zu werden. Rund 60 Beamt*innen ermitteln zwischenzeitlich wegen der rechtsextremen Umtriebe in den eigenen Reihen.
Ein Jahr vergeht. Am 8. Oktober 2019 erreicht die taz um 1.39 Uhr über ihr Leserbriefformular eine Nachricht, als Kontakt ist eine Mailadresse angegeben, die auf „yandex.com“ endet, vor dem @-Zeichen steht ein rassistisches Schimpfwort. Es ist die Adresse, die die Ermittler*innen dem „NSU 2.0“ zuordnen.

Seit über zwei Jahren werden Frauen, die sich offen gegen rechts positionieren, mit dem Tod bedroht. Absender: „NSU 2.0“. Steckt ein Polizist dahinter? Eine Spurensuche in der taz am wochenende vom 05./06. September. Außerdem: Die Theaterhäuser öffnen wieder – mit strengem Hygienekonzept. Was macht Corona mit der Kunst? Und: Eine Kräuterwanderung im Schwarzwald. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im praktischen Wochenendabo. Und rund um die Uhr bei Facebook und Twitter.
In der Mail wird die stellvertretende taz-Chefredakteurin als „Volksschädling“ beschimpft. Der Absender schreibt, dass er sie ja „persönlich telefonisch schon vor Monaten zutreffend belehrt habe“, dass sich Hengameh Yaghoobifarah zurückzuhalten habe. Es stehen diverse Insiderinformationen in der Mail, neben der Anspielung auf das Telefonat auch die Wohnadresse der Rechtsanwältin Başay-Yıldız, die schon im ersten Drohfax an sie genannt wurde.
Der Anruf ein gutes Jahr zuvor erscheint nun in einem anderen Licht. Er hat etwas mit „NSU 2.0“ zu tun. Der taz-Justiziar informiert das Berliner Landeskriminalamt (LKA), der Staatsschutz ermittelt.
In Hessen sind die Ermittlungen vorangegangen. Erst steht eine Streifenpolizistin aus Frankfurt in Verdacht. Sie war an dem Computer eingeloggt, von dem aus die Daten von Başay-Yıldız abgefragt wurden. Die Polizistin bestreitet die Abfrage, doch die Ermittler*innen durchforsten ihr Handy und stoßen auf eine Chatgruppe mit vielen rechtsextremen Nachrichten.
Einen Kollegen aus demselben Revier machen sie als Hauptverdächtigen aus. Auch er war Mitglied der Chatgruppe, auch er war zum Zeitpunkt der Adressabfrage im Dienst. Die Ermittler*innen glauben: Er hat die „NSU 2.0“-Faxe verschickt. Es ist Johannes S. Bis heute ist er der einzige konkrete Tatverdächtige. Wochenlang wird er überwacht.
Legt man die Nachrichten nebeneinander, wirken sie wie eine Schnitzeljagd. Empfindet der Urheber der Drohschreiben alles nur als Spiel? Mit wem spielt er es – mit seinen Opfern? Den Behörden?
Ein Dreivierteljahr nach der ersten Mail an die taz, am 23. Juni 2020, kommt wieder eine Nachricht vom „NSU 2.0“ bei der Redaktion an, dieses Mal mit noch deutlicherer Bezugnahme auf die Anrufe im Jahr 2018. Diese Nachricht wird gleich fünfmal an die taz geschickt, über Kontaktformulare und direkt als Mail, gegen halb vier Uhr morgens, wieder von der Yandex-Adresse, „SS-Obersturmbannführer“ als Absendername, Betreff: Hengameh Yaghoobifarah.
Neben sexistischen und queerfeindlichen Beschimpfungen steht in der Mail auch Yaghoobifarahs Geburtsdatum. Das ist zwar nicht sehr leicht zu finden, aber auch nicht geheim. Vor allem aber ist das genaue Datum des zweiten Anrufs in der taz-Redaktion genannt. Der „Führer“ des „NSU 2.0“, wie sich der Absender bezeichnet, schreibt, dass er „schon am 22.8.2018 telefonisch höchstpersönlich klargemacht“ habe, „dass wir Hengameh Yaghoobifarah […] ganz besonders zutreffend betreuen werden“. Die Mail endet mit „Heil Hitler“.
Der taz-Justiziar gibt auch diese Mail ans LKA weiter. Schnell ist klar: Bei dem Anrufer und dem Mailschreiber muss es sich um denselben Mann handeln. Andernfalls müsste es einen engen Informationsaustausch gegeben haben. Wie sonst sollte der Mailschreiber zwei Jahre später den Anruf in der taz auf den Tag genau datieren können?
Es spricht einiges dafür, dass es sich bei dem Absender der „NSU 2.0“-Mails um eine einzelne Person handelt, jedenfalls nicht um eine größere Gruppe. „Der Führer des NSU 2.0“ schreibt immer wieder aus der Ich-Perspektive. Die uns vorliegenden Mails haben eine weitgehend identische Formatierung, aber es ist kein Baukastensystem. Die einzelnen Schreiben sind individuell auf eine*n Empfänger*in oder einen Sachverhalt zugeschnitten. Ihr Ton ist eine seltsame Mischung aus formal und vulgär.
Mehrfach taucht auch derselbe Rechtschreibfehler in einem selten gebrauchten Wort auf. „Blut wird fließen, knüppelhagedick!“ steht in den Mails. Und das im Abstand von Monaten. Es müsste „knüppelhageldick“ heißen, mit l.
Die Zeile ist eine Referenz auf ein rechtsextremes und antisemitisches Szenelied. Und ein Beispiel dafür, dass die Nachrichten kleine Hinweise enthalten, die sich manchmal auch aufeinander beziehen. Legt man die Nachrichten nebeneinander, wirken sie wie eine Schnitzeljagd. Empfindet der Urheber der Drohschreiben das alles nur als Spiel? Und mit wem spielt er es – mit seinen Opfern? Den Behörden?
Wir folgen den Spuren. Im Leserbriefformular wurde eine Frankfurter Adresse angegeben. Auf den ersten Blick wirkt sie einfach hingeschrieben, online kann man nichts weiter über sie herausfinden. Wir fahren hin.
Hier stehen bewusst keine Details. Vieles ist vorstellbar: dass hier ein weiteres Opfer lebt. Oder vielleicht jemand aus dem Ermittlungsteam. Oder eine Landespolitikerin, die sich mit dem Thema befasst? Auf dem Klingelschild steht: Başay-Yıldız. Es ist nicht dieselbe Adresse der Anwältin, die im ersten Fax stand, und damit eine neue Drohung an sie: Ich weiß noch immer, wo du wohnst.
Nach allem was passiert ist, ist die Anschrift von Başay-Yıldız natürlich geheim, im Melderegister gesperrt sowieso. Irgendwie muss der Absender an die Adresse gekommen sein. Wurden wieder Daten bei der Polizei abgefragt? Wurde das überprüft? Das beantwortet uns tagelang keiner. Erst nachdem wir am Donnerstag einen Text auf taz.de veröffentlichen, sagt Innenminister Peter Beuth (CDU), es habe in Hessen keine neue Abfrage gegeben.
Wurde Seda Başay-Yıldız von den Ermittler*innen darüber informiert? Sie äußert sich häufig zu den Drohungen. Dieses Mal aber will sie nichts dazu sagen.
Neue Opfer
Am 5. März 2019 um 12.52 Uhr bekommt die Kabarettistin İdil Baydar eine SMS, geschickt über die Website 5vor12.de. Von dort lassen sich anonym SMS verschicken. Baydar wird mit ähnlichen Worten beschimpft wie zuvor Başay-Yıldız: „verpiss dich aus Deutschland, solange du noch lebend rauskommst!!!“ Am Ende steht: „SS-Obersturmbannführer“. Am 15. März kommt die nächste SMS, darin steht der Vorname ihrer Mutter.
Wieso ausgerechnet Baydar? Die Kabarettistin hat mit ihrer Kunstfigur Jilet Ayşe eine gewisse Bekanntheit erreicht, aber als Nischenstar. Auf Youtube und eher in Berlin als in Hessen. Aber sie ist eine Frau, und sie hat einen Migrationshintergrund; das allein könnte sie schon zum Hassobjekt machen.
Am 5. März, am Tag der ersten SMS, wurden an einem Polizeicomputer in Wiesbaden persönliche Daten von Baydar abgerufen. Am selben Tag bei der Polizei in Berlin. Von beidem wissen die Ermittler*innen in Hessen zu diesem Zeitpunkt nichts, erst Monate später werden sie eine klare Verbindung zu den Drohfaxen an Başay-Yıldız sehen. Die Drohungen an Baydar werden zunächst in Berlin bearbeitet – und die Ermittlungen im Mai 2019 zunächst eingestellt.
Mit einem Fax hat es angefangen, es gab Anrufe und SMS vom „NSU 2.0“, später Mails. Spätestens im Sommer 2019 wird wohl die erste Nachricht von der erwähnten Yandex-Adresse verschickt. Für die Ermittler*innen ist es ungünstig, dass dieser Anbieter benutzt wird. Denn sie können nicht sehen, von wo aus die Mails verschickt werden. Sie sehen nur, dass sie aus Russland kommen, weil dort der Server steht.
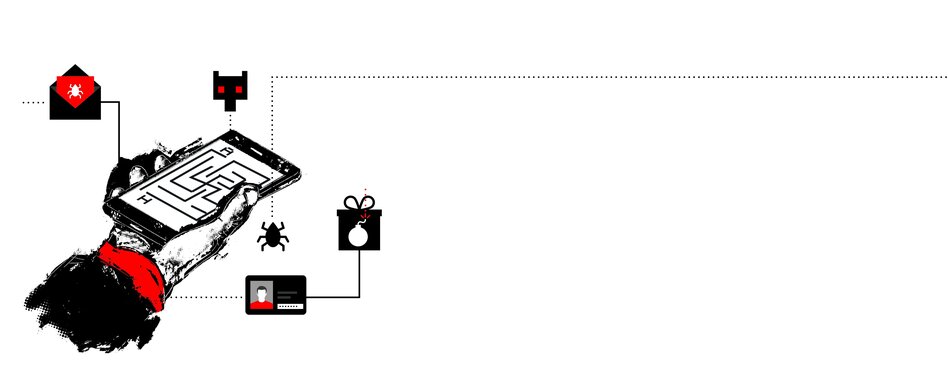
Foto: Illustration: Oliver Sperl
Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main stellt ein Rechtshilfeersuchen, um an die Verkehrsdaten zu kommen. Am 3. September 2019 wird es nach Russland geschickt. Man will also wissen, wann und von wo aus auf das Mailpostfach zugegriffen wurde. Eine Antwort gibt es nach taz-Informationen bis heute nicht, obwohl die deutsche Seite mehrfach bei der russischen Generalstaatsanwaltschaft nachgehakt hat.
Die Nachrichten, die der „NSU 2.0“ verschickt, richten inzwischen Chaos an. Immer wieder müssen wegen Bombendrohungen Gebäude geräumt werden. So etwa im Oktober 2019, als eine Mail von der Yandex-Adresse die Uni Hamburg erreicht: „Ihr verfluchten und links-grün versifften Schweine, ihr macht Deutschland nicht fertig. Im Hauptgebäude […] haben wir gegenwärtig gleichzeitig drei Sprengsätze deponiert.“
Oder im April 2020 in Berlin, kurz vor Beginn des Prozesses gegen André M. Dem 32-jährigen Neonazi aus Halstenbek bei Hamburg wird vorgeworfen, über 100 E-Mails verschickt zu haben, meist mit dem Absender „Nationalsozialistische Offensive“, darunter 87 Bombendrohungen. Nun erhält das Gericht ein Fax, in dem „NSU 2.0 Der Führer“ Berichterstatter*innen droht: „Diese Bastarde werden in ihrem eigenen Blut vor dem Saal 220 ersaufen.“ Bomben werden keine gefunden.
Seit 2018 sind ähnliche Drohmails mit weiteren verschiedenen Absendern aufgetaucht: „Staatsstreichorchester“ oder auch mal „NSU 2.0“, von anderen Mailadressen verschickt. Immer wieder heißt es, die Absender müssten zusammenarbeiten. Doch das ist wohl nicht der Fall. Nachvollziehen lässt sich dies im Darknet. In diesen Teil des Internets gelangt man, wenn man mit einem sogenannten Tor Browser spezielle Websites aufruft. Verschlüsselt und anonym.
Im Dezember 2018 postet dort in einem Forum ein Nutzer namens „Wehrmacht“ einen Artikel über die Drohung an Seda Başay-Yıldız und schreibt: „Haha, es ist ja schon fast ein wenig peinlich, sich mit diesen Stümpern die Gesinnung zu teilen. Was für Pfeifen.“
Auch „Wehrmacht“ verschickt Drohmails, manchmal auch unter dem Namen „Elysium“ oder „Staatsstreichorchester“, sie sind lang und wirr und voll abgründiger Drohungen, auch sie gehen an Journalist*innen, Politiker*innen, Prominente. In einer Mail kündigt er an: „Wir werden schon noch die Adresse der Frau Başay-Yıldız herausfinden.“
Zu diesem Zeitpunkt hat die Adresse längst in dem Fax gestanden, abgefragt aus einem Polizeicomputer. Wer auch immer hinter „Wehrmacht“ steckt: Er hat zwar auch das Kürzel „NSU 2.0“ benutzt, bevor das erste Drohfax öffentlich wurde, der „NSU 2.0“-Drohschreiber ist er aber offenbar nicht.
Auch André M., der vor Gericht stehende Bombendroher, der sich im Forum „Stahlgewitter“ nannte, ist es nicht. In seinen Mails wimmelt es von Rechtschreibfehlern. Und: Er saß bis Oktober 2018 noch in Haft und tut es seit April 2019 wieder.
Zwar bezieht sich der „NSU 2.0“-Schreiber immer wieder auf die beiden, die Ermittler*innen sehen das aber als falsche Fährten. Es seien keine direkten Bezüge festgestellt worden, hat der hessische Innenminister Peter Beuth im Juli im Innenausschuss des Landtags gesagt.
Klar ist aber auch: Die bekannt gewordenen Abfragen in Polizeisystemen ohne dienstlichen Anlass kann nicht eine Person allein gemacht haben; es gab sie in Frankfurt, in zwei Revieren in Wiesbaden, in Hamburg und in Berlin. Die zu den fraglichen Zeiten eingeloggten Beamt*innen sagen, dass sie die Daten nicht abgerufen haben oder nichts mit dem „NSU 2.0“ zu tun haben.
Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Aber die Datenabfragen können kaum in allen Fällen Zufall sein. Weil der zeitliche Zusammenhang eklatant ist. Weil die Daten anders kaum zu beschaffen sind. Weil es unwahrscheinlich ist, dass sich mehrere Polizist*innen plötzlich für eine Nischenkabarettistin wie İdil Baydar interessieren – und dann später private Daten von ihr in einer Drohmail stehen.
Es könnte also eine Gruppe von Polizist*innen geben, die den „NSU 2.0“ bilden. Oder es sind einzelne Beamt*innen, die für die Haupttäter*innen in den Computer schauen. Womöglich erschleicht sich der Täter auch die Daten. Ruft an, gibt sich als Kollege aus und bittet um eine Abfrage.
Vielleicht ein Expolizist. In einer der „NSU 2.0“-Drohmails ist die Rede von „gehobenem Dienst im Vorruhestand“. So könnte sich ein Polizist vorkommen, dem verboten wurde, die Dienstgeschäfte zu führen. So wie Johannes S., 31, der Beschuldigte aus Frankfurt.
Es könnte aber auch einen Umschlagplatz geben, irgendwo versteckt im Darknet oder auf einer Chat-Plattform, wo die privaten Daten der Opfer gesammelt und ausgetauscht werden. Mehrere Personen könnten dort aktiv sein, darunter auch Polizisten, sie müssten sich nicht einmal kennen. Und der „NSU 2.0“ benutzt die Daten dann für die Drohmails.
Mails, wie die Nachricht, die im Juli 2020 an die TV-Moderatorin Maybrit Illner gerichtet ist; sie beginnt harmlos. „Seit Jahren sehe ich Ihre Sendung mit Interesse“, schreibt der Absender und fordert in einem ironisch-gehässigen Ton eine Sendung zu dem Thema „Wann wird Deutschland endlich abgeschafft?“.
Wir drücken seine Klingel, an der sein Name nicht steht. Über die Gegensprechanlage antwortet Johannes S., der Polizist
Daran sollten, das fordert der Schreiber, folgende Gäste teilnehmen: Die taz-Kolumnist*in Hengameh Yaghoobifarah, die Kabarettistin İdil Baydar, die Bundestagsabgeordnete Martina Renner, die hessische Landespolitikerin Janine Wissler und Anne Helm aus dem Berliner Abgeordnetenhaus: Frauen und Queers, die politisch links stehen oder einen Migrationshintergrund haben. Oder beides. Sie alle sind in „NSU 2.0“-Nachrichten bedroht worden – am Ende der Mail an Maybrit Illner erneut und ganz unverblümt mit dem Tod.
Die Frauen sagen, sie wollen sich nicht einschüchtern lassen. „Grüße an den Oberstrumpfbandführer“, twitterte Seda Başay-Yıldız kürzlich. „Ihr bekommt uns nicht klein.“ Dazu ein Bild von sich mit den anderen Frauen.
Dass die Mail an „Maybrit Illner“ ging, ist interessant. In dieser ZDF-Talkshow wurde das Kürzel „NSU 2.0“ zum ersten Mal in einem größeren Rahmen verwendet. Das war im Sommer 2015, als vermehrt Flüchtlingsunterkünfte angezündet wurden. Der Publizist Sascha Lobo hatte damals „NSU 2.0“ in die Diskussion eingeführt, ganz bewusst, er wollte damit vor einer rechtsextremen Bedrohung warnen. Womöglich kam der „NSU 2.0“ so auf seinen Namen.
Der Polizist
Anfang 2012 postet ein junger Mann aus einer mittelhessischen Kleinstadt auf Facebook, er sei „einer der glücklichsten Menschen der Welt“. Er ist 23 Jahre alt und hat soeben eine Zusage bekommen. Johannes S. darf zur Polizei.
Seine Eltern haben sich früh getrennt, und seine Mutter kam mit einem Mann zusammen, der aus Ägypten stammt. Eine Lehrerin erinnert sich daran, dass S. kein gutes Verhältnis zu ihm hatte, „er hat einen tiefen Groll gegen diesen Mann gehegt“.
Johannes S. engagierte sich in der Schülervertretung und trainierte eine Mädchenbasketballmannschaft, er ist Partygänger, Computercrack. Rechtes Gedankengut? Davon ist im Gespräch mit Leuten, die ihn von damals kennen, nichts zu hören. Wir klingeln bei seiner Mutter, ein kurzes Gespräch durch den Türspalt. Wir sagen, dass wir wegen der Ermittlungen der Polizei da sind, ob wir ihm eine Nachricht zukommen lassen können. Nein, sagt sie. Und: „Ermitteln Sie mal.“ Es sei nämlich alles anders, von Anfang an. Tür zu.
Nach dem Abi hat er seinen Zivildienst beim Roten Kreuz gemacht und danach eine Weile als Rettungssanitäter gejobbt, bevor er an die Polizeihochschule ging. Er zitiert gern den Comedian Serdar Somuncu: „Jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung!“
Über sich selbst schreibt er in seiner Bachelorarbeit, er habe schwarzen Humor. Die Arbeit untersucht, inwieweit Humor der Polizei bei der Einsatzbewältigung helfen kann. Er verweist auf einen Vertreter des Lachyoga in Europa, der mit „Juxbriefen“ bekannt wurde, die er an Behörden und Unternehmen schickte. Sollte alles vielleicht ein absolut miserabler Scherz sein?
In sozialen Netzwerken postet er Bilder von Konzerten und welche vom ersten gemeinsamen Urlaub mit Frau und Kind. Aber dann sind da auch politische Äußerungen. Auf Facebook schreibt er kurz vor der Bundestagswahl 2013: „Am 22. heißt es Kreuz für die AfD....und nein diese Stimme ist NICHT verschenkt!“ Als der G20-Gipfel in Hamburg stattfindet, postet er auf Instagram einen „Fck Antifa“-Schriftzug, dazu Hashtags wie #scheisslinke, #terrorvonlinks und #ingedankenbeidenkollegen.
In der Whatsapp-Chatgruppe, in der er mit einer Handvoll Kolleg*innen zum Teil rechtsextreme Nachrichten austauschte, äußert er sich offenbar deutlicher. 18 von 40 Inhalten, die als strafrechtlich relevant eingestuft werden, sollen laut Spiegel von ihm stammen.
Als er in Verdacht gerät, hinter den „NSU 2.0“-Drohungen zu stecken, überwachen die Ermittler*innen seine Kommunikation, Telefon und Internet, durchsuchen im Juni 2019 seine Wohnung in Frankfurt und das Haus in Kirtorf, einem abgelegenen Städtchen im mittelhessischen Vogelsbergkreis, das er, so sagen Anwohner*innen, von seinem Vater geerbt habe. Schon im Herbst 2018 hatte die Polizei das Haus durchsucht. Bei der Durchsuchung im Juni 2019 nehmen sie den Polizisten vorläufig fest. Für mehr reicht es offenbar nicht.
Bis Ende 2019 seien die Ermittlungen gegen Johannes S. intensiv geführt worden, sagte der zuständige Oberstaatsanwalt kürzlich im Rechtsausschuss des Landtags. Die Ermittler*innen glauben immer noch, dass Johannes S. die ersten „NSU 2.0“-Drohfaxe verschickt hat. Der Verdacht, dass er auch hinter den Mails von der Yandex-Adresse steht, hat sich laut Staatsanwaltschaft aber nicht erhärtet. Vielleicht hat er sie nicht verschickt. Vielleicht haben die Ermittler aber auch nur nicht genügend Beweise.
Der Kontakt
Auffällig ist: In keiner der offiziellen Äußerungen zum „NSU 2.0“-Komplex wurden die Drohungen an Hengameh Yaghoobifarah auch nur ansatzweise erwähnt. Weder gegenüber Medienvertretern noch wenn Abgeordnete im Landtag nach dem Ermittlungsstand fragen. Dabei ist der Fall in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich.
Als der unbekannte Anrufer am 17. August 2018 in der taz nach Yaghoobifarah fragt, weiß die Öffentlichkeit noch nichts von dem ersten „NSU 2.0“-Drohfax. Mehrfach wird in den Mails betont, dass Yaghoobifarah einer „Sonderbehandlung“ unterliege. Auch ist in keinem der uns sonst vorliegenden „NSU 2.0“-Schreiben der Zusammenhang zwischen den Yandex-Mails und den Drohfaxen an Başay-Yıldız so deutlich. Schließlich werden in den Mails an die taz zweimal unterschiedliche korrekte Wohnadressen der Anwältin genannt.
Warum Hengameh Yaghoobifarah?
Wir schicken eine Mail an die Yandex-Adresse und fragen, wieso sich ausgerechnet mit dieser Person beschäftigt wird. Die Antwort kommt einige Tage später, mitten in der Nacht: Yaghoobifarah sei „unser Primärziel“ und könne sich ja nicht ewig verstecken. Es folgen eine Beleidigung und die übliche Grußformel des „NSU 2.0“. Wir fragen auch nach Seda Başay-Yıldız, İdil Baydar und Martina Renner. Und als wartete er darauf, dass jemand sein Spiel mit ihm spielt, weist er noch einmal auf Başay-Yıldız hin: Sie sei ja mittlerweile umgezogen. „Hilft ihr aber nicht.“
Wir wollen direkt mit dem beschuldigten Polizisten sprechen. Er darf derzeit seine Dienstgeschäfte nicht ausüben, heißt es, ist aber nicht suspendiert, bekommt weiter sein volles Gehalt. Gegenüber den Ermittlern schweigt er zu den Vorwürfen. Und auch von den Kolleg*innen sagt offenbar niemand gegen ihn aus.
Es dauert eine Weile, den Ort zu finden, an dem man dem Polizisten persönlich Fragen stellen könnte. Sein Haus in Kirtorf wird renoviert, im Garten liegt Sperrmüll. Es ist niemand da.
Am Freitag vor einer Woche stehen wir dann in einem Frankfurter Stadtteil vor einem Mehrfamilienhaus. Der Eingang zum Hof ist durch eine Gittertür versperrt. Wir drücken seine Klingel, an der sein Name nicht steht, und sprechen ihn mit Namen an. Über die Gegensprechanlage antwortet Johannes S., der Polizist. Wir stellen uns vor und fragen, ob wir ihn sprechen können, es gehe um die Ermittlungen gegen ihn. Er sagt: „Kein Interesse.“
In der Nacht zu Sonntag werden erneut „NSU 2.0“-Drohmails verschickt, auch an die JVA Berlin, den Sonderermittler sowie das LKA in Hessen. Und am Dienstag wieder.








Leser*innenkommentare
Pink
Es gibt so viele Rechtsextreme wie noch nie. Und täglich grüßt das Murmeltier. Der Bundesinnenminister sollte im Keller mit der Eisenbahn spielen.
GroKo ? Nein Danke !
Jalella
Ich denke, wir werden uns damit abfinden müssen, dass auch dieser Fall nicht aufgeklärt werden wird. Sicher nicht von der Polizei jedenfalls.
Es erhebt isch die Frage, was man noch unternehmen kann wenn die Behörde, die dafür zuständig wäre, selbst der Täter ist.
Mal ernsthaft: was wäre passiert, wenn jemand von einem nicht-Polizei-Rechner solche Daten hätte abrufen können und seine Hassmails nicht unter NSU 2.0, sondern und RAF 3.2 geschickt hätte? Ich bin erschreckend sicher, dass die Ermittlungen nicht 2 Jahre später immer noch im Trüben fischen würden.
Thomas Brunst
@Jalella Man hat sich in Hessen noch nicht einmal die Mühe gemacht, einen Sonderermittler auszuwählen, welcher diesbezüglich nicht aus einem belasteten Präsidiumsbereich stammt: Der Hessische (polizeiinterne) Sonderermittler, Hanspeter Mener. kommt aus dem Polizeipräsidium Frankfurt/ Main und soll bspw. im untergeordneten 1. Frankfurter Polizeirevier ermitteln – das ist m. E. zu viel (Behörden-)Nähe.
R R
Vom bayrischen Rundfunk gibt es gerade einen Podcast: True Crime: Die Sprache des Verbrechens.
Da geht es um linguistische Forensik - Vergleich von Schriftstúcken und Identifikation des Autors.
Die dort zu hörenden Experten haben eine private Ermittlerfirma zu diesem Thema.
R R
@R R www.bayern3.de/crime
sprachprofiler.de
Samvim
Mh. Da wird eine gewaltige Recherche angeteasert und am Ende ist der Leser genau so schlau wie vorher. Es werden Fragen aufgeworfen und dann nicht beantwortet: Ermittelt denn nun die Polizei gut genug? Oder nicht? Oder was? Und an welchen Fakten macht ihr das fest? Veranstaltet der/die/das Täter eine Schnitzeljagd? Mit den Behörden, Opfern, sonstwen?
Statt Antworten oder Fakten gibt es ausschließlich persönliche Bewertungen und Vermutungen wie sonst nur in der Bild. Aber auch die Art und Weise der "Recherche" ist ein Traum:
"Uns liegen mehr als ein Dutzend der Drohschreiben vor. Wir werten Unterlagen aus, recherchieren in sozialen Netzwerken und Darknet-Foren. Wir sprechen mit Empfänger*innen der Drohungen, mit Ermittler*innen. Und irgendwann stehen wir vor einem Haus in Frankfurt, in dem ein Polizist wohnt, und betätigen die Klingel, an der sein eigener Name nicht steht."
Eine Haufen Text, der absolut überhaupt nichts aussagt, eine literarische Blähung. Was ihr tatsächlich gemacht habt bleibt im Dunkeln. Meine Vermutung: Ihr habt abgeschrieben, was man bisher zum Thema lesen konnte, es für eure Bubble gefiltert und das wars
TRG
Waw krass gute Recherche!
Bitte bleibt dran!
Pink
@TRG Jaaa !! Bitte dranbleiben. Habe meine Printausgabe an Freunde gegeben.
Blume81
Vielen Dank für diesen investigativen Journalismus! Es sollte eigentlich für die Polizeibehörden eine Selbstverständlichkeit sein, dass ein Zugriff auf solch schützenswerten Daten nur mit personengebundenen Accounts erfolgt. Außerdem muss in diesem Fall auch ein Logging jeglicher Lese- und Schreibzugriffe erfolgen, so dass ein datenschutzkonformer Audit-Trail vorhanden ist. Sollte die hessische Polizei über derartige IT-Kenntnisse zur Einführung von richtig betriebenen IT-Systemen nicht verfügen, gibt es Amtshilfe, klappt ja bei Demos auch meistens.
Pace#
Ein Artikel, der trotz seiner Langatmigkeit lesenswert ist. Es kommt aber trotzdem nicht zufriedenstellend rüber warum sich alles um diesen engen Personenkreis dreht. Der Mülleimer der taz ist bestimmt voll von primitivsten Beschimpfungen, rüden Morddrohungen, übelsten sexistischen Beleidigungen.... unzählige Bahnhöfe, Flughäfen, Behörden, Firmen,Schulen etc. wurden und werden wegen Drohungen geräumt. Drohungen dieser Art gibt es schon immer, nur das Internet hat die
Büchse der Pandora weit und nicht mehr beherrschbar geöffnet. Wie Daten raffiniert besorgt werden, hat die taz mit der Schilderung der Telefonanrufe in der Redaktion gezeigt. Auch eine Privatadresse einer Anwältin ausfindig zu machen setzt nicht die Nutzung eines Polizeicomputers voraus. Kurz zusammengefasst den Nerds den Honks, denen die nur einigermaßen geschickt mit Computer umgehen können sind keine Grenzen gesetzt. Als Nachtrag... die Mülleimer der AfD, der Linken, der CSU, der FAZ, der Bild, dem Tagesspiegel sind genauso voll, Entertainer* aller Couleur kommen nicht mit der Leerung hinterher, je größer die mediale Aufmerksamkeit ... desto größer das zufriedene Grunzen der Übelsten der Üblen, der getarnten Dunkelmänner.. das gab es noch nie ......
Heckenschützen die aus sicherste Deckung schießen können und eine riesige mediale Aufmerksamkeit genießen.Bitte taz stoppt das üble Spiel..kein Gram Druckerschwärze ... es macht den Gestörten viel weniger Spaß wenn sie ohne mediale Aufmerksamkeit Gift spritzen.... Ermittlung ja, unbedingt ohne mediales Trommelfeuer. Bitte Bitte und " Deppen, Gestörte" gibt es bei der Polizei auch nicht mehr als im Durchschnitt der Bevölkerung. sic !
Thomas Brunst
Für viele BürgerInnen wirkt befremdlich, dass bspw. der wiesbadener Polizeibeamte, mit dessen Dienststellen-Account die Wissler-Abfrage getätigt wurde, lediglich als Zeuge geführt wird. Eine Durchsuchung privater Datenträger blieb auch, so dass sich diesbezüglich - im Nachhinein - keine Beweise mehr sichern lassen.
"(...) Mit dem „betroffenen Kollegen“ war jener Polizist gemeint, der bei der Abfrage über Janine Wissler vom 3. Wiesbadener Revier eingeloggt war, aber behauptete, den Namen Wissler nie gehört und die Abfrage nicht getätigt zu haben. Der leitende LKA-Mann berichtet nun, ihm sei entgegnet worden, die Festlegung des Zeugenstatus sei „die Entscheidung der sachleitenden Staatsanwaltschaft“ gewesen. (...)" (Frankfurter Rundschau, 27.07.20)
www.fr.de/rhein-ma...ruck-13844465.html
Pfanni
Bin froh, dass ich (wahrscheinlich noch) nicht im Fokus dieser Rechtsextremisten stehe.
Apropos „Rechtsextremisten“: Ein Bekannter sagte neulich, diese Bezeichnung sei nicht sehr glücklich gewählt, denn sie impliziere, dass es auch einen „Linksextremismus“ geben müsse. Und den gebe es doch gar nicht. Als ich ihm vorschlug, sich doch mal bei Indymedia umzutun und zu überlegen, wie „revolutionäre Besuche“ und ähnliche Formulierungen gemeint sein mögen, sagte er, das sei doch nur „witzig“ gemeint!
Jaja, genauso „witzig“, wie das wohl auch die im Beitrag genannten Empfänger von Drohmails aus der „NSU 2.0“ -Ecke empfinden!
Nicolai Nikitin
@Pfanni Es gibt (oder gab) keinen Linksextremismus ?
Bitte den Bekannten zum RAF-Komplex nachschulen lassen. Danke.
15797 (Profil gelöscht)
Gast
Der NSU Prozess wurde ja auc offensichtlich so geführt, das ja keine Tatsachen ans Licht der Welt kommen, von öffentlicher Vorverurteilung, Zeugen wurden massenhaft gestorben (oder zu Tode gestreichelt, da es in D nicht mit Novichok gearbeitet wird) ...
Der wirklich grosse Skandal um NSU 2 war der Prozess. Er lief so, wie eine öffentliches Name & Shame - für zu geringe Leistung
Sarg Kuss Möder
Chapeau, das ist jetzt aber Journalismus vom Feinsten. Karl May hätte seine wahre Freude daran. Hessen und Frankfurt ist mir spätestens seit Roland Kochs brutalsmöglicher Aufklärung ziemlich suspekt. Schwarzgeld aus der Schweiz, eine Regierungspartei, Kanther rechtskräftig verurteilt. Kochs Berater Dirk Metz wechselt zu Stefan Mappus, dem kürzesten Ba-Wü-Regierungschef aller Zeiten und Ende dieses Monats jährt sich der schwarze Donnerstag im Stuttgarter Schlossgarten zum zehnten Male. Im übrigen ein rechtswidriger Polizeieinsatz, der aber erst Jahre später so dargestellt wurde. Metz muss ein extrem guter Berater zu Polizeieinsätzen aus hessischen Zeiten gewesen sein. Im Internet kann man/frau alles finden.
Samvim
@Sarg Kuss Möder Sie meinen den literarisch tätig gewesenen Betrüger und Hochstapler Karl May? Nicht gerade ein Lob für einen Journalisten
Grauton
Danke für die Recherche und das Dranbleiben.
Katharina Geiser
@Grauton Dem schließe ich mich an.
Imto
Ach bei den linken können sie in jeder Unterhose eine Wanze unterbringen, aber bei den Rechten versagen plötzlich alle Institutionen. Wofür sind denn die ganzen Überwachungsgesetze gut?
Das die Sonderkomission immer noch keine Ergebnisse hat ist erschreckend, dass die Taz anscheind mehr rausgefunden hat noch schlimmer. Man muss sich echt fragen, wie weit die Polizei von Nazis durchseucht ist. Offensichtlich deckt man ja seine Kameraden. Eigentlich wäre das echt ein Fall für den Verfassungsschutz, in der Causa NSU haben sie sich allerdings mehr als Nazischutz erwiesen insofern ein schlechter Witz.
Selbst bei der CDU müsste man sich eigentlich mal langsam überlegen ob man nicht mal den Sauhaufen aufräumen möchte, bevor der Sauhaufen mit einem aufräumt.
Grenzgänger
@Imto > Wofür sind denn die ganzen Überwachungsgesetze gut?
Eine sehr berechtigte Frage! Immerhin ist der Staatstrojaner, also die TKÜ an der Quelle, ja in Hessen schon gesetzlich verankert. Trotzdem fördern die Ermittlungen nichts zu Tage. Irgendwie sind der Ruf nach Vorratsdatenspeicherung und TKÜ wohl nur Nebelkerzen. Erwiesenermassen bringen sie nichts und verhindern schon gar keine Verbrechen wie man sieht...
Timelot
Es wird langsam immer klarer das Putin die deutschen Faschisten unterstützt. Nicht nur mit Geld und Propaganda wie RT o.ä. sondern auch logistisch mit zb Yandex, Er will unbedingt die Ausbreitung Europas verhindern. Nicht umsonst haben sie auf der Reichstagstreppe auch "putin ! Putin ! " gerufen .