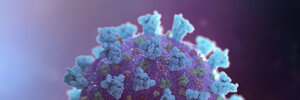Corona killt Café-Kultur: Innen maximal fünf Personen
Melanie Bremecker betreibt in Bremen das Café „Marianne“. Ende September ist Schluss: Die Pandemie hat sie in die Knie gezwungen.

Gemütlich heißt immer auch: Abstand halten fällt schwer Foto: Melanie Bremecker
BREMEN taz | Melanie Bremecker lächelt zwar, aber das ist ein trauriges Lächeln. „Es geht mir, ehrlich gesagt, so schlecht wie noch nie“, sagt sie. Die Gastronomin sitzt auf einem Kissen im Fenster ihres kleinen Cafés „Marianne“, versteckt in einer Seitenstraße des Bremer Viertels und schaut aus dem Fenster. Es ist ein heißer Sommertag. Sie trinkt Wasser mit Eiswürfeln und Zitrone. Draußen auf den bunten Stühlen an den bunten Tischen ist jeder Platz besetzt. Drinnen sitzt niemand. Auf einem Schild an der Tür steht, dass nur maximal fünf Personen gleichzeitig im Laden sein dürfen – wegen Corona.
Im Sommer 2011 beschlossen zwei Frauen, beide mit dem Namen Melanie, gemeinsam ein Café aufzumachen – Sie nannten es: Nein, nicht Melanie, sondern „Marianne“. Der 35-Quadratmeter-Laden, der früher einmal ein Friseurgeschäft gewesen war, an der Ecke Berliner Straße, etwas abseits vom Trubel im Steintor, wurde in liebevoller Handarbeit von den beiden Melanies umgebaut. Es gab Kuchen und selbstgebackene Waffeln, Kekse und Biobrot. Später kam dann das allseits beliebte Frühstück dazu. Auf einem Zettel konnte man mit einem Bleistift ankreuzen, was man auf seinem Frühstücksteller haben wollte: Von selbstgemachtem Aufstrich über Hummus bis Müsli war alles dabei. Die meiste Arbeit machten die Gastronominnen selbst. Es wurde gebacken, belegt, gemixt und gekocht. 2014 zog es Melanie Wernthal nach Berlin. Die andere, Melanie Bremecker, machte in Bremen weiter.
Wie die meisten Cafés im Viertel musste auch die „Marianne“ während des Lockdowns Anfang des Jahres schießen. Am 23. Mai gab es die Wiedereröffnung. Aber der Schein trügt: Der Laden hat nicht überlebt. „Am 23. September werde ich den Schlüssel abgeben“, sagt Bremecker. Die 44-Jährige schaut sich um. Es riecht nach frischen Waffeln und Kaffee. Eine junge Frau steht hinter dem Tresen und nimmt gelegentlich Bestellungen auf. „Wir haben damals, 2011, am 23. September aufgemacht. Jetzt machen wir neun Jahre später am selben Tag zu, das finde ich eine runde Sache“, sagt Bremecker. Eigentlich sei sie immer ein Stehaufmännchen gewesen. „Ich konnte immer aus Scheiße Gold machen.“ Jetzt hat die Pandemie sie in die Knie gezwungen.
„Sehr viele fühlen sich bedroht“, sagt Natalie Rübsteck, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Bremen (Dehoga). Bei einer Befragung hätten in Niedersachsen 65 Prozent der Befragten angegeben, dass sie sich aufgrund der Coronapandemie jetzt existenzielle Sogen machen würden, in Bremen seien es 63 Prozent. „Problematisch ist in Bremen vor allem der oft eingeschränkte Platzbereich“, sagt Rübsteck. Es gäbe viele Cafés mit kleiner Ladenfläche und wenigen Sitzplätzen. Häufig seien etwa 50 Prozent der Sitzplätze draußen.
In Bremen bringen die Pandemie-Maßnahmen laut Gaststättenverbands-Umfrage63 Prozent der Gastronomen in existenzielle Nöte
„Die Läden, die einen Außenbereich haben, die haben es meist noch ganz gut“, sagt sie. Angst hätten viele jetzt vor dem Herbst – wenn es kälter werde und die Außenplätze langsam wegfielen. „Wir arbeiten auf allen Ebenen daran, dass es da weitere Unterstützungen gibt“, sagt Rübsteck. „Aber eine Lösung gibt es da noch nicht.“ Das Wirtschaftsressort stehe im engen Kontakt mit der Dehoga, sagt auch Kai Stührenberg, Sprecher von Senatorin Kristina Vogt (Die Linke). „Wichtig ist, dass es nicht zu einem erneuten Lockdown kommt und wir alles tun, um eine Steigerung der Infektionen zu vermeiden.“
„Hier drinnen ist es jetzt einfach nicht mehr so gemütlich“, sagt Melanie Bremecker. Auf der Platte eines Tisches, an dem unter normalen Umständen etwa sechs Leute Platz gefunden hätten, stehen jetzt Stühle ineinander verkeilt – hier soll keiner mehr sitzen, aus Abstands- und Hygienegründen. In einer Ecke beim Fenster, neben dem Tresen, direkt hinter der großen Kaffeemaschine, wo es immer gemütliche zwei Plätze gab und einen kleinen Tisch, darf jetzt nur noch eine Person sitzen – „einladend“ ist anders.
5.000 Euro hat Melanie Bremecker beantragt, als es hieß, es gebe jetzt die sogenannte Corona-Soforthilfe in Bremen. Sieben Wochen hat es gedauert, bis sie Geld bekam. Sieben Wochen, in denen sie zum ersten Mal in ihrem Leben richtige Existenzangst hatte, wie sie sagt. Sieben Wochen, in denen sie nur mit Erspartem und Unterstützung durch ihren Vater über die Runden kam. Als das Corona-Geld dann endlich kam, waren ihr nur 2.300 Euro bewilligt worden. Mit Hilfe ihres Vaters legte sie Widerspruch ein. Es dauerte wieder Wochen. In einem Brief vom Amt erfuhr sie, dass gerade alles überlastet sei, sie müsse sich noch weiter gedulden.
Als sie ihren Laden im Mai dann wieder öffnen konnte, waren die Sorgen aber längst nicht passé. Ihr Umsatz sei, im Vergleich zum Vorjahr um diese Zeit, um etwa 50 Prozent eingebrochen. „Ich habe mir, als ich wieder geöffnet hatte, anfangs selber keinen Lohn gezahlt“, sagt Bremecker. Ihre Aushilfen habe sie entlassen müssen. „Ich stand von morgens bis abends alleine hier im Laden, weil ich es mir nicht leisten konnte, jemanden zu bezahlen“, sagt sie. Weil sie sich auch noch um ihre achtjährige Tochter kümmern musste, musste sie die Öffnungszeiten reduzieren. Ein Teufelskreis.
Wie es nun im September für Melanie Bremecker weitergeht, weiß sie noch nicht. „Ich würde mir wünschen, nach der ganzen Sache erst mal ein wenig Ruhe zu haben und mich um mich kümmern zu können“, sagt sie. Ihre Gesundheit habe stark gelitten. Ihr Rücken bereite ihr durchgehend Schmerzen. „Ich habe ein bisschen Angst, dass das Amt mir sagt, dass ich wieder in meinem alten Beruf arbeiten muss.“ Bremecker ist gelernte Erzieherin. Sie wünscht sich eigentlich, sich selbst aussuchen zu können, was sie als nächstes macht. Aber die Existenzangst wird ihr keine Verschnaufpause gönnen. „Ich habe Schulden, die werde ich nicht so schnell los“, sagt sie. Ihre positive Einstellung hat zwar einen Dämpfer bekommen, aber ganz verschwunden ist sie nicht: „Ich wäre gerne von alleine gegangen“, sagt Bremecker. „Aber es ist okay, dass jetzt etwas Neues kommt.“