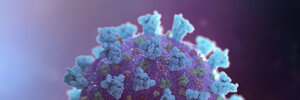Mit der Pandemie leben: Jugend in der Krise
Das Leben auf Abstand: hat die Coronakrise den Jugendlichen aufs Gemüt geschlagen? Vier Protokolle von jungen Menschen.

Eine bewegte Jugend eben Foto: dpa
„Lernen, mit der Belastung umzugehen“
Dank der Coronazeit fühle ich mich jetzt gut fürs Abi vorbereitet – weil wir lernen mussten, uns den Schulstoff selbstständig beizubringen. Aber das war nicht einfach. Dass es mir am Ende doch etwas nützen würde, hätte ich zu Beginn nicht gedacht. Als Mitte März die Schule plötzlich zumachte, waren ich und alle in meiner Klasse überfordert.
Der Unterricht fand über Zoom, App oder per Mail statt. Für manche Fächer funktionierte das super, etwa Spanisch oder Kunst. Bei anderen Fächern lief es nicht so gut. Insgesamt mussten wir so viele Hausaufgaben machen wie nie zuvor. Gleichzeitig hatten wir Angst um unsere Noten – und was das für unser Abitur bedeuten könnte.
Weil die Schulaufgaben kaum zu bewältigen waren, startete ich mit meinen Freundinnen zu Beginn der Quarantäne eine Onlinepetition. Unter dem Titel „Wir sind keine Roboter!“ sammelten wir 69 Unterschriften. Während dieser Zeit fand eine Lagebesprechung mit den Lehrern in der Schule statt, wo wir uns alle darüber austauschen konnten, wie es uns in der Coronazeit geht. Anschließend wurde die Belastung zwar nicht wirklich, wie angekündigt, weniger, aber wir lernten, besser damit umzugehen. Meine Freundinnen und ich starteten eine Lerngruppe: Ich half den anderen bei Mathe, dafür bekam ich Hilfe bei Deutsch und Geschichte. Mittlerweile lachen wir über unsere Petition.
Nicht jeder in meiner Klasse hat zu Hause ein eigenes Zimmer, das erschwert das Homeschooling. Auch ich teile mir ein Zimmer mit meinen Geschwistern. Mein Tagesablauf war auf einmal auf den Kopf gestellt. Normalerweise ging ich früh aus dem Haus, weil ich einen langen Schulweg aus Marzahn nach Neukölln habe. Nach der Schule war ich meistens verplant: Schwimmkurs, Badminton, Freunde treffen oder verschiedene Workshops – ich hatte eigentlich immer etwas vor.
Dass ich während der Coronazeit mehr Zeit mit meiner Familie verbringen konnte, war schön. Wir frühstückten immer gegen 8 oder 9 Uhr zusammen. Anschließend machte ich bis circa 15 Uhr meine Schulaufgaben auf meinem Bett. Nach dem gemeinsamen Mittagessen machte ich wieder bis 18 oder 19 Uhr Aufgaben für die Schule. Abends schauten wir öfter Filme oder spielten Karten. Außerdem half ich im Haushalt, beim Kochen und manchmal meinen Geschwistern bei ihren Onlineschulaufgaben.
Seit ein paar Wochen können wir endlich wieder in die Schule gehen, das freut mich. Nicht nur wegen des Unterrichts, sondern auch, weil ich meine Freunde wiedersehen kann. Zurzeit habe ich nach der Schule mehr Zeit für mich als vor der Coronazeit. Denn Sportkurse und Workshops sind abgesagt.
Ich würde gerne irgendwann mal als Kamerafrau und Künstlerin arbeiten. Denn während der Quarantäne habe ich manchmal den ein oder anderen kleinen Film geschnitten, das hat Spaß gemacht. Mein absoluter Traumberuf ist aber Astronautin. Das wollte ich früher schon werden, als ich noch in Afghanistan lebte. Wegen dem Gefühl: einfach weg von der Erde und allem zu sein! Die Welt von oben zu sehen – das muss toll sein.
Protokoll: Sophie Schmalz
„Engagement bringt immer was“
Ich habe gerade Abitur gemacht und wollte ein paar Monate auf Reisen gehen, meine Freunde in anderen Ländern besuchen, vor allem in Europa, aber auch in Südamerika und Asien. Daraus wird erst mal nichts wegen Corona. Ich kann mich aber noch nicht entscheiden, was ich studieren will, ich schwanke zwischen Neurowissenschaften und Jura. An Jura interessiert mich vor allem die Rote Hilfe, ich bin nämlich aktiv in einer linken Jugendgruppe.
Jetzt suche ich mir erst mal einen Nebenjob. Ich habe mir auch überlegt, ob ich eine Ausbildung zum Rettungssanitäter mache, die dauert drei Monate – um praktische Erfahrungen zu sammeln vor dem Studium. Und man kann ja auch noch andere Sachen probieren, vielleicht ein Praktikum bei einer Non-Profit-Organisation. Man muss halt flexibel sein.
Aber ich kenne auch viele Freunde, die einen Plan hatten für die nächste Zeit und sich jetzt sehr unsicher fühlen, weil das nicht mehr geht. Bei mir ist das nicht so, vielleicht weil ich erst 17 bin – ich habe noch genügend Zeit. Ich bin allerdings auch sehr privilegiert, kann mir Zeit nehmen mit allem, und ich weiß, dass ich von meiner Familie unterstützt werde. Überhaupt geht es uns ja weiterhin sehr gut in Deutschland, wir leben in einer sehr privilegierten Situation, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht.
Die Arbeit in der Jugendgruppe will ich auf jeden Fall weitermachen. Wir sind eine selbst organisierte linke Gruppe, machen Sachen gegen Gentrifizierung, gegen Klimawandel und Klassismus; wir organisieren Demos, Kundgebungen, machen Kiezradio, versuchen mehr SchülerInnen einzubeziehen.
Ich finde, unsere Generation ist schon sehr politisch. Auch durch Social Media findet ständig ein Austausch statt, man kann viele Leute erreichen. Ich glaube, Jugendliche haben eigentlich so viel Macht, auch durch SchülerInnenrechte, Schülerparlamente, aber das wird teilweise nicht ausgenutzt.
In unserer Jugendgruppe arbeiten wir teilweise auch mit Fridays for Future zusammen, Klimaschutz ist natürlich ein großes Thema unserer Generation. Gerade ist es leider durch Corona etwas untergegangen, obwohl die Bewegung ja weitermacht, es finden Aktionen statt, Kooperationen mit Ende Gelände, die Webinare. Wir sind ja die Generation, die in der Digitalisierung aufgewachsen ist. Dadurch kann der Austausch weiterhin stattfinden, nur eben online, es wird viel ausprobiert, unser soziales Netzwerk wird weiter ausgebaut. Aber das kann auch sehr anstrengend sein, weil einem ständig so viele Themen zufliegen, man lebt in einem ständigen Strom von Informationen.
Vielen, die ich kenne, macht das große Sorgen. All diese Probleme auf der Welt: Klimawandel, das Flüchtlingsthema, die Aufstände gerade in Amerika, Hanau, der Rechtsextremismus, die Polizeigewalt. Hilflosigkeit und Weltschmerz sind darum sicher auch zwei Gefühle, die in unserer Generation weit oben stehen. Ich glaube aber, Engagement bringt immer was, auch wenn es immer ein längerer Prozess ist. Man muss Stellung beziehen. Aber es ist krass zeitaufwendig, sich mit vielen Dingen zu beschäftigen.
Man könnte aus der Krise jetzt viel machen, sie hat vieles zutage gebracht, was schiefläuft und man ändern könnte – und müsste. Es ist eine spannende Zeit, zu sehen, wie die Politik jetzt handelt. Ob beim Gesundheitssystem oder beim Klima. Ich denke, wir leben schon in einer „besonderen“ Zeit – aber nicht im positiven Sinne. Viele Probleme, die es schon lange gibt – wie Rassismus oder soziale Ungleichheit – spitzen sich gerade immer mehr zu.
Protokoll: Susanne Memarnia
„Angst hatten wir nur manchmal“
Anfangs haben wir die Krankheit nicht so ernst genommen. Ich, Iremnur, hab das zum ersten Mal in den türkischen Nachrichten gesehen, dass es Corona gibt, als es in China losging. Wir haben beide nachgeguckt, was die Symptome sind, und zwischendurch dachten wir auch kurz, dass wir das haben. Unsere Eltern haben teilweise voll die Panik geschoben: Melis’ Baba ist komplett ausgeflippt und hat alles Mögliche eingekauft. Küchenrollen, Klopapier und Konserven mit Rotkohl und einen Fünfkilosack Bulgur. Meine Mutter hatte voll Coronapanik und sich ständig die Hände gewaschen und ganz viel Desinfektionsmittel gekauft.
Wir lesen beide keine Zeitungen, aber unsere Eltern gucken Nachrichten, auch türkische, und wir hören das ja dann mit. Und wir lesen viel über das Handy über Corona. So richtig ernst haben wir es erst genommen, als in der Märzwoche noch darüber gestritten wurde, ob jetzt die Schulen schließen sollen und Melis’ Mom gesagt hat, dass sie sie nicht hinschickt, wenn die Schulen nicht geschlossen werden.
Angst hatten wir nur manchmal. Mein Vater arbeitet im Krankenhaus und könnte sich anstecken. Etwas Angst hatte Melis auch am Anfang, dass ihr Vater seine Stelle verliert oder weniger arbeitet und kein Geld verdient. Unsere Eltern wurden auf Corona getestet, da hatten wir auch Angst um sie, aber der Test war zum Glück negativ, niemand in unserem direkten Umfeld hatte bis jetzt Corona.
In den letzten Wochen sind wir fast nie rausgegangen, Melis und ich haben jeden Tag stundenlang telefoniert. Wir haben uns über unsere Hausaufgaben unterhalten und uns gegenseitig aufgebaut. Ich habe mich in einem Unterrichtsfach sehr angestrengt, Melis ist meine Zeugin, ich musste so viel in dem Fach nachholen. Meine Schwester hat mir oft geholfen und mein Vater auch, in Mathe. Ich konnte zum Glück am Computer meiner Schwester arbeiten, den sie aber auch benutzen musste, weil sie ihre Masterarbeit schreibt. Melis hat ihre Aufgaben am Laptop ihrer Mutter gemacht und musste sich am Anfang noch einen Drucker mit Scanner kaufen, weil die Arbeitsblätter ausgedruckt werden mussten. Mein Lehrer hat zweimal in der Woche angerufen und hat immer alles erklärt und die Arbeitsblätter mit der Post nach Hause geschickt. Wir haben uns beide verbessert, weil wir die Aufgaben selber einplanen und in Ruhe machen können.
Uns fehlen die Freundinnen aus unseren Klassen, aber einige haben sich gar nicht mehr gemeldet, das sind wohl keine wahren Freunde. Bei mir zu Hause war es zwischendurch anstrengend, weil ich mir mit meinen Geschwistern ein Zimmer teile. Meine Mutter hat mir erlaubt, in ihr Zimmer zu gehen, wenn ich mal Ruhe brauche. Melis hat ihr eigenes Zimmer. In diesem Jahr fahren wir beide nicht in den Urlaub. Für Melis ist das trauriger, weil ihre Großeltern in der Türkei leben und sie sie nicht anstecken will und auch nicht angesteckt werden will.
Was uns fehlt? Freunde treffen und shoppen. Manchmal hatten wir Tage, wo wir ziemlich unmotiviert waren. Melis’ Mutter zwingt sie dann, wenigstens spazieren zu gehen, mir fehlt der Sport und das Schwimmengehen. Das Gute ist, das wir jetzt beide gelernt haben, wie man sich in einer Pandemie verhält, und falls mal irgendwann noch eine Pandemie auftaucht, sind wir vorbereitet. Was wir noch sagen wollten: Ich fand es gut, dass man keine unnötigen Sachen kauft und nur das, was man braucht. Aber für viele alte und einsame Menschen war das bestimmt eine nicht so schöne Zeit, weil sie ihre Kinder oder Enkel nicht sehen konnten.
„Mit Erspartem über Wasser halten“
Mit dem Lockdown veränderte sich nichts an meinem Berufsalltag. Genau das war mein Problem. Als freier Journalist arbeite ich seit Jahren im Homeoffice. Wobei Office ein Euphemismus ist. Oft ist mein Arbeitsplatz bloß das Bett, nur für Interviews setze ich mich an meinen kleinen Schreibtisch.
Schon vor Corona wusste ich: Ich will da raus. Ein Praktikum sollte endlich Veränderung bringen. Morgens das Haus verlassen, einen eigenen Platz in der Redaktion haben, mit Kolleg*innen über das Kantinenessen lästern. Doch noch bevor ich das Praktikum beginnen konnte, kamen die Ausgangsbeschränkungen. Und ich saß noch immer allein in meinem WG-Zimmer.
Neu war, dass mein Terminkalender täglich leerer wurde. Freiberufliche Aufträge hatte ich vorausschauend abgelehnt. Ich wollte ja bereit sein für den neuen Arbeitsalltag in der Redaktion. Stattdessen drehte sich nun alles um die erzwungene Häuslichkeit. Was sollte ich nun tun mit dieser unfreiwillig gewonnen Zeit? Ich entschied mich für etwas, wozu ich im Homeoffice nie kam: rausgehen und lesen. Ein ambitioniert hoher Bücherstapel war schnell bestellt, eine sonnige Treppe am Landwehrkanal rasch gefunden.
In den folgenden Lockdown-Wochen haben ich dann so viel gelesen wie wohl noch nie in meinem Leben. Sogar zu meinen älteren ungelesenen Büchern bin ich endlich gekommen: Ein halbes Jahr stand Deniz Yücels „Agentterrorist“ in meinem Regal, gelesen habe ich es letztendlich an einem Tag. In den Werken des Kulturtheoretikers Mark Fisher bin ich wiederum jede Zeile so sorgfältig durchgegangen, dass ich oft nur wenige Seiten geschafft habe.
Insgesamt habe ich zwei Textmarker und unzählige bunte Klebezettel während des Lockdowns verbraucht. Und wenn ich vom Lesen mal genug hatte, konnte ich meinen Blick über den Kanal schweifen lassen und die Reiher bei ihrer Jagd beobachten.
Kein Frage, so idyllisch waren die Wochen vor allem auch deshalb, weil ich in einer entspannten Situation war. Ein befreundeter Veranstaltungstechniker erzählte mir am Telefon, er hätte alle Aufträge für die Festivalsaison verloren. Auch erreichte mich die Nachricht, dass der Opa einer Freundin an Corona gestorben war. Das waren alles Schicksalsschläge und Sorgen, die ich mir zum Glück nicht machen musste. In meiner Familie waren alle gesund, und mein Erspartes konnte mich im Lockdown über Wasser halten. Als ich nach zwei Monaten dann die E-Mail bekam, dass ich mein Praktikum endlich beginnen kann, war ich fast ein bisschen enttäuscht. Ausgerechnet Corona hatte mir einen Frühling beschert, in dem ich so viel draußen war wie nie.
Jannis Hartmann