Vermeintliches Wissen in der Coronakrise: Im Land der Missverständnisse
Warum wir aneinander vorbeireden, wenn es um Gesundheitswissen geht. Und was uns davon abhält, Fakten korrekt zu erinnern oder wiederzugeben.

Die unterschiedlichen Einschätzungen der WissenschaftlerInnen zu Corona verunsichert Viele Foto: Paulus Rusyanto,EyeEm/getty images
Das persönliche Gespräch in der Familie, zwischen Bekannten oder in der Nachbarschaft kann derzeit unangenehm werden, wenn es um Corona geht. Und das tut es ja ständig. Hie und da kommt es beim Plausch am Gartenzaun zum Eklat, weil man sich nicht mehr auf die grundlegende Faktenlage einigen kann. Ist der Nachbar also ein Verschwörungstheoretiker?
Vielleicht. Aber nicht unbedingt. Alltagsgespräche sind urplötzlich hochkomplex und fachlich geworden. Wir, die Menschen ohne Habilitation in Virologie, versuchen uns einen Reim drauf zu machen. Und scheitern. Garantiert. Wer etwas anderes behauptet, ist ein Opfer des Dunning-Kruger-Effekts. Der besagt, dass man immer dann glaubt, alles kapiert zu haben, wenn man keine Ahnung hat.
Heißt also: Dieser Tagen verstehen wir permanent irgendetwas falsch, erinnern Fakten nicht korrekt oder reden aneinander vorbei. Und trotzdem müssen wir klarkommen mit der Sachlage. Wahrscheinlich hilft es, sich dabei einiger unserer menschlichen Angewohnheiten in Sachen Gesundheitswissen bewusst zu werden.
Das „Schad’ ja nix“-Wissen
Dolores Albarracin beforscht seit Jahren den öffentlichen Diskurs über Gesundheitsthemen. Die Psychologieprofessorin an der University of Illinois hat Debatten über HIV verfolgt, das Wissen der Bevölkerung über Zika ausgewertet und zuletzt Umfragen über Sars-CoV-2 durchgeführt. Albarracin befürchtet, dass viele gerade schlechter informiert sind als gewöhnlich, obwohl die meisten sich viel mehr informieren. „Wir befinden uns in einer globalen Krise“, sagt Albarracin, „was bedeutet, dass jede Falschinformation wesentlich größere Auswirkungen haben kann als normalerweise“.
Albarracin nennt ein simples Beispiel: unser Wissen über die Wirkung von Vitamin C. Hilft zusätzlich eingenommenes Vitamin C bei gewöhnlichen Erkältungen oder kann es sie sogar verhindern? Na klar, oder? Tatsächlich ist eine solche Wirkung nicht nachgewiesen. Die letzte klinische Metastudie dazu kam von der Gesundheitsorganisation Cochrane Collaboration im Jahr 2013 und ergab: Der Effekt von Vitamin-C-Ergänzungsmitteln ist insignifikant, also vernachlässigbar. Außer für Menschen, die unter Extrembedingungen leben und arbeiten, sei es überflüssig, Vitamin C zu nehmen. Das weiß nur so gut wie niemand.
„Die größte Gefahr für eine konstruktive Debatte über Gesundheitsfragen ist es, wenn Fakten und Wertvorstellungen verschmelzen“
Wieso? Dolores Albarracin glaubt, dass wir unser Wissen nicht auf den neusten Stand bringen, wenn es nicht dringend notwendig ist. „Wenn Menschen bei einer gewöhnlichen Erkältung Vitamin C nehmen, ist das harmlos. Es schadet ja nicht.“ Deshalb hätten sich auch die Behörden nie besonders um Aufklärung über dieses Thema gekümmert. Jetzt, wo es das Coronavirus gibt, ist dieses falsche Wissen aber plötzlich gefährlich. „Wenn Menschen jetzt ihre Vitamin-C-Pillen schlucken und dann arglos nach draußen gehen, ist das ein Problem.“
Wir neigen also dazu, unser Wissen nur bei dringendem Bedarf kritisch zu prüfen. Das heißt nicht, dass wir alles glauben, was uns nützt, aber zumindest geben wir nicht besonders acht, solange wir als Folge der Ignoranz keinen unmittelbaren Schaden befürchten. Und so hoffen viele von uns weiter, dass Vitamin C sie unbeschadet durch die Krise bringen wird, obwohl es wahrscheinlich noch nicht mal den letzten Schnupfen kuriert hat.
Fliegende Schnecken
Aber was heißt schon „Wirkung nicht nachgewiesen“? Nur weil es der Wissenschaft bisher nicht gelungen ist, sie nachzuweisen, heißt das ja nicht, dass es sie nicht gibt, oder?
Eigentlich korrekt. Aber da sind wir gleich beim nächsten Problem: dass wir die Sprache der Forschung missverstehen. Naturwissenschaften sind evidenzbasiert, das heißt, sie können nur beweisen, was da ist, und niemals das, was nicht da ist. Es gibt zwar keine fliegenden Schnecken, aber die evidenzbasierte Wissenschaft kann streng genommen nicht beweisen, dass es keine fliegenden Schnecken gibt. Sie kann nur mit großer Sicherheit sagen, dass die bisherigen Untersuchungen keine fliegende Schneckenart nachweisen konnten.
Dass Wissenschaft so vorsichtig formuliert, ist oft Argument genug für diejenigen, die Studienergebnisse zugunsten überzeugungsbasierten Wissens beiseiteschieben: Vitamin C hilft bestimmt, nehmen wir in der Familie seit Generationen und waren nie schlimm krank. Hier kommt ein weiteres Problem unseres Denkens hinzu: der „Confirmation Bias“: Wir neigen dazu, selektiv Belege und Bestätigungen für unsere Überzeugungen zu suchen. Die evidenzbasierte Wissenschaft arbeitet – idealerweise – genau andersherum. Sie falsifiziert, bis ein Fakt übrig bleibt.
Eindeutigkeitssucht
Verständlich, dass man sich gerade in Gesundheitsfragen sicher sein will. Und so könnte man derzeit täglich aus der Haut fahren, wenn man den Fernseher oder das Handy auf der Suche nach eindeutigen Ansagen einschaltet und sich dann dieses vorsichtige Geschwurbel der Drostens dieser Welt anhören muss. Obendrein widersprechen sich diese Herren und Damen dann auch noch permanent. Heinsberg-Studie ja, Heinsberg-Studie nein. Was denn nun? Kein Wunder also, wenn unsere Bekannten am Gartenzaun behaupten, die seien alle inkompetent. Womit wir beim nächsten Problem sind: Wir verstehen den wissenschaftlichen Prozess nicht richtig.
Die Wissenschaft ist eine intersubjektive Diskursgemeinschaft. Heißt kurz und knapp: Was eine*r sagt und sieht, gilt gar nichts, solange es nicht auch andere unter denselben Bedingungen gesagt und gesehen haben. Heißt also: Ein Forschungsergebnis ist keines, solange es nicht von einem unbeteiligten Institut nachgeprüft ist. Die Heinsberg-Studie, die Erhebung der Zahl von Coronavirus-Infektionen und deren Verläufen im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen sorgte Mitte April genau damit für Verwirrung. Die Bonner Uniklinik hatte die Studie veröffentlicht, ehe sie dieses Prüfverfahren, genannt Peer Review, durchlaufen hatte – was andere prompt bemängelten.
Uns, der Öffentlichkeit, stellt sich das wie folgt dar: Anerkannte Forscher*innen liefern endlich Ergebnisse, und kleinliche Gartenzwerge kritteln dran rum. Und für so was haben wir doch keine Zeit, oder? Wir brauchen Zahlen! Nun ja, aber wenn sie nicht intersubjektiv geprüft sind, sind es eben keine. Kleinlich? Nein, ziemlich sinnvoll, weil das System anerkennt, dass selbst die klügsten Akademiker*innen angesichts der schieren Fülle möglicher empirischer Daten den Überblick verlieren. Dass sie kaum alle möglichen Störfaktoren mitdenken können. Außerdem sind Menschen fehlbar und lassen sich von Interessen leiten – nicht mal unbedingt von Geld und Ruhm, sondern einfach von dem Ehrgeiz, etwas Tolles herauszufinden. Was wir für unangemessenes Gerangel halten, ist der stinknormale wissenschaftliche Prozess. Nur wird der sonst nicht vor aller Augen ausgetragen.
Die „Er sagt, sie sagt“-Falle
Nur weil es diesen Prozess gibt, wissen wir, dass Spinat gar keinen außergewöhnlich hohen Eisengehalt hat und dass Impfungen nicht mit Autismus korrelieren. Hatten beides mal studierte Leute in Studien „herausgefunden“. Die Überprüfungen ergaben aber: Blödsinn. In der Studie über Spinat fand man einen Messfehler und die Ergebnisse der Studie über Impffolgen konnten nicht reproduziert werden. Damit gilt das als nicht nachgewiesen. Reicht Ihnen nicht? Fliegende Schnecken.
Dass dieses Gerangel um Ergebnisse ein produktives ist, gerät in den Hintergrund, weil wir – nächstes Problem – Wissen gern binär betrachten: Er sagt, sie sagt. Wenn der eine falsch liegt, muss die andere recht haben und umgekehrt. Das Journalist*innen obendrein gern alles auf einen Konflikt zwischen genau zwei Parteien hin zuspitzen, hilft auch nicht.
Denn es gibt weitere Möglichkeiten: Beide haben unrecht. Oder: Beide haben recht, aber jeweils auf ihre Weise. Oder: Beide haben völlig unterschiedliche Fragen gestellt. Siehe die Debatte über die Masken. Da wurde über die Frage „Wirken Masken?“ diskutiert, aber es wurde stets das „Wofür“ unterschlagen. Als was wirken sie? Als Ersatz für Abstandsregeln, Kontakteinschränkungen und Händewaschen? Nein. Als zusätzliche Sicherheit, sofern man das Ding richtig trägt und es wäscht? Gewiss.
Fatal wird es, sagt Dolores Albarracin, wenn der produktive wissenschaftliche Prozess zum politischen Konflikt wird. „Die größte Gefahr für eine konstruktive Debatte über Gesundheitsfragen ist, wenn Fakten und Wertvorstellungen verschmelzen.“ Albarracin hat in Umfragen in den USA Folgendes erhoben: Ob Menschen eher andere „Fakten“ für wahr halten oder nicht, hängt stark davon ab, welche Medien sie konsumieren, sprich: welchem politischen Lager sie anhängen.
Wir sind also Wesen mit verzerrtem Zugang zum Wissen: Wir denken allzu gern binär, wir beharren auf anekdotischer Evidenz, und wir fühlen uns obendrein auf solchen Gebieten besonders gut bewandert, wo wir keine Ahnung haben. In einer idealen wissenschaftlichen Welt würden wir also alle so lange die Klappe halten, bis wir unsere Aussagen gefactcheckt und gepeer-reviewt haben. Aber so sind wir nicht.
Was also tun? Nach-denken. Nachsicht haben. Nicht jede*r, der am Altglascontainer Fake News herumtrötet, marschiert gleich auf die nächste Verschwörerdemo. Selber fragen: Weiß ich das? Woher? Besser schau ich noch mal nach. Und: Öfter mal was nicht wissen. In dieser gegenwärtigen Situation sind wir damit in verdammt guter Gesellschaft.
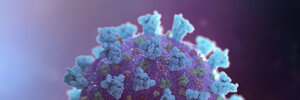









Leser*innenkommentare
02242 (Profil gelöscht)
Gast
Viele Meinungen und große Verwirrung.
Weber
An dieser Stelle möchte ich noch ein hervorragendes und sehr gut geschriebenes Buch empfehlen:
Jonathan Haidt: "The Righteous Mind. Why Good People are Divided by Politics and Religion." Auch im Netz verfügbar.
"Morality binds and blinds. This is not just something that happens to people on the other side. We
all get sucked into tribal moral communities. We circle around sacred values and then share post hoc
arguments about why we are so right and they are so wrong. We think the other side is blind to truth,
reason, science, and common sense, but in fact everyone goes blind when talking about their sacred
objects.
If you want to understand another group, follow the sacredness. As a first step, think about the six
moral foundations, and try to figure out which one or two are carrying the most weight in a particular
controversy. And if you really want to open your mind, open your heart first. If you can have at least
one friendly interaction with a member of the “'other' group, you’ll find it far easier to listen to what
they’re saying, and maybe even see a controversial issue in a new light. You may not agree, but you’ll
probably shift from Manichaean disagreement to a more respectful and constructive yin-yang
disagreement."
4813 (Profil gelöscht)
Gast
@Weber Ach naja, Blödsinn ist unendlich. Tiefsinn begrenzt.
Christina de Havilland
@Weber Vielen Dank für den wertvollen Beitrag!
Martha Yuval
Insgesamt ein wichtiger Artikel, hab mich gefreut. Allerdings hab ich mich etwas an diesem Dunning-Kruger Effekt gestoßen, der gleich anfangs als psychologisch anerkanntes Phänomen zitiert wird; das fand ich etwas befremdlich. Und tatsächlich, nach kurzer Recherche festgestellt, dass Dunning und Krüger im Jahr 2000 dafür den Ig-Nobelpreis bekommen haben, der ja für Forschungen verliehen wird, die (..)
wohl nie in die Annalen der Menschheit eingehen werden - und das auch besser nicht sollten. [improbable.com- Der Ig-Nobel-Preis - Improbable Research](..). Der Ig-Nobelpreis ist ja so eine Art Anti-Nobelpreis. Solche, eher fragwürdigen Erkenntnisse einleitend einem Artikel voran zu stellen, in dem es genau um Prinzipien der Wissenschaft geht ist, ja, seltsam. Weil genau in diesem Fall ja von der wissenschaftlichen community festgestellt wurde, dass dieser Dunning-Kruger Effekt eben nicht wissenschaftlichem Standards entspricht..
Weidle Stefan
Also 1916 waren sich führende Chemiker durchaus einig, dass Kampfgase einen positiven Beitrag zur Beendigung des Grabenkrieges leisten kann. In den 1920/30er Jahren waren gar nicht einmal so wenige Wissenschaftler davon überzeugt, dass die Rassenlehre eine ernstzunehmende Forschungsrichtung ist, selbstverständlich im Einklang mit den Obrigkeiten. Gut das die Menschen damals nicht aufbegehrt haben, wären ja sonst ahnungslose Verschwörungstheoretiker gewesen. Und der Taz liebstes Kind, der Neoliberalismus? Führende Wirtschaftswissenschaftler weisen mit für uns alle bei weitem viel zu komplexen Analysen nach, dass es keine Alternativen dazu gibt und Politik hält sich daran. Also sollten wir auch in der Sache schweigen, sonst sind das alles Aluhüte, oder?
Rudolf Fissner
@Weidle Stefan Oder der Kommunismus. Selbst nachdem Stalin Millionen im Gulag, Holodomor u.a. hat verschwinden oder verrecken lassen werden dessen Gegner immer noch als Kommunistenfresser verunglimpft.
BluesBrothers
@Rudolf Fissner Oh mei. Als ob andere Gesellschaftsformen nicht auch ihre Verbrechen hätten. Kommunistenfresser ist nun natürlich in einer Diskussion nicht angebracht, sich gegen Kritik an der eigenen Kritik aber mit dem Verweis auf Gulags zu verwehren ist meist (kontextabhängig) aber auch keine feine (bzw. konstruktive) Art.
Rudolf Fissner
@BluesBrothers Eine Ergänzung von Beispielen, wo Menschen üble Fakten verdrängen, ist sicher keine Kritik an den bereits genannten Beispielen. Nicht konstruktiv ist es politische Vorgaben zu machen bei der Nennung von Beispielen.
Abreger
Danke für die Klarstellung(en).
Das Beispiel mit der Frage "wirken Masken?" ist angesichts der wirren Diskussion der vergangenen Wochen sehr gut gewählt.
Vielleicht könnte die taz dies ja auch mal zum Anlass nehmen, im Zusammenhang mit der Corona-Krise die inflationäre Nutzung der Worte "Tatsache", "Fakt" und "Wahrheit" zu reflektieren, diese nur noch benutzen, wo dies auch zu >99% zutrifft. Auch wenn einige Autorenmeinungen dadurch etwas an verbaler Überzeugungskraft verlieren könnten, so ist es dennoch deutlich ehrlicher.
76530 (Profil gelöscht)
Gast
Apropos Missverständnisse: wann ist nochmal die nächste Wahl zur Miss Verständnis?
Emmo
@76530 (Profil gelöscht) Ach - ich dachte, es geht hier um eine Unterart des Kopflaus-Nachwuchses namens "Missverständ" ;-)
76530 (Profil gelöscht)
Gast
@Emmo Es würde mich sehr beruhigen, von Ihnen zu lesen, das Verständnis Ihres Posts erfordere gewisse regionale Kenntnisse.
Falls dies nicht der Fall sein sollte, würde ich mich gerne für den Rest des Tages für die Abt. Schlauch-Stehen abmelden. :-)
Emmo
@76530 (Profil gelöscht) Hmm, ob es regionale Kenntnisse sind, weiss ich nicht - aber um das Rätsel aufzulösen: Eihülle der Laus = Nisse ;-)
de.wikipedia.org/wiki/Kopflaus
Das weiss ich aber auch nur, weils in meiner Kindheit an meiner Grundschule eine Kopflaus-"Seuche" gab. Um es mit Ringelnatz auszdrücken:
Wo man hobelt, fallen Späne.
Leichen schwimmen in der Seine.
An dem Unterleib der Kähne
Sammelt sich ein zäher Dreck.
An die Strähnen von den Mähnen
Von den Löwen und Hyänen
Klammert sich viel Ungeziefer.
Im Gefieder von den Hähnen
Nisten Läuse, auch bei Schwänen.
(Menschen gar nicht zu erwähnen,
Denn bei ihnen geht’s viel tiefer.)
Nicht umsonst gibt’s Quarantäne.
Allen graust es, wenn ich gähne.
Ewig rein bleibt nur die Träne
Und das Wasser der Fontäne.
Kinder putzt euch eure Zähne!!
76530 (Profil gelöscht)
Gast
@Emmo Ach!
Offenkundig befinden wir uns hier an einem Ort der Ringelnatz-Retro.
Weber
Sehr guter Artikel!
Immerhin können wir festhalten, daß über die 'Faktenlage' gestritten wird, und nicht über die Interpretation von Bibelstellen - zumindest hierzulande. Es gibt Fortschritte.
"Was also tun? Nach-denken. Nachsicht haben. (...)Selber fragen: Weiß ich das? Woher? Besser schau ich noch mal nach. Und: Öfter mal was nicht wissen."
Das sind gute Ratschläge. Ausdrücklich könnte man noch hinzufügen: 'Zuhören'. Und ausdrücklich abraten müßte man im Falle sehr kontroverser Gespräche von: 'Fakten ins Feld führen'.
So zumindest der (kontraintuitve) Rat von Peter Boghossian & James Lindsay: How to Have Impossible Conversations. A very practical guide."
Jetzt auch auf Deutsch:
"Die Kunst, schwierige Gespräche zu meistern: Effektiv argumentieren, hitzige Diskussionen entschärfen und Gesprächspartner überzeugen."
mowgli
Guter Artikel, danke.
Nur eine Anmerkung dazu: Dolores Albarracin „glaubt, dass wir unser Wissen nicht auf den neusten Stand bringen, wenn es nicht dringend notwendig ist“. Wissen könnte sie, dass Vitamin C ziemlich aggressiv beworben wird im Fernsehen und anderswo.
So bald die Tage kürzer werden, geht es los mit der verstärkten Vitamin-C-Bombardierung. Dass Vitamin C die Wunderwaffe gegen Erkältung und überhaupt gut fürs Immunsystem ist, bekommt der Fernsehzuschauer jeden Abend dreimal suggeriert. Welche Ergebnisse eine Metastudie von 2013 zum Thema hatte, hat er mit sehr viel Glück ein- oder zweimal gehört oder gelesen. Nein, nicht pro Tag. Seit 2013.
Unter Normalbedingungen können die Behörden sagen: „Schadet ja nicht.“ In Coronazeiten ist das nicht so einfach. Aber was kümmert das die Politiker? Ich sage nur: Dunning-Kruger-Effekt. Und überhaupt: Sind nicht auch Politiker Menschen und also geneigt, ihr „Wissen nur bei dringendem Bedarf kritisch zu prüfen“?
Martha Yuval
@mowgli hier ein Zitat aus einem Artikel aus der Zeit über dan Dunning-Kruger-Effekt: (..)
Der Dunning-Kruger-Effekt taucht in der Fachliteratur bisher kaum auf. Dafür umso mehr in populärwissenschaftlichen Texten sowie auf Blogs und anderen Internetseiten. Im Jahr 2000 gewann das Phänomen den satirischen „Ig-Nobelpreis“ im Bereich Psychologie. Allzu ernst nehmen sich die beiden Autoren der Studie auch selbst nicht. Bereits auf der ersten Seite ihrer Publikation heißt es: Die unbewusste Inkompetenz zeigt sich auf vielen Gebieten, darunter Teamführung, Kindererziehung und das Durchführen einer fragwürdigen psychologischen Studie.
Martha Yuval
@mowgli ..der Dunning-Kruger Effekt , siehe oben, wurde 2000 mit dem Ig-Nobelpreis ausgezeichnet (s.o.) weil er, ja, eher Quatsch ist.. Also die Erkenntnis, dass dumme Leute ihre Dummheit nicht erkennen, weil sie eben dumm sind ist, ja, schon, gelinde gesagt, sehr schlicht..
BlackHeroe
Die Moderation: Dieser Beitrag wurde versteckt.
Stephan Herrmann
JA!
Und die Kernaussagen sind noch nicht mal auf Gesundheitswissen oder gar Corona beschränkt.
Sonntagssegler
@Stephan Herrmann Überhaupt nicht.
Wobei man in dem Artikel eventuell noch hätte erwähnen können, dass diese Effekte evolutionsbiologisch auch Vorteile haben.
Sie ermöglichen es, Aufgaben anzugehen, bei denen wir uns eigenlitch (noch) nicht genau auskennen.
Andernfalls gäbe es pro Gruppe immer nur einen Jäger und keinen Nachwuchs der das schon mal trainiert.
Natürlich habe ich von Evolutionsbiologie eigentlich gar keine Ahnung, aber wie wissen ja jetzt, dass das auch völlig unnötig ist, um eine festgefügte Meinung zu haben. :-)
Rainer B.
Das größte Missverständnis liegt doch bereits in dem Wort „Wissenschaft“ selbst. Wissenschaft weiß nämlich im Grunde gar nichts. Wenn Wissenschaft wissend wäre, bräuchte man sie nicht. Wissenschaft arbeitet „nur“ mit Hypothesen, mit Erklärungsmodellen. Dasjenige Erklärungsmodell, welches im Versuch jederzeit nachprüfbar das vorhergesagte Ergebnis liefern kann, wird solange als richtig angesehen, bis es entweder ein noch bessereres Erklärungsmodell gibt, oder widerlegt werden konnte. Mehr ist es nicht.
Dazu kommt noch, dass Wissenschaft heute ein hochgradig arbeitsteiliger Prozess geworden ist. Der einzelne Wissenschaftler kann die Hypothesen seiner Kollegen gewöhnlich nur noch dann überprüfen, wenn er selbst auch über ein vergleichbares Instrumentarium verfügt. So wird Wissenschaft leider zunehmend mehr abhängig von ihren eigenen Messeinrichtungen und Arbeitsmethoden, was neben der stetig zunehmenden Komplexität vor allem auch eine fortschreitende Intransparenz für die Bevölkerung zur Folge hat.
BluesBrothers
@Rainer B. Schon richtig, aber Ihr "Mehr ist es nicht" doch etwas überkritisch.
Ja die Gravitation ist nur eine These, aber ich denke, die wenigsten haben bei dem Schritt vor die Haustüre tatsächlich Angst wegzufliegen. Letztlich weiß der Mensch nur sicher, dass er nichts weiß und damit ist die von Ihnen getroffene Unterscheidung doch beinahe schon hinfällig?
Rainer B.
@BluesBrothers Na ja - die Gravitation ist schon eine für Jedermann recht gut nachvollziehbare These, aber man muss sie im Grunde auch gar nicht kennen, um trotzdem ohne Angst wegzufliegen, noch raus zu gehen. (;-))
siri nihil
@Rainer B. Ich habe vor einiger Zeit aufgehört, an die Gravitation zu glauben! Dass mein Tablet ständig herunterfällt, lässt sich mit dem microchip in den globuli erklären, die ich meiner Katze gebe. Das auszuführen würde jetzt zu weit führen, aber ich kann verraten, dass es mit der Sterblichkeit von Handwerkern zu tun hat, die tragen während der Arbeitszeit mundschutz, die sterben zu Tausenden im geheimen am Kohlendioxid, was sie wieder einatmen, das wird geheim gehalten, aber habt ihr euch nicht schon mal gefragt, warum die Handwerker immer sagen, wie kommen morgen und dann dauert es drei Wochen? Das ist ein ganz großes Ding, wahrscheinlich sind es klone und es dauert drei Wochen für die Produktion! Nicht einmal kenfm berichtet darüber!!11! 😋
Rainer B.
@siri nihil Ich sach's mal so: Sie werden sich die Welt auch ganz gut ohne Gravitation erklären können, aber was, wenn Ihre Kinder Sie danach gar nicht mehr ernst nehmen können? (;-))
05838 (Profil gelöscht)
Gast
Fakten sind Informationen aus erster Hand.
Rainer B.
@05838 (Profil gelöscht) Viele Fakes doch auch. Das mit der Information aus „erster Hand“ macht noch nicht den Unterschied.
Hartz
Gerade Fakten gibt es nicht, nur Interpretationen (Nietzsche). Das war seine große Entdeckung.
Nur ein Beispiel: Es wurde auch mal "wissenschaftlich" postuliert, mit preiswertem Atomstrom (kostet fast nix!) könne man sämtliche Energieprobleme der Welt lösen...
Und erst waren die Masken verpönt, jetzt aber... Von den gleichen Wissenschaftlern.
BluesBrothers
@Hartz Hm sollte es mal zu einem Reaktor kommen, der die physikalischen Abläufe der Sonne nachstellen kann, würde es aber (wieder?) richtig werden. Auch wenn es nur eine Interpretation ist, der Umstand diesen Kommentar geschrieben zu haben, ist für mich ein Fakt, den Sie wohl teilen werden.
tomás zerolo
Danke. Das war nötig. Wir sollten tatsächlich mehr Gefühl dafür bekommen, wie Wissenschaft "funktioniert".
Meines Erachtens versäumen Schulen hier sehr viel.
Anekdote: die Nummer mit dem Vitamin C stammt von Linus Pauling [1], Nobelpreis in Chemie und ist von... 1941. Mein Vater, selbst Arzt, hat fest daran geglaubt, und ich habe es geerbt, bis ich mich irgendwann davon gelöst habe.
[1] en.wikipedia.org/w...vitamin_C_advocacy
peppolata
der erste vernünftige Artikel über den praktischen Umgang mit dem C-Komplex. Das tut gut: Kein Kriegsgeschrei, keine Beschimpfung und Schuldzuweisung.
Sonntagssegler
@peppolata Dabei ist die "Schuld" im Falle des C-Komplexes meines (Halb-) Wissens nach sogar recht genau zuweisbar.
Der Nobelpreisträger Linus Pauli, dem wir Einiges zu den Elektronenringen verdanken, war im Alter ein fanatischer Vitamin-C-Anhänger.
Er hat seinen Einfluss genutzt, um Vitamin-C öffentlich als Wundermittel zu bewerben. Er hat sogar seine krebskranke Frau damit behandelt, was - wenig überraschend - nichts gebracht hatte.
Das ist neben der persönlichen Tragik auch ein gutes Beispiel für den Confirmation Bias, bzw. das ein Nobelpreis nicht dafür schützt, auf anderen Gebieten kompletten Nonsense zu verbreiten.
Poseidon
Sicher ist es wichtig die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse bei Entscheidungen zu berücksichtigen.
Genauso wichtig ist es die Tatsache zu berücksichtigen dass es immer wieder vorkommt dass solche Erkenntnisse sich im nachhinein als Falsch erweisen.
Wenda-Linus
Vielen Dank für diesen klasse Artikel!