HIV damals und Corona heute: Das Virus der Anderen
Bei Corona hegte man nur kurz die Illusion, mit dem Virus nichts zu tun zu haben. Bei HIV vergingen Jahre, bis Politik und Gesellschaft reagierten.

Gedenken an Aids-Tote im Central Park in New York, 1988 Foto: Wilbur Funches/dpa
Schockierende Bilder aus New York gingen in den letzten Tagen um die Welt. Holzsärge, die in einem riesigen Massengrab auf einer Insel vor New York gestapelt wurden. Hart Island, die ehemalige Gefängnisinsel. Menschen, die die Aidskrise über- oder erlebt haben, haben meist schon einmal von diesem Ort gehört: In den 1980er Jahren hat die Stadt New York dort neben Armen, Obdach- und Namenlosen ihre Aidstoten beerdigt. Zu Beginn sogar in Einzel- statt in den üblichen Massengräbern, weil man Angst hatte, dass die Seuche sonst auf die anderen Leichen (!) übergreifen würde.
New York, so viele Tote. Das ist auch in anderer Hinsicht ein Déjà-vu: Schon einmal wurden die USA von einem Präsidenten gelenkt, der die Bedrohung durch ein neuartiges Virus viel zu lange und mit tödlichen Folgen ignorierte – im Fall von Aids auch, weil es zunächst vordergründig „die Richtigen“ traf, also Homosexuelle, Prostituierte, DrogenkonsumentInnen. Ronald Reagan nahm das Wort Aids erstmals 1985 in den Mund und auch nur, weil es nicht mehr anders ging.
Sein ehemaliger Schauspielkollege und Hollywood-Star Rock Hudson war an den Folgen der Immunschwächekrankheit gestorben. Gleichzeitig hatte er sich als Homosexueller geoutet: Anders als Corona war Aids von Beginn an mit Sexualität und moralisch abweichendem Verhalten assoziiert.
Auch in Deutschland fühlen sich nun insbesondere Ältere an längst vergangen geglaubte Zeiten erinnert: Der Kontakt mit anderen Menschen wird zur Gefahr – und Sexualität ist nur noch in monogamer Partnerschaft beziehungsweise unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern möglich, also gar nicht. Als Aids aufkam, lange vor dem Internet, wurde Telefonsex populär. Denn so war garantiert, dass man „es sich nicht holt“. Aber was eigentlich?
Am Anfang der Epidemie war Aids nur ein „Schreck von drüben“, wie der Spiegel im Mai des Jahres 1982 schrieb. In New York, Los Angeles und San Francisco litten plötzlich junge schwule Männer zwischen 25 und 30 Jahren unter Kaposisarkomen, einer seltenen Krebsart, begleitet von schweren Infektionskrankheiten, Lungenentzündungen.
Bald schon stellte man fest, dass durchaus auch heterosexuelle Männer und Frauen betroffen waren, Bluter, Drogenabhängige – und ein Begriff für die Bedrohung wurde gefunden, nicht mehr „Gay Related Disease“ (GRID), sondern „Acquired Immune Deficiency Syndrome“ (AIDS).
Der Atlantik war nicht breit genug
Man wusste aber nicht genau, was der Auslöser war: Hatte es mit dem Gebrauch von Poppers zu tun? Lag es am exzessiven Gebrauch von Sonnenstudios, waren es Bakterien – oder eine Geißel Gottes, die „extra Peitsche, die der liebe Gott für die Homosexuellen bereit hat“, wie der Spiegel den Berliner Bakteriologen Franz Fehrenbach zitierte. Der Ton der Debatte war damit früh gesetzt, in den folgenden Jahren schwankte er meist zwischen apokalyptischen Seuchenängsten und Bestrafungsfantasien.
Im Juni 1983 geht der Spiegel erstmals mit dem Thema Aids auf den Titel, das amerikanische Seuchenzentrum in Atlanta hat zu diesem Zeitpunkt 1.556 eindeutige Aidsfälle weltweit registriert, in Deutschland sind 24 bekannt, 558 Todesfälle gibt es bislang in den USA: „Droht eine Pest? Wird Aids wie ein apokalyptischer Reiter auf schwarzem Ross über die Menschheit kommen? Ist eine moderne Seuche in Sicht, die sich zu Tod, Hunger und Krieg gesellen wird, wie einst im Mittelalter? Oder werden nur die homosexuellen Männer daran glauben müssen?“
Holzsärge, die in einem riesigen Massengrab auf einer Insel vor New York gestapelt wurden
Der Atlantik war entgegen mancher Hoffnung nicht breit genug gewesen – für viele schwule Männer aus der Mittelschicht war es zu dieser Zeit bereits üblich, regelmäßig in die USA zu fliegen – und zwar nicht zum Ski fahren.
1983 erklärt die Bundesregierung Aids in einer Pressemitteilung erstmals zu einem nationalen Problem, und der seinerzeitige Gesundheitsminister Heiner Geißler verkündet, die Krankheit bekämpfen zu wollen. Aber wie und womit? Das Bundesgesundheitsministerium lädt eine Task Force aus San Francisco ein, um sich beraten zu lassen.
Man prüft die Möglichkeiten des Bundesseuchengesetzes – aber wie lässt sich damit eine Krankheit bekämpfen, deren Übertragungswege und Inkubationszeiten niemand kennt? Und die vor allem eine Bevölkerungsgruppe betrifft, über die man wenig bis gar nichts weiß – während diese umgekehrt nach Verfolgungserfahrung im Rahmen des Paragrafen 175 ein tiefes Misstrauen gegenüber dem eigenen Staat hegt?
Ein gewisser Horst Seehofer
Bereits im Sommer 1983 gründete daher eine Gruppe schwuler Männer zusammen mit der Krankenschwester Sabine Lange die Deutsche Aidshilfe – eine Selbsthilfeorganisation, die allmählich vom staatlichen Gesundheitswesen inkorporiert wurde. Ganz im Geist der (neoliberalen) Zeit orientierte sich die Bundesregierung an der WHO-Charta von Ottawa (1986) und versuchte, Gesundheitsförderung in den jeweiligen Milieus oder Communitys herzustellen – unter aktiver Miteinbeziehung und durch Selbsthilfe. Die deutschen Aidshilfen erhielten via BZgA (Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung) massive staatliche Unterstützung.
Es war der Beginn einer letztlich erfolgreichen bundesdeutschen Aidsstrategie, der mit dem Namen Rita Süssmuth verbunden ist – die zugleich eine andere, sehr wichtige Voraussetzung hatte, nämlich die Entdeckung der Krankheitsursache im April 1984: Der Amerikaner Robert Gallo gab bekannt, dass Aids durch ein von ihm entdecktes Virus ausgelöst werde (bereits ein Jahr zuvor hatten Luc Montagnier und Françoise Barré-Sinoussi vom Institut Pasteur in Paris den HIV Typ 1 beschrieben).
Gegen eine Geißel Gottes hilft nur beten. Ein Virus kann man mit den Mitteln der Aufklärung bekämpfen. Was Rita Süssmuth, Gesundheitsministerin im Kabinett Kohl und gläubige Katholikin, in Angriff nahm, nachdem sie sich mit ihrem liberalen Ansatz gegen ihre Unions-Konkurrenz aus Bayern hatte durchsetzen können.
Wäre es nach der CSU gegangen, hätte man die Möglichkeiten des Bundesseuchengesetzes voll ausgeschöpft, inklusive „Contact Tracing“ und „Absonderung“ in speziellen Heimen, wie es ein gewisser Horst Seehofer seinerzeit forderte.
Flatten the Curve
Über die Aidshilfen konnten nun die „Risikogruppen“ in ihren unmittelbaren Umfeldern adressiert werden. 1984 waren bereits die ersten HIV-Tests erhältlich, 1985 setzte sich allmählich die Erkenntnis durch (außer im Vatikan), dass man sich mit Hilfe von Kondomen relativ gut vor der Ansteckung schützen kann.
Erstmals kam die leise Hoffnung auf, dass man diese Krankheit längerfristig in den Griff bekommen könnte. Und während man in München die Schwulensaunen schloss und die Heizung auf öffentlichen Toiletten herunterdrehte – im Februar 1987 hatte das Kabinett von Franz Josef Strauß einen Aids-Maßnahmenkatalog (Razzien, Zwangstests) beschlossen –, setzte man im Rest der Republik im großen Stil auf Aufklärung und Prävention.
„Kondom“ wurde das Wort des Jahres 1987. Und es funktionierte: Die Neuinfektionsraten in Deutschland sanken massiv, insbesondere die schwulen Männer änderten ihr Sexualverhalten – für den Fall, dass dem nicht so gewesen wäre, Flatten the Curve, hatte sich übrigens auch Süssmuths Bundesgesundheitsministerium härtere Maßnahmen in der Hinterhand behalten.
Anfang der neunziger Jahre geriet Aids dann in dem Maß in Vergessenheit, in dem die Mehrheitsbevölkerung begriff, dass die Apokalypse ausbleiben und sie als heterosexuelle Normalbürger ein relativ geringes Risiko hatten, sich mit dem HI-Virus zu infizieren. Den Gesundheitspolitikern war es gelungen, das Virus aus der Mitte der Gesellschaft herauszuhalten. Doch gerade zu diesem Zeitpunkt starben in der Gay-Community sehr viele Menschen unter teils tragischen Bedingungen. Aufmerksamkeit erregten aber nur noch prominente Fälle, etwa der Tod Freddie Mercurys 1991.
Der Wendepunkt
Aids blieb die Krankheit „der Anderen“, auch wenn es durchaus eine große Solidarisierung mit den Opfern gab, vor allem mit der Hauptbetroffenengruppe, den schwulen Männern. Im Großen und Ganzen aber wurde Aids im Laufe der Neunziger zu einem weiteren Problem „des Globalen Südens“, vor dem man glaubte die Augen verschließen zu können.
Ja, auch diese Seuche bekam man im Westen in den Griff. 1996 kam der Wendepunkt mit der Einführung von Haart, einer Kombinationstherapie mit Medikamenten, die das früher oder später zum Tod führende Virus an seiner Replikation hindern. Das Sterben hörte bei jenen auf, die Zugriff auf die Medikamente hatten, eine Heilung bedeutet diese Therapie indes bis heute nicht, denn das Virus verbleibt im Körper der Infizierten. Mit einem dieser Medikamente, Kaletra, verbindet sich nun die Hoffnung, Covid-19 in den Griff zu bekommen.
Während Corona gerade erst beginnt zu wüten, gibt es in Bezug auf Aids die konkrete Hoffnung auf ein Ende der Pandemie, die weltweit geschätzt 32 Millionen Todesopfer (UNAIDS) gefordert hat: Mithilfe der in immer mehr Ländern eingesetzten Medikamente und ihrer prophylaktischen Einnahme (PrEP) sowie konsequenter Testung hofft man die Krankheit längerfristig vom Antlitz der Erde zu verbannen.
Noch aber leben laut UNAIDS geschätzt 36,9 Millionen Menschen (Stand 2014) mit dem Virus – die Mehrheit von ihnen wartet noch immer auf Zugang zur antiretroviralen Therapie. In Deutschland leben laut Robert-Koch-Institut (Stand 2015) geschätzte 84.700 Menschen mit dem Virus, 72.000 davon mit Diagnose, 12.700 ohne. Im Jahr 2015 starben in Deutschland 460 Menschen an den Folgen von Aids, seit Beginn der Epidemie waren es insgesamt 28.100 Menschen.
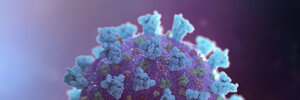










Leser*innenkommentare
Pia Mansfeld
Äpfel + Birnen = Obst
Ruediger
Der Corona-Virus ist per Tröpfchen- und höchstwahrscheinlich auch per Schmierinfektion übertragbar, HIV nicht. Eine HIV-Infektion ist bei vernünftigem Verhalten ohne besonders große Einschränkungen im Alltag für jeden vermeidbar (übrigens unabhängig von der sexuellen Orientierung). Das Risiko, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren ist selbst unter den momentanen Enschränkungen für alle um ein vielfaches höher, als eine HIV-Infektion unter normalen Umständen. Andererseits ist eine Covid-19-Erkrankung in den meisten Fällen viel weniger gravierend, als eine AIDS-Erkrankung. Es ist kein seriöser Journalismus, Corona als Aufhänger zu einem Artikel über Aids zu machen, nur weil beide durch Viren ausgelöst werden.
mats
@Ruediger Also 800.000 Tote und 25 Mio. Infizierte in Afrika sind selber schuld wg. fehlendem "vernünftigen Verhalten". Gut, dass wir das jetzt endlich verstehen, nachdem Sie es uns erklärt haben.
Ruediger
@mats Ich habe hier nichts von Schuld geschreiben, sondern von Vermeidbarkeit. Voraussetzung dafür ist natürlich immer das entsprechende Wissen, wie ich etwas vermeide und gegebenenfalls auch die Mittel, um es zu vermeiden. Ein Moralurteil erlaube ich mir weder über HIV-Infizierte in Afrika, noch in Europa oder auf anderen Kontinenten.
Matthes
@Ruediger Das HIV-Übertragungsrisiko ist bei ungeschütztem Analverkehr um ein vielfaches höher als bei Vaginalverkehr. Hat also in gewisser Weise schon etwas mit der sexuellen Orientierung zu tun, dass bei Männern, die Sex mit Männern haben, das Risiko höher ist. Ganz davon abgesehen, dass es auch psychische Faktoren gibt, die mit einem höheren Risikoverhalten einhergehen, die unter anderem durch Ausgrenzung und Stigmatisierung von Homosexuellen zu tun hat. Es ist also wesentlich komplexer, als die einfache Formel “kann man doch mit Kondom verhindern”.