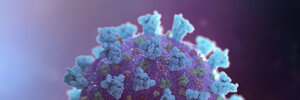Clubs in der Coronapause: Nachtleben im Ausnahmezustand
Der Berliner Senat hat das Nachtleben gestoppt, um eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Wie gehen Clubs mit der Zwangspause um?

Auch hier herrscht derzeit Leere: der Berliner Club „Lido“ Foto: reuters
Die „Tennis Bar“ im Westberliner Bezirk Neukölln, ein typischer Ort im Kiez um die Flughafenstraße: Oben Kneipe, unten, im Keller, ist Platz für einen Dancefloor und Konzerte, ein Hotspot der Do-it-yourself-Musikszene. Bis zum Freitag letzter Woche: „Wir hatten da ein Karaoke-Event geplant. Und die Vorstellung, dass 200 Menschen ins gleiche Mikrofon singen: Na ja“, sagt Betreiber Ryan Rosell. Also kam man „aus ethischen Gründen“ der Senatsentscheidung zuvor und schloss die Türen schon 24 Stunden früher. Jetzt lebt Rosell selbst in der Bar, weil sie größer ist als seine Wohnung.
Da die Sommermonate traditionell schlechter laufen, weil die „Tennis Bar“ keinen Garten besitzt, hat Rosells Betrieb ohnehin Geld zurückgelegt. Fürs Erste fühlt er sich gewappnet. Mit den beiden Angestellten, die auf das Geld von Barschichten angewiesen sind, hat er als Erstes geredet: „Wir haben einen Punk-Deal gemacht: Wenn sie wirklich Geld brauchen, melden sie sich, und wir überlegen uns gemeinsam eine Lösung.“ Die „Tennis Bar“ fährt damit noch vergleichsweise gut.
Schon bevor der Senat verkündete, den Betrieb aller Bars, Clubs und ähnlicher Orte des Nachtlebens zu untersagen, haben sich einige der großen Player entschlossen, Hallen, Keller und Sitzecken geschlossen zu halten: Corona ist derzeit definitiv die härteste Tür Berlins. Schwierig ist die Lage vor allem für die Angestellten, die Auftragnehmer*innen von Sicherheitsdiensten und für DJs und Musiker*innen, die von Auftritten leben.
Schnell stellte die Vereinigung der Clubbetreibenden, die Clubcommission Berlin, die Forderung nach Sofortmaßnahmen auf, mehrere Millionen Euro seien jeden Monat nötig, um ein Ausbluten der Szene zu verhindern. Und tatsächlich scheint es, dass die Politik in Stadt und Bund den Wert von Kultur in allen Spielarten erkannt hat, eben auch, wenn es um Clubkultur geht.
Erste Beschlüsse sehen etwa vor, Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer*innen mit maximal 5.000 Euro zu bezuschussen. Es gibt erste Selbsthilfemaßnahmen: Crowdfunding-Projekte und die Idee, mit Streaming unter dem Hashtag #unitedwestream Spendengelder zu sammeln.
Bis zu 200 Menschen im Monat
Crowdfunding wird auch für das „Loophole“, in Nachbarschaft der „Tennis Bar“ gelegen, die nächste Option sein. Jeden Abend, an dem der kleine Club geöffnet wäre, fände dort eine Veranstaltung statt, meist mit vier bis acht beteiligten Künstler*innen, oft aus der Indie-Musikszene: bis zu 200 Menschen im Monat, die nun hier nicht auftreten können.
Hinzu kommen zehn Menschen, die im Hintergrund arbeiten. Die meisten sind selbstständig, haben andere Jobs – die allerdings nun ebenfalls ausgesetzt sind: in der Veranstaltungstechnik oder im Musikbereich. „Loophole“-Leiter Jan Gryczan überlegt, sich vorerst arbeitslos zu melden.
Für seinen Laden, der erst vor wenigen Jahren mit einer Crowdfunding-Kampagne vor der Pleite (wegen einer Mietsteigerung) gerettet wurde, hofft er vor allem auf rasche Hilfe der Politik, am besten nicht durch eine Darlehenslösung: „Das wäre keine große Hilfe, wir sind sowieso am Minimum, nach Jahren der Gentrifizierung. Jeden Monat, den wir geschlossen haben, verliert der Club mehrere Tausend Euro. Das abzubezahlen würde Jahre dauern.“
Mitarbeitende und Miete bezahlen
Wie die zugesagten Sofortmaßnahmen des Senats sich auswirken, kann Gryczan noch nicht abschätzen. 5.000 Euro wäre immerhin eine Grundsicherung für die ersten Monate, aber ob das reicht, Mitarbeitende und Miete zu bezahlen, bleibt ungewiss.
Der Technoclub „://about blank“ am Ostkreuz zwischen Friedrichshain und Lichtenberg gehört hingegen zu den größeren Clubs der Stadt. Hier hat sich schnell eine Struktur etabliert, ein Krisenstab, in dem Teile des Betreiber*innenkollektivs sitzen, aber auch Vertreter*innen der Mitarbeitenden.
„Es muss erst mal Recherche betrieben werden, zu Kurzarbeiter*innengeld, zu Kommunikationsstrukturen, die Präsenzplena ersetzen“, sagt Eli, Teil dieses Krisenstabs. Wie der sich fand: „Na ja, Linke halt. Wir haben eine ausgefeilte Organisationsstruktur mit dezentralen AGs. Davon profitieren wir in der Krisenzeit.“
Hoffen auf unbürokratische Hilfe aus der Politik
Erste Initiative: Crowdfunding. Die Zielsetzung, 20.000 Euro, kam in kurzer Zeit zusammen. „Wir sind auf schnelle Hilfe aus der Community angewiesen und sind gerührt, wie gut das angelaufen ist. Aber wir hoffen auch auf unbürokratische Hilfe aus der Politik“, sagt die „blank“-Aktivistin.
„Wie alle Berliner Clubs stehen wir unter krassem Verwertungsdruck, es bleibt wenig, was man zurücklegen kann.“ Laufende Kosten sollen gestundet werden. Bei der Miete hofft der Club auf Entgegenkommen des Bezirks, dem das Gelände gehört. Was gegen die derzeitige Ungewissheit hilft: Kollektiverfahrung. „Das ist eine gesellschaftliche Frage, die uns alle berührt. Jenseits der Frage, wann wir wieder das Geschäft aufmachen, geht es darum, uns nicht im Stich zu lassen, Supportstrukturen aufbauen, damit wir nicht durchdrehen.“
Ryan Rosell, der es sich derweil in der „Tennis Bar“ bequem gemacht hat, hat inzwischen einen Job gefunden, mit dem er hofft durch die schwere Zeit zu kommen. „Es gibt Branchen, die von der Krise profitieren“, sagt er – und arbeitet nun freiberuflich als Grafiker für ein Online-Porno-Portal.