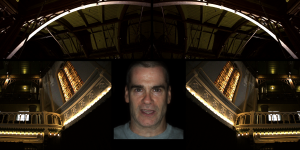Der Hausbesuch: Dunkelbunt, nicht schwarz
Er war Ost-Punk, der im Westen nicht klar kam. Drogen, Prostitution, Knast. Heute betreibt Joachim Thiele einen Waschsalon mit Schanklizenz.

Die Oberbürgermeister von Ansbach nennt Joes Waschsalon Treff für „linksradikale Subkultur“ Foto: Felie Zerneck
Ansbach sei grau, sagt Joe. Ansbach, Mittelfranken, 40.000 Einwohner, sei bewohnt von Leuten, „die gern zu Hause bleiben“. Zu Besuch bei einem, der das doch auch verstehen kann.
Draußen: Ein paar Studentinnen radeln durch die Würzburger Landstraße am Rande der Altstadt von Ansbach. Im Hinterhof von einem der Häuser stehen drei Lastenräder und ein bunt angespraytes Mofa, dazu Möbel und Flohmarktkram bis zur Dachrinne.
Drinnen: Die Treppen knarzen. Im obersten Stock liegt Joes Dreizimmerwohnung und Zweizimmerbaustelle. Links: das künftige Schlafzimmer, eine petrolblaue Wand neben einer gelben, neben einer roten. Skateboards sollen als Regale an die Wand. Das Bad, eine Fußabtretergröße länger als die Duschkabine, glitzert. Ein Fernseher, halb so groß wie Joes ungemachtes Bett, steht im Zimmer nebenan. Die Küche ist am kargsten: ein Campingherd, zwei Messer, zwei Brettchen, zwei Stühle. Auf einen lässt sich Joe fallen und schnallt den Rückengurt ab. Er käme gerade von einer Haushaltsauflösung.
Joe: Nur in seiner Akte wird er als „Joachim Thiele“ geführt: weinroter Hoodie, Mütze und Camouflagehose, die Abzeichen rasseln an seiner buntbestickten Lederjacke. Der 42-Jährige wohnt über seinem „Café Stoertebeker“: einem Waschsalon mit Ramschladen, Treff für „linksradikale Subkultur“ laut der Oberbürgermeisterin. Seit zwanzig Jahren lebt er in Franken.
Kindheit: Joe wächst im Erzgebirge auf, „in Aue, da gibt’s Haue“, sagt er. Er erinnert sich, dass sich die Jungs im Ort einmal im Monat auf dem Sportplatz trafen, „rechts gegen links“, um sich zu kloppen. Der Verlierer bekam bis zum nächsten „Spiel“ Innenstadtverbot: „Das war Krieg, ganz klar“, sagt Joe und pafft den Rauch seiner Zigarette stoßweise in die Luft. Manchmal waren die Bordsteine blutig rot.

Joe nennt seinen Laden Café Stoertebecker Foto: Felie Zerneck
Rosa: Die Pillen, die Joe seine ganze Kindheit schlucken muss. Wegen ADHS. Als Joes Mutter sich mit einer Überdosis seiner Tabletten umbringen will, schläft sie vier Tage.
Grün und blau: Erst später wird Joe erfahren, dass er aus einem Missbrauch entstand. „Sie hat mich immer verdroschen“, erzählt Joe, das sei das Einzige gewesen, was seine Mutter ihm geben konnte. Seine Reaktion: Regelbruch. Dann zeigt er eine kahle Stelle unter seiner Mütze, es sei ihre Lieblingsstelle gewesen. Als Joe von seiner Schule fliegt, kommt er ins Heim.
Blauweiß: Seine Tasche, die die anderen an seinem ersten Tag im Heim plündern. Von ihnen lernt er ganz neue Regeln: dass jede Strafe kollektiv ausgehandelt wird. Etwa mit Gruppenkeile: „Einer an die Wand und alle mit den Fäusten drauf. Bam“, sagt er und klatscht mit der Hand auf den Tisch. Oder man wurde an die Stromleitung „angeschlossen“, flog zwei, drei Meter weit. Fünf Peiniger habe er gehabt, sei fast täglich sexuell missbraucht worden. Als er irgendwann zusammenklappt, erzählt Joe, was passiert ist. Die jungen Männer bekommen einen Monat Ausgangssperre, es gibt eine Runde Gruppenkeile. Er schämte sich, sagt Joe, raucht die dritte Zigarette in Folge.

Dieser Text stammt aus der taz am wochenende. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im praktischen Wochenendabo. Und bei Facebook und Twitter.
Rotweiß: Die Farben der Flagge im Zimmer seiner ersten Arbeitskollegen. „Geh rüber“, riet ihm die Mutter: „Im Westen, da wirste was.“ Er bekommt eine Lehrstelle als Metzger in Fürth. Mit einem Gesellen, einem Nazi, teilt er sich ein Doppelbett in einem fensterlosen Zimmer: „In der Arbeit haben wir uns verstanden, danach sind wir mit Messern aufeinander los.“ Es geht nicht lange gut: „Ich war ein Punk aus dem Osten, ich kam im Westen nicht klar.“ Es ist das Jahr, in dem Joe Vegetarier wird und anfängt, Whiskey zu trinken.
Rot: Joes Zeiten als Punk: hier Heroin, da Crack, zwischen Berlin, Hamburg, Konzerte, Festivals, da was geklaut, dort eingebrochen, abgestürzt, Hauptsache: „Essen, essen, Party, Party, saufen, saufen“. In Frankfurt kommt Joe das erste Mal in kalten Entzug: „Ohne gute Freunde wäre ich verreckt.“
Schwarz: Um Geld zu verdienen, verteilt er Prospekte, fegt Straßen, irgendwann bietet er seinen Körper in einer Toilette gegen Geld an. Mit 17 landet Joe auf der Straße: „Ich war ein hilfloses Opfer, mit mir wurde alles gemacht.“ Das erste Delikt in der Akte: als er Fleischsalat klaute, „das ist lange her“. Dann kamen die Einträge unter Körperverletzung: „Irgendwann habe ich mich gegen alles gewehrt, und das Einzige, was ich kannte, waren Schläge. Ich dachte, das wäre richtig.“ Während seiner „Laufbahn als Strichjunge“ lernt er seine damalige Freundin kennen.
„Und da ist was passiert“, sagt er. Er zögert. Mit einem frisch geschliffenen Fleischerbeil geht er auf einen Nebenbuhler los. Blackout. „Ich war froh, dass ich es nicht geschafft hab, ihn zu töten.“ 1995, im Jugendgefängnis in Augsburg, findet ihn die Mutter wieder. Als er später wieder wegen Körperverletzung auffällig wird, bekommt er sechs Jahre. „Die Zeit im Knast hat mir mein Leben gerettet“, sagt er.
Schwarz auf weiß: Für die Therapie kommt Joe nach Ansbach, verliebt sich in seine Krankenschwester. Sie wird schwanger. „Aber der Joe damals war eben noch nicht resozialisiert“, sagt er. Als er den Gerichtsbeschluss liest, dass er sich seinen Kindern nicht nähern darf, weiß er: „Ich muss was tun.“ An einem Tag im Jahr 2008 verabschiedet er sich in der Werkstatt von seinen Kumpels mit den Worten: „Morgen trink ich nicht mehr.“ Sie lachen. Seither ist er trocken. Ohne diese Entscheidung hätte er seine Kinder, heute 10 und 12, wohl nie mehr gesehen.

Seit er seinen Waschsalon hat sei er kein Verlierer mehr, sondern Künstler, sagt Joe. Foto: Felie Zerneck
Dunkelbunt: „Ein Ex-Alkoholiker, der eine Schanklizenz für einen Waschsalon haben möchte?“, fragte ihn der Beamte im Landratsamt. Seinen Laden nennt Joe heute „sein Wohnzimmer“ und „ein Spiel“. Wie in einer Tropfsteinhöhle hängen Playmobil, Dinosaurier oder Piratenschiffe von der Decke. Und 12.000 Sterne aus Klebefolie, selbst ausgeschnitten.
Es riecht nach vergessenen Bierflaschen und Vanille-Cappuccino aus der Dose. Im Hinterzimmer brummen die Waschmaschinen. In einem Ordner schlägt Joe eine Seite mit Bildern auf. 2010. Von Punks, Christen bis „noch so ’n Ossi, auch wenn er ’n Nazi ist“, alle helfen ihm: „Mir sind die Tränen gekommen.“ Seither sei er nicht mehr Verlierer, sondern Künstler.
Die letzte Straftat: als er „aus Versehen“ die Scheibe der Redaktion der Fränkischen Landeszeitung einschlägt. Am nächsten Tag titelt die Lokalzeitung: „Mann mit bunter Flickenhose gesucht.“ Joe erscheint mit Rosen und einer Entschuldigung. Seitdem käme er nur noch vorbei, um Punkkonzerte in seinem Laden anzukündigen. „Klar“, sagt Joe, „wenn jemand Mist baut und der Gesetzgeber das vorschreibt, wird man bestraft“. Viel zu human aber sei der Rechtsstaat mit Missbrauch. Keiner seiner Peiniger wurde je angeklagt.
Die Zukunft: „Ist bunt“, sagt Joe. Er sei nicht der Hellste, gebe aber sein Bestes. Glücklich sei er, wenn er den Alltag hinbekomme. „Irgendwann werde ich nicht mehr jeden Monat kämpfen“, das habe er schon bei der Einweihung gesagt. Immerhin, es sei das erste Mal, dass er Hartz-IV-frei ist. Zufrieden sei er, wenn er das Gefühl habe, „dass ich wer bin und so sein darf, wie ich bin. Mit Fehlern.“