Flucht und Evakuierungen in der Ukraine: Wer zurückbleibt, verdient Respekt
Ukrainer, die ihre Heimatorte nicht verlassen wollen, werden häufig kritisiert. Dabei gibt es ganz verschiedene Gründe, in den Kriegsgebieten zu bleiben.

Mychaylo Jurkiw, 65, klettert aus dem Bunker, in dem er im Gebiet Charkiw sechs Monate lang lebte Foto: Clodagh Kilcoyne/REUTERS
Eines der wichtigsten Themen im Kontext des russisch-ukrainischen Krieges sind die Flüchtlinge. Millionen Menschen waren gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen, um ihr Leben zu retten. Sie sind jetzt über die ganze Welt verteilt, versuchen, an den neuen Wohnorten zu überleben, um zumindest teilweise wieder ihren Lebensstandard aus der Vorkriegszeit zu erreichen: eine Wohnung finden, einen Job, eine Schule für ihre Kinder, medizinische Versorgung.
Aber was ist mit denen, die ganz bewusst in den umkämpften Gebieten geblieben sind? Man hält sie oft für Selbstmordkandidaten, und manchmal bezeichnet man sie sogar als Kollaborateure, die quasi auf die Okkupanten warten würden.
Meine Oma zum Beispiel ist praktisch noch nie aus dem Gebiet Donezk herausgekommen. Jetzt ist sie fast 80, sie ist Witwe, schwer krank und möchte ihr Zuhause einfach nicht mehr verlassen. In ihrem kleinen Haus gibt es keine einzige heile Fensterscheibe mehr, das Dach ist beschädigt und fast alle ihre ehemaligen Nachbarn sind nicht mehr da. Seit einem halben Jahr hat sie keinen Strom mehr und selbst das Aufladen ihres Mobiltelefons wird zum Abenteuer, weil sie immer erst mal zu einem Haus gelangen muss, wo ein Generator steht.
Dieses Existieren kann man nur noch mit gutem Willen als Leben bezeichnen. Und solche Leute wie meine Oma gibt es viele. Die Behörden setzen sie ständig mit der Forderung zur „Evakuierung“ unter Druck – obwohl die staatliche Unterstützung hier sehr begrenzt ist. Sie helfen dabei, die Gegend zu verlassen. Für alles Weitere ist man dann schon selber verantwortlich.
„Wie kann man dort nur bleiben?“, schreibt jemand in einem Onlinekommentar. „Sie sind selber schuld“, schreibt ein anderer, als wieder eine Meldung über den Tod von Zivilisten in einem umkämpften Gebiet kommt.
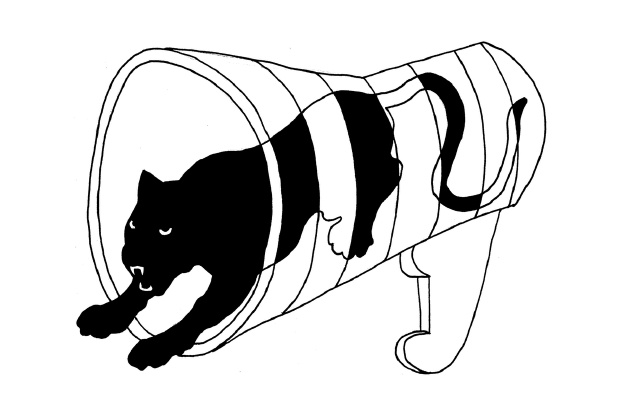
Unterstützen Sie die taz Panter Stiftung und ihre Projekte in Osteuropa mit einer Spende. Mehr erfahren
„Man hat Ihnen doch die Evakuierung angeboten? Welche Forderungen haben Sie denn noch?“, so enden üblicherweise diese Diskussionen. Menschen, die verhältnismäßig warm und sicher leben, fällt es aus irgendwelchen Gründen leichter, unschuldige Kriegsopfer zu beschuldigen als, sagen wir, die Besatzungsmacht, die auch ihnen das Leben unerträglich macht.
Aber die Menschen, die noch in den umkämpften Gebieten leben, wollen nicht, können nicht und sind in ihrem Zustand auch gar nicht mehr in der Lage, noch irgendwohin zu fahren. Sie haben kein Geld, keine Transportmöglichkeit, keine Verwandten in einer sichereren Gegend. Manche haben kranke Eltern, manche haben Tiere, und machen haben einfach Angst, ihr Haus zurückzulassen, weil das oft ihr einziger Besitz ist.
Ja, das sind häufig keine rationalen Entscheidungen, aber im Krieg sind solche Entscheidungen generell ein Problem. Zum Beispiel wurden Häuser von Menschen zerstört, weil Russland beschlossen hatte, die Ukraine zu „denazifizieren“. Und das ist doch das eigentlich Nichtrationale. Die Ersten, die „denazifiziert“ wurden, waren die Zivilisten, die das Pech hatten, in Grenznähe zu leben. Sind sie auch selber daran schuld?
Die Stimmen derer, die Menschen verurteilen, werden lauter als die derjenigen, die direkt im Kriegsgebiet leben und immer wieder darum bitten, in Ruhe gelassen zu werden, anstatt sich politisch positionieren zu müssen. Ich denke, man muss die Dagebliebenen verstehen.
Aus dem Russischen Gaby Coldewey








Leser*innenkommentare
Struppo
Danke für diesen einfühlsamen Bericht!