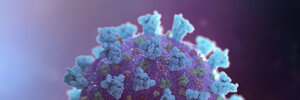Die Folgen der Pandemie: „Die Reflexion fängt jetzt erst an“
25 Berliner Fotografinnen werden ungemütlich und werfen einen weiblichen Blick auf die Pandemie. Es geht um Gewalt, Alleinerziehende, Systemrelevanz.

Eine Arbeit aus der Ausstellung „In Waves“ Foto: Abi Shehu
taz: Das Projekt „In waves #womenincovid“ zeigt, wie die Pandemie das Leben von Frauen verändert. Beginnt jetzt die Verarbeitung der Krise?
Sophie Kirchner: Ich glaube, die Menschen, über die wir in der Ausstellung erzählen, hatten noch gar nicht die Luft dazu, zu reflektieren, was da eigentlich passiert ist. Das fängt jetzt erst an. Viele sind noch in einer Schockstarre, deshalb ist unsere Arbeit ein Versuch, das emotional einzufangen.
Miriam Zlobinski ist Historikerin und Kuratorin der Fotoausstellung „IN WAVES #womenincovid“, Sophie Kirchner ist eine der Fotografinnen. Noch bis zum 3. Oktober ist die Ausstellung auf einer 85 Meter langen Plakatwand in der Köpenicker Straße 70 zu sehen.
Wie ist das Projekt entstanden?
Miriam Zlobinski: Nach den Eindrücken des ersten Lockdowns. Wir haben gesagt: Wir wollen Frauen sichtbar machen, durch die Kameras von Frauen. „In waves“ sind 24 visuelle Standpunkte von Fotografinnen über Themen, die mit der weiblichen Lebenswelt zusammenhängen und die sich durch die Pandemie verschlimmert haben.
Worin liegt die Dringlichkeit der Ausstellung?
Kirchner: Deutschland möchte sich als gleichberechtigtes Land sehen. Wir stellen mit der Arbeit die Frage: Ist das so? Wir werden auch ein bisschen ungemütlicher und machen eine Ansage: Hier gibt es Themen, die wir bitte vor lauter Impfthematik nicht vergessen wollen. Ein paar Sachen haben sich sogar zurückentwickelt, in Zeiten, von denen wir gedacht haben, dass wir als Gesellschaft schon weiter wären.
Welche Themen sind das?
Kirchner: Die Pandemie legt offen, dass es nach wie vor Gewalt gegen Frauen gibt. Die Kontaktbeschränkungen führten dazu, dass die Zahlen, was häusliche Gewalt gegenüber Frauen angeht, hochgingen. Und natürlich stecken Frauen zurück, was das Einkommen angeht, weil sie in der Betreuung der Kinder Kompromisse machen. In meinem Projekt „Alleinerziehende Mütter“ sind vorrangig Frauen alleinerziehend, das ist auch ein Problem.

Junge Ärztin in der Pandemie Foto: Maidje Meergans
Zlobinski: Aber auch die jungen Ärztinnen von Maidje Meergans, die alle drei während der Pandemie ihr erstes Berufsjahr haben, sind ein zentrales Thema. Genauso die Fabrikarbeiterinnen von Monika Keiler, wo wir den Begriff „systemrelevant“ haben und fragen: Was steckt eigentlich hinter dieser Kategorie?
Viele von den prekären Situationen, in denen sich die Frauen auf den Fotos befinden, waren doch vor der Pandemie schon genauso prekär.
Zlobinski: Sie haben sich jetzt wie durch ein Brennglas verschärft und sie werden auch nicht von alleine wieder gehen.
Kirchner: Wir wollen Themen, die hinter Vorhängen vonstatten gehen, auf die Straße holen. Deshalb auch ganz bewusst die Ausstellung draußen und in vier Sprachen, damit da so gut wie keine Barrieren sind.
Deshalb auch das Medium der Fotografie?
Zlobinski: Fotografie ist ein Medium der Emotion, das wir alle kennen. Wir können die Themen völlig anders angehen und vermitteln, als ein Text das kann. Und mit der Ausstellung auf der Straße haben wir einen Ort, der überhaupt nichts Elitäres hat. Da kann jeder sich das anschauen, zwischen Sage Club, Biergarten und Heinrich-Heine-Straße.